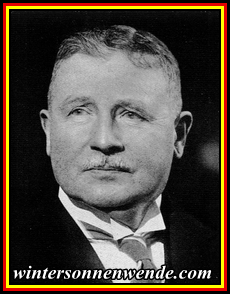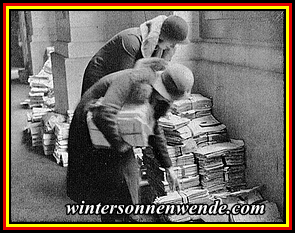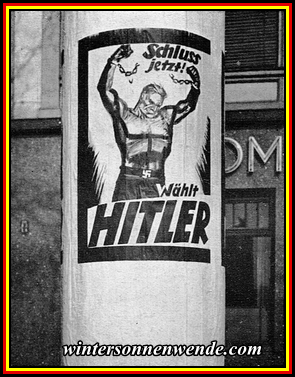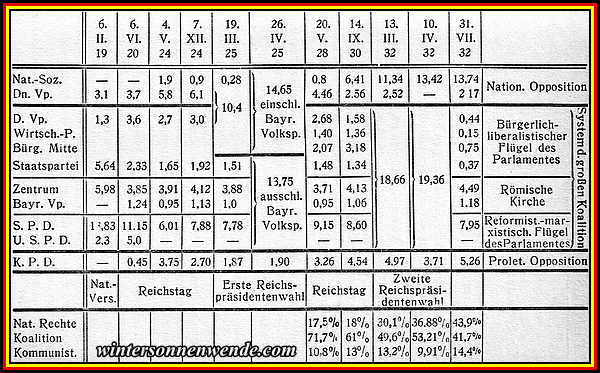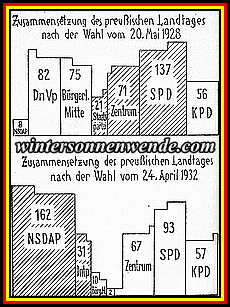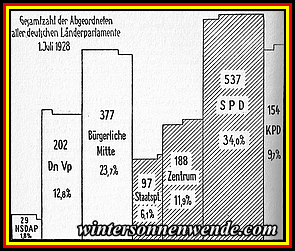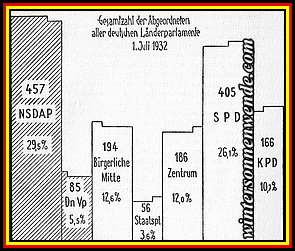|
[Bd. 6 S. 139] 9. Kapitel: Abrüstungsstreit. Wahlkämpfe in Deutschland. Zwei Ereignisse standen drohend über dem Schicksal Deutschlands und warfen ihre Schatten schon auf die Katastrophe des Jahres 1931, die von der Not der Tribute, der Kredite und der inneren Spannungen erfüllt war. Es war dies die Abrüstungskonferenz, welche im Frühjahr 1932 beginnen sollte, und es waren dies ferner die bevorstehenden Wahlen zur Reichspräsidentschaft und zu mehreren deutschen Landesversammlungen, insbesondere zum Preußischen Landtag. Mit zunehmender Gewalt drängten die deutschen Dinge zu jenen Ereignissen hin. Der Strom der deutschen Geschichte, breit und in Gegensätzen dahinfließend, vereinigte sich zu vermehrter Kraft auf diese beiden Ereignisse, wie ein großer Strom, der in den Lauf eines künstlichen Kanals gezwängt wird. Der Reichskanzler Brüning regierte nicht mehr mit den großen Parteien Deutschlands, wie das vor ihm der Fall war, sondern er regierte gegen sie. Darin lag die Schwäche, die verwundbare Stelle des demokratischen Gedankens, und dies wußte Brüning. Deshalb forderte er das Primat der Außenpolitik vor der Innenpolitik, um die inneren Spannungen durch Ablenkung nach außen zu mildern. In der Tat war Brüning standhaft in der Verweigerung der Tribute. Er hatte dabei die Unterstützung Englands und Italiens und geriet dadurch in schroffen Gegensatz zu Frankreich. Dennoch versuchte er, mit Frankreich eine Art wirtschaftliche Schicksalsverbundenheit zu erreichen, wie es Stresemann, Mahraun, Rechberg und andere Politiker der Mitte sowie überhaupt das Zentrum und die Sozialdemokratie erstrebten. Das war ein zwiespältiges Ziel, ein durch unvereinbare Gegensätze unmögliches Kompromiß. Denn es war nicht möglich, wenn man die Tribute verweigerte, mit Frankreich in eine freundschaftliche Verbindung zu kommen. Sodann aber wurde Brünings innenpolitisches Be- [140] mühen, sich im Gleichgewicht gegen sämtliche Parteien, auch die nationale Opposition, zu behaupten, im Auslande mit Mißtrauen verfolgt. In England und Amerika wünschte man es lieber, Brüning würde auch die Nationalsozialisten an seiner Regierung und Politik beteiligen. In der breiteren Grundlage sah man eine größere Gewähr für Beständigkeit.
Das ganze Abrüstungsproblem, das jetzt in Fluß kam, gründete sich auf eine doppelte These. Am Anfang des fünften Teiles des Versailler Vertrages stand der Satz:
"Um den Anfang einer allgemeinen Beschränkung der Rüstungen aller Nationen zu ermöglichen, verpflichtet sich Deutschland zur genauen Befolgung nachstehender Bestimmungen über die Land-, See- und Luftstreitkräfte". Hieraus ergab sich zwar die zwangsmäßige Abrüstung Deutschlands, aber zugleich die Abrüstungspflicht der anderen, die dann ausdrücklich im achten Artikel der Völkerbundsakte ausgesprochen wurde:
"Die Mitglieder des Bundes erkennen an, daß die Aufrechterhaltung des Friedens es nötig macht, die nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß herabzusetzen, das mit der nationalen Sicherheit und mit der Durchführung der durch ein gemeinsames Handeln auferlegten internationalen Verpflichtungen vereinbar ist. Der Rat bereitet unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der besonderen Umstände jedes Staates die Pläne für diese Abrüstung zum Zweck einer Prüfung und Entscheidung durch die verschiedenen Regierungen vor." Die nationale Sicherheit und geographische Lage – das waren nun die beiden Gründe, aus denen Frankreich das Recht ableitete, jede Abrüstung für sich zu verweigern, wie dies der [141] Konventionsentwurf von 1930 auch tat. Andrerseits gründeten die Deutschen gerade hierauf ihre Forderung nach Ablehnung des Konventionsentwurfes und nach Abrüstung der andern, sie verlangten unbedingte Gleichberechtigung mit den andern Völkern in der Rüstungsfrage. Generaloberst von Seeckt, der Schöpfer und ehemalige Führer der Reichswehr, sagte Anfang Mai 1931: es komme nur zweierlei in Frage: entweder rüsten die andern ab, oder Deutschland rüstet wieder auf, man könne dabei an eine Verbindung des Berufssoldatentums mit allgemeiner Wehrpflicht, etwa in Form der Miliz, denken. Diese These stand im entschiedenen Gegensatz zum Konventionsentwurf. Die Franzosen waren von dieser deutschen Entschlossenheit wenig erbaut. Die Mehrheit des französischen Volkes war nicht geneigt, sich von seinen vergötterten Soldaten zu trennen, war aber ebensowenig geneigt, den Deutschen das gleiche Recht auf ein Heer einzuräumen. In Paris erwog man bereits im Mai 1931, eine Verschiebung der Genfer Konferenz zu beantragen. Und zudem griffen die französischen Machthaber in ihrer Bedrängnis zu sehr unanständigen Mitteln. Da es in Deutschland Lumpen genug gab, überzogen sie das Reich mit einem großen Spionagenetz. Die französischen Spione, die man in Köln, Königsberg, Wesel, Jülich, ja sogar auf der Kriegsflotte entdeckte, entstammten sozialdemokratischen und kommunistischen Kreisen und lieferten eifrig Berichte über angebliche deutsche Geheimrüstungen nach Paris. Auf die Berichte dieser Spione und die Äußerungen der kommunistischen Reichstagsabgeordneten stützte sich der ehemalige französische Militärattaché in Berlin, General Tournes, bei seinen Enthüllungen. Er fand es sonderbar, daß man in Deutschland so wenig Auskunft über die Verhältnisse in der Reichswehr erhalte. Die Verhandlungen darüber seien nicht öffentlich, aber der Reichswehretat von 800 Millionen sei verdächtig hoch. Auch häuften sich in diesen Monaten die Grenzverletzungen durch französische und polnische Flieger. Über den Gebieten des Rheins und Mains erschienen französische Militärflugzeuge, eins mußte sogar in der Pfalz landen, ja, über den deutschen Nordseeinseln zeigten sich französische Marineflugzeuge mehr- [142] mals, einmal ein ganzer Schwarm. Tschechische Militärflieger kamen über das Erzgebirge und polnische überflogen Ostpreußen und die Grenzmark. Wie man denn auch beim Stahlhelmtag in Breslau Anfang Juni polnische und tschechische Spione verhaftete. Die öffentliche Meinung Frankreichs forderte es, daß Frankreich bis an die Zähne bewaffnet blieb. In diesen Tagen verteidigte Briand seine Politik vor der Öffentlichkeit: er sei immer bemüht gewesen, "die Lücken des Versailler Vertrages auszufüllen und seine Garantien zu vermehren". Anfang Juli bewilligte der Senat 2 ½ Milliarden zum Ausbau der Festungen, der Luftflotte und der U-Bootflotte, "aus Liebe zum Frieden". Andrer Ansicht war man in England. Lord Cecil, der Vertreter Englands im Völkerbund, meinte Ende April, man könne es Deutschland nicht verübeln, wenn es nach Fehlschlagen der Genfer Konferenz aus dem Völkerbund austrete. Die internationalen Rüstungen müßten zunächst um ein Viertel vermindert werden, das sei nur der erste Schritt. Die Sicherheitsfrage sei durch ein halb Dutzend Verträge bereits hinreichend berücksichtigt. Henderson forderte entschlossene Abrüstung, um die Genfer Konferenz vor einem Fehlschlag zu bewahren. Das war wohl auch der Punkt, in dem zwischen Macdonald und Brüning bei den Verhandlungen zu Chequers Einmütigkeit erzielt wurde. Ende Juni waren sich im Unterhaus Konservative, Liberale und Arbeiterparteiler einig, daß alle Rüstungen durch internationale Vereinbarungen herabzusetzen seien. In Amerika forderten weite Kreise die Abrüstung der Welt. In dem hohen Stande der Rüstungen erblickten sie dauernde Gefahren für die Weltwirtschaft. Hoover sah eine Hauptursache für den Niedergang der Weltwirtschaft in dem allgemeinen Wettrüsten. Darum forderte er progressive Herabsetzung und trug sich mit dem Gedanken, in dieser Frage die Initiative zu ergreifen. Er glaubte, eine allgemeine Herabsetzung aller Rüstungen auf zwei Drittel der Vorkriegsstärke vorschlagen zu müssen. Stimson, der Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, weilte Ende Juni in Europa und ver- [143] breitete Hoovers Absichten. Ihr besonderes Kennzeichen war die Verquickung der Abrüstungsangelegenheit mit der allgemeinen Neuregelung der Schulden: erst Abrüstung, dann Schuldenrevision. Das war ja auch Senator Borahs These, der da außerdem erklärte, daß die schweren Rüstungen der andern Nationen eine Verletzung des Versailler Vertrages darstellten. Hoover, Stimson und Borah waren auch entschieden gegen jede Verschiebung der Abrüstungskonferenz und wünschten eine Beteiligung Amerikas daran. Besonders in Rom fand Stimson weitgehendes Verständnis für die amerikanischen Vorschläge. Mussolini befürwortete auch die Verknüpfung des Abrüstungsproblems mit dem Schuldenproblem. Es sei ein wirksamer Beitrag zur Beschränkung der Rüstungen, wenn jeder Staat verzichten würde auf den Betrag, um den die deutschen Reparationen die eignen Kriegsschulden übersteigen. Italien sei bereit, die geringste Rüstungsziffer anzunehmen, auch 10 000 Gewehre für ganz Italien, vorausgesetzt, daß keine andere Nation mehr habe. Stimson, Mussolini und der italienische Außenminister Grandi kamen überein, daß Italien in der Septembertagung des Völkerbundes einen Abrüstungsvorstoß unternehmen solle, zunächst einmal dahingehend, für die Dauer der Abrüstungskonferenz alle weiteren Rüstungen zu unterlassen. So ward in den geheimen Ministerbesprechungen in Chequers, London, Berlin und Rom durch die Staatsmänner Macdonald, Henderson, Brüning, Stimson, Mussolini und Grandi die deutsch-englisch-amerikanisch-italienische Weltabrüstungsfront gegen Frankreich geschaffen. Aber Frankreich und seine Staatsmänner, Laval, Briand, Tardieu, waren weit entfernt, ihr Spiel verloren zu geben. Ende Juli 1931 reichte die Pariser Regierung dem Völkerbund eine Denkschrift ein, worin noch einmal in aller Schärfe der seit Jahren von Frankreich vertretene Standpunkt dargelegt wurde. Zunächst wurde bemerkt, daß zwischen Teil 5 des Versailler Vertrages und Artikel 8 der Völkerbundssatzung keinerlei Zusammenhänge bestünden. Deutschland habe nicht das Recht, die Abrüstung der andern zu verlangen. Mit dieser kühnen These verneinte Frankreich das Grundgesetz des Völker- [144] bundes, die Gleichberechtigung aller an ihm beteiligten Nationen. Außerdem, so argumentierte man weiter, müßte Frankreich selbst genügend gerüstet bleiben, um sich im Falle eines Angriffs solange verteidigen zu können, bis der Völkerbund einschreite. Die "geographische Lage" und die "offenen Grenzen" gestatteten Frankreich nicht, seine Truppenzahl tatsächlich zu verringern. Dreimal im Laufe eines Jahrhunderts hätten feindliche Heere auf französischem Boden gestanden. In der Tat habe Frankreich doch schon abgerüstet, indem es die dreijährige Dienstzeit durch die einjährige ersetzt habe. (Praktisch sah die Abrüstung aber so aus: 1913 bei dreijähriger Dienstzeit 674 000 Mann, 1931 bei einjähriger Dienstzeit 578 000 Mann. Rüstungsausgaben nach dem Stande der Währung von 1931: 1913 – 9 Milliarden, 1927 – 9,2 Milliarden, 1930 – 15,8 Milliarden, 1931 – 19,7 Milliarden.) Die französischen Richtlinien für die bevorstehende Abrüstungskonferenz waren also, gemäß der Forderung: erst Sicherheit, dann Abrüstung, folgende:
1. Jeder Staat muß genügend bewaffnet bleiben, um noch vor Zugreifen des Völkerbundes gegen einen unprovozierten Angriff sich schützen zu können. 2. Die Rüstungen dürfen nicht unter die für die nationale Sicherheit notwendige Grenze herabgesetzt werden. 3. Keine Nivellierung oder automatische Gleichstellung der Rüstungen aller Staaten. 4. Schärfste Einhaltung des 5. Teiles des Versailler Vertrages, der für die vier Staaten Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien bestimmte Rüstungsverbote für alle Zukunft festlegte. 5. Alle Beschlüsse der Abrüstungskonferenz müssen auf der uneingeschränkten Anerkennung der internationalen Verträge aufgebaut sein. 6. Die Abrüstungskonferenz muß ein politisches System der Sicherheit schaffen, in dem sich die Staaten gegenseitig sofortige und wirksame Unterstützung garantieren. In Genf war man bestürzt. Man empfand die Denkschrift als einen außerordentlich schroffen Schlag gegen den ganzen Abrüstungsgedanken. Die Denkschrift war eine verschärfte Auflage des Genfer Protokolls von 1924 und des Abrüstungskonventionsentwurfs von 1930. Wie eine gewaltige Drohung hatte Frankreich sein hartes Nein aufgerichtet, eine Drohung [145] auch für die bevorstehende Londoner Konferenz, um zu verhindern, daß dort über Abrüstung gesprochen wurde. In Amerika ließ man alle Hoffnung sinken. Die Abrüstungskonferenz werde unter diesen Umständen zum Scheitern verurteilt sein. Man empfand die Denkschrift als einen schweren Schlag gegen Hoovers Politik. Doch der Präsident wollte nicht von seiner Forderung weichen: erst abrüsten, dann Schuldenrevision. Die englischen Times klagten, daß doch nun endlich die Kriegsmentalität zwischen Frankreich und Deutschland verschwinden müsse. In Deutschland aber forderte man unbeirrt Gleichberechtigung und Rüstungsgleichheit, und diese Forderung fand in Amerika, England und Italien großen Beifall. Frankreich arbeitete inzwischen fieberhaft an der Erweiterung seines Systems der Sicherheitsbündnisse gegen Deutschland. Wie der Krake auf dem Grund des Meeres seine acht schrecklichen Arme um sein unglückliches Opfer schlingt, um es auszusaugen und zu zermalmen, so umspannte Frankreichs vernichtende Sicherheitspolitik das wehrlose Deutschland. An der Donau hatte es seine Hand im Spiele, und nun vor allem arbeitete es in Moskau an einem französisch-russischen Nichtangriffsvertrag und brachte ihn zu einem vorläufigen Abschluß. Brüssel, Paris, Prag, Warschau, Moskau waren jetzt zu einem großen, konzentrischen "Sicherheitsring" gegen Deutschland zusammengeschlossen. Gleichsam als Auftakt zur Herbsttagung des Völkerbundes hielt der ehemalige Ministerpräsident und nachmalige Marineminister Leygues eine hochtönende Rede in Frankreich: die Abrüstungskonferenz sei in der geplanten Form ein Abenteuer und könne so nicht stattfinden. Sie könne nicht den Frieden festigen, und man könne sich glücklich schätzen, wenn sie ihn nicht kompromittiere. Frankreich müsse unbedingt auf dem Boden seiner Denkschrift verharren. Nichtsdestoweniger eröffnete der italienische Außenminister Grandi in der Vollversammlung des Völkerbundes am 8. September 1931 den Vorstoß gegen die französische Auffassung. Im Auftrage der Regierung Mussolinis hielt er eine große Rede, worin er forderte "unverzüglich einen wirksamen und wahrhaften Stillstand der Rüstungen, wenigstens während der [146] Dauer der Abrüstungskonferenz". Dies "würde den Völkern ein erstes Beispiel des guten Willens der Regierungen zeigen und würde anderseits für die Abrüstungskonferenz eine ehrliche und vertrauensvolle politische und psychologische Atmosphäre schaffen". Wenn der Völkerbundspakt seine wahre Bedeutung weiter behalten solle, so müßten die sich aus ihm ergebenden Verpflichtungen, die friedliche Regelung internationaler Streitigkeiten, die Abrüstung und die Sicherheit gewissenhaft eingehalten werden. Der Verzicht auf Gewalt und die Herabsetzung der militärischen Streitkräfte auf ein Mindestmaß seien die dringlichsten Forderungen der Gegenwart. Wenn in den internationalen Beziehungen die Möglichkeit von Gewaltlösungen nicht mehr bestehe, so habe damit auch das Problem der Sicherheit aufgehört zu bestehen. Es müsse festgestellt werden, daß der Völkerbundspakt den Völkern die Verpflichtung zur Abrüstung auferlege. Diese Worte wurden mit großem Beifall der Versammlung und der Presse der abrüstungsfreundlichen Länder aufgenommen. Nur Frankreichs Presse protestierte; erst Sicherheit, dann Abrüstung! Am 10. September äußerte sich der Vertreter Englands, Lord Robert Cecil, zu dem Problem. Die englische Regierung werde eine Vertagung der Konferenz nicht um einen Tag zulassen. Sie müsse ein Erfolg werden, jeder andre Ausgang sei undenkbar. Wenn auch Cecil infolge der englischen Finanzschwierigkeiten Rücksicht auf Frankreich nehmen mußte, so erklärte er zum ersten Male vor der Völkerbundsversammlung Englands Überzeugung, daß eine Revision der Friedensverträge nötig sei. Vorsichtig aber ergänzte er: es sei noch nicht die Zeit dazu. Briand, der hinterher sprach, erwähnte mit keiner Silbe die Abrüstungsforderungen Grandis und Cecils. Dann, am 12. September, kam Curtius zu Worte.
"Wenn jetzt endlich die Abrüstungskonferenz zusammentritt", sagte er, "so kann von den Deutschen dort nicht verlangt werden, daß sie sich mit einer Legalisierung der gegenwärtigen Rüstungsverhältnisse abfinden. Es muß für alle die gleiche Methode bei der [147] Herabsetzung oder Beschränkung der einzelnen Rüstungsfaktoren gelten." Das war denn doch zuviel! Briand und seine Delegation erklärten voll Zorn, durch diese deutsche Rede sei das Schicksal der Abrüstungskonferenz auf das ernsthafteste in Frage gestellt, da eine Überbrückung des deutsch-französischen Gegensatzes in der Abrüstungsfrage nun nicht mehr möglich sei. Ja, die Rede könne sogar sehr ernstlich auch die deutsch-französischen Annäherungsversuche gefährden. Der Matin schrieb: Curtius habe sich wie der Vertreter eines Landes benommen, das die Mittel in Händen habe, seine Politik selbständig festzulegen und das keine seiner Forderungen aufzugeben brauche. Sein Ton sei nicht so, wie ihn ein Reichsminister in der augenblicklichen Lage Deutschlands anwenden dürfe. Immerhin hatte der italienische Vorstoß, von Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland und der Schweiz unterstützt, einen gewissen Erfolg. Die Völkerbundsversammlung nahm einen, wenn auch stark verwässerten italienischen Antrag an, der ein Rüstungsfeierjahr forderte. Die Völker sollten vom 1. November 1931 bis 31. Oktober 1932 ihre Rüstungen nicht erhöhen. Es war ein Kompromiß der direkten mit der indirekten Rüstungsbeschränkung: die See- und Luftstreitkräfte sollten nicht durch Neubauten vermehrt werden, während für die Landheere eine Erhöhung des Heereshaushalts für laufende Etatsjahr ausgeschlossen sein sollte. Die Gemüter erhitzten sich doch sehr an dieser Frage, und wie es im Leben des einzelnen zu gehen pflegt, so ist es auch im Leben der Völker und Staaten: derjenige, der ein schlechtes Gewissen hat, schreit am lautesten. Es war ganz selbstverständlich, daß der östliche Trabant Frankreichs, die polnische Regierung, im Oktober dem Völkerbund eine Abrüstungsdenkschrift einreichte, die in jeder Beziehung dem französischen Memorandum ebenbürtig war. Nur dann könne Polen die Rüstungen herabsetzen, hieß es darin, wenn gleichzeitig ein neues System der Sicherheit geschaffen werde und die Gewähr geboten würde, daß die in den internationalen Verträgen den besiegten Staaten auferlegten Entwaffnungs- [148] bestimmungen nicht verletzt würden. Die polnische Regierung müsse das Gleichgewicht der militärischen Kräfte in Osteuropa fordern und insbesondere die Beseitigung gewisser militärischer Organisationen – gemeint war der Stahlhelm und die S.A. –, die unvereinbar seien mit einem allgemeinen System der Abrüstung. Der Völkerbund war arg verstimmt über die ungewöhnliche Schärfe, mit der die polnische Regierung Aufrechterhaltung der Versailler Entwaffnungsbestimmungen forderte. Die Aussichten für die Abrüstungskonferenz wurden recht ungünstig beurteilt. Und das war wohl der Grund, weshalb die angelsächsischen Staaten jetzt etwas zurückhaltender wurden. Als Laval in Amerika weilte und mit Hoover verhandelte, war wohl der Senator Borah der einzige, der an dem schroffen, antifranzösischen Standpunkt wegen Versailler Vertrag, Abrüstung und Weichselkorridor festhielt. Bei der Besprechung zwischen Laval und Hoover blieb die französische Abrüstungsthese vorsichtigerweise unberührt. Laval lehnte es rundweg ab, irgendwelche Zugeständnisse in Aussicht zu stellen, nachdem Hoover erklärt hatte, die sehr weitgehenden Sicherheitsforderungen seien unannehmbar für Amerika. Auch in England hatte man nur noch wenig Vertrauen. Man hätte es doch lieber gesehen, wenn vor dem Beginn der Abrüstungskonferenz zwischen Deutschland und Frankreich eine gewisse Einigung zustande kommen würde. In Regierungskreisen dachte man gar daran, die nahe heranrückende Konferenz doch noch zu vertagen.
Im Oktober und November veröffentlichte Mussolini in amerikanischen und englischen Zeitungen eine Abhandlung, worin er die Notwendigkeit eines zehnjährigen Abkommens zur Aufrechterhaltung des Friedens in Europa forderte.
"Die Abrüstungskonferenz, die auf den 2. Februar 1932 anberaumt [149] ist, ist von der denkbar größten Wichtigkeit. Es geht dabei nicht nur um das Dasein des Völkerbundes, sondern um das Schicksal der menschlichen Rasse. Ein tiefgefühlter Wunsch nach Erfolg muß sich hierbei mit einem aufrichtigen und zielbewußten Willen verbinden, auf daß die Abrüstungskonferenz nicht mißlinge: denn ihr Mißlingen könnte als der Auftakt zur Katastrophe aufgefaßt werden." Eindringlicher konnte es nicht gesagt werden. Grandi selbst weilte Mitte November bei Hoover und stellte dessen freundschaftliche Zustimmung in der Abrüstungsfrage fest. Indessen türmten sich doch Ende des Jahres solche Schwierigkeiten auf, daß man auch in Italien hin und wieder zweifelhaft wurde und eine Vertagung der Konferenz befürworten zu müssen glaubte.
Die Mehrheit des deutschen Volkes stand hinter dem General. Von den Nationalsozialisten bis zur Staatspartei war man darin einig, daß die andern abrüsten müßten, daß der scheinheilige Konventionsentwurf nie und nimmer von Deutschland als Verhandlungsgrundlage anerkannt werden konnte, daß man mit Entschlossenheit den maßlosen, ungerechtfertigten und gewalttätigen Widerständen Frankreichs begegnen mußte. Es bildete sich ein Arbeitsausschuß deutscher Verbände auf breiter Grundlage, der öffentlich mit gewaltigen Abrüstungskundgebungen auftrat. Ja, der "Stahlhelm" schloß sich mit den Frontsoldatenbünden Österreichs, Ungarns, Bulgariens Mitte [150] Dezember 1931 in Budapest zu einem großen mittelmächtlichen Block zusammen, dessen Aufgabe es war, auch in der Abrüstungsfrage einheitlich vorzugehen mit der Alternative: entweder Abrüstung der andern oder Wiederherstellung der allgemeinen Wehrpflicht in den europäischen Mittelmächten.
Die französische Presse fand diese Vorgänge ganz in der Ordnung. Wie kamen der franzosenfeindliche Amerikaner Houghton, der Elsässer Joos und der italienische Militarist Scialoja in Paris dazu, von Frankreich Abrüstung zu fordern? Ähnliche Vorgänge ereigneten sich kurz vor Weihnachten in Toulouse. Dort fand eine pazifistische Versammlung statt, in der auch eine Deutsche, Frau Frieda Perlen aus Stuttgart, sprach. Eine Gruppe der Action Française sprengte die Versammlung. Diese Vorgänge zeigten doch, wie sehr die öffentliche Meinung Frankreichs der Abrüstungskonferenz widerstand. Und dieser Umstand ließ die Engländer und Italiener die ganze Hoffnungslosigkeit der Lage erkennen, so daß sie einer Vertagung geneigt waren. Aber hiervon wollte die deutsche Regierung absolut nichts wissen. Schweren Herzens bereitete Henderson mit dem Generalsekretär des Völkerbundes, Drummond, Ende des Jahres die Konferenz vor, zu der 64 Regierungen eingeladen wurden. Besonders wichtig war die Bestimmung, daß nur die Beschlüsse, die einstimmig gefaßt wurden, gültig sein sollten. Man wollte Frankreich gegenüber jeden Schein des Zwanges vermeiden. In der zweiten Hälfte des Januar 1932 flammte der deutsch- [152] französische Abrüstungsstreit mit erneuter Heftigkeit auf. Vor der französischen Kammer erklärte Laval, alle Parteien in Frankreich hätten immer wieder betont, daß der Erfolg der Abrüstungskonferenz nur dann gesichert sei, wenn sie in einem engumgrenzten Rahmen stattfinde. Dieser Rahmen müsse sein: Achtung vor den Verträgen, Schiedsgerichtsbarkeit, Feststellung des Angreifers, gegenseitige Unterstützung bzw. Sicherheit. Es sei falsch, wenn man von Frankreich Schwäche als Nachgiebigkeit erwarte. Die übergroße Mehrheit des französischen Volkes war von dieser Rede begeistert. Als Laval das Parlamentsgebäude verließ, umdrängten ihn Abertausende in hellem Jubel. Laval mußte Polizeischutz in Anspruch nehmen, da er von den Begeisterten allzusehr bedrängt wurde. In der französischen Presse wurde ein großer Lügenfeldzug über deutsche Gegenrüstungen organisiert. Senator Eccard und General Bourgeois fabrizierten die Berichte. Paul Boncour setzte sich im Journal eifrig für das Genfer Protokoll von 1924, für den Konventionsentwurf von 1930 und für das Julimemorandum von 1931 ein:
"Die französische Regierung hat sehr richtig gehandelt, als sie in ihrer Note vom 15. Juli 1931 noch einmal ihrer Überzeugung Ausdruck gab, daß der Erfolg einer ins Gewicht fallenden Herabsetzung der Rüstungen nur dann erzielt werden kann, wenn in einschneidender Umstellung zu der politischen Seite des Problems der Begriff der gemeinsamen Aktion an die Stelle der individuellen Verteidigung und die Idee der internationalen Armee bzw. der Garantie für eine gegenseitige Unterstützung an die Stelle der nationalen Rüstungen tritt. Hierfür muß die französische Delegation in Genf so präzise Vorschläge machen, daß diese unbedingt diskutiert werden müssen und die für den Ablauf der Konferenz notwendige fundamentale Umänderung der politischen Atmosphäre herbeigeführt wird. Frankreich hat das Wort!"
"Wir verlangen Gleichberechtigung! Wir verlangen für alle die gleichen Methoden der Abrüstung und den gleichen Grad der Sicherheit. Zwischen hochgerüsteten Völkern liegen die Nationen, die nach den Bestimmungen der Friedensverträge abgerüstet sind und dadurch jede Sicherheit verloren haben. Dieser Zustand ist es, der die Welt nicht zur Ruhe kommen läßt. Ich kann mit Freude feststellen, daß Deutschland mit den italienischen Auffassungen über die Abrüstung weitgehend übereinstimmt. Wir danken Italien besonders, daß es den Grundsatz der Gleichberechtigung laut verkündet hat. Ich hoffe, daß Italien und Deutschland zu einem erfolgreichen Verlauf der Konferenz zusammenarbeiten können, denn sie sind sich einig in dem Gedanken, daß eine wirkliche und radikale Abrüstung notwendig ist." Doch von Paris tönte Lavals hartes Echo: Nein! Frankreich bleibe bei seiner bisherigen Haltung in der Abrüstungsfrage. Am Vorabend der Konferenz wurde in Paris das Programm entworfen: Der politische Ausschuß oder ein Sonderausschuß der Abrüstungskonferenz solle ein neues allgemeines Sicherheitsprogramm auf der Grundlage des 1924 gescheiterten Genfer Protokolls als Voraussetzung für die Annahme der Rüstungsherabsetzung durch Frankreich ausarbeiten. Die Hauptaussprache solle Ende März auf einen Monat bis nach den deutschen und französischen Parlamentswahlen vertagt werden. Nach der Pause sollen dann die drei großen Ausschüsse für Land-, See- und Luftabrüstung mit ihren Arbeiten beginnen. Am gleichen Vorabend der Konferenz hielt William Templer, Erzbischof von York und Zweiter Geistlicher des eng- [154] lischen Königreiches, in Genf von der Kanzel herab eine große politische Predigt: Henderson, Lord Cecil und zahlreiche Mitglieder einzelner Abordnungen befanden sich in der Kirche. Der Erzbischof verlas die berühmte Mantelnote der alliierten Mächte auf die Versailler Konferenz von 1919, wies auf die bindende Verpflichtung zur Abrüstung hin und betonte die Gleichberechtigung Deutschlands. Er wandte sich scharf gegen die Kriegsschuldklausel, sie müßte jetzt ausgelöscht werden. Die Schuld am Kriege treffe nicht eine einzelne Macht, nicht denjenigen Staat, der das Feuer in den Zündstoff geworfen habe, sondern diejenigen, die den Zündstoff zusammengetragen hätten. Und zwei Tage später, am 2. Februar, veranstaltete die englische Kirche in der riesigen Albert Hall zu London eine gewaltige Abrüstungskundgebung. Der Erzbischof von Canterbury, der nach der englischen Verfassung nächst dem König der oberste Diener des Staates ist, wies auf die Versprechungen hin, die Deutschland in Versailles hinsichtlich der Abrüstung gemacht worden seien. "Die Ehre verpflichtet uns, die heiligen, in Versailles übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, wonach die erzwungene Abrüstung Deutschlands der erste Schritt für eine Abrüstung der ganzen Welt sein sollte." Der Erzbischof von York unterstützte kräftig die Rede des obersten englischen Kirchenfürsten. Und am gleichen Vorabend der Konferenz stellte Italien den begonnenen Bau der geplanten Befestigungen an der Straße von Bonifat, zwischen Sardinien und Korsika, ein, um vor der Abrüstungskonferenz ein Beispiel von militärischen Verzichten zu geben.
Es war eine glänzende Versammlung von tausend Menschen, die unter den Völkern der Erde an hohen und höchsten Plätzen standen: 5 Ministerpräsidenten, 24 Außenminister, 28 Generale, 15 Admirale, über 800 Generalstabs- und Admiralstabsoffiziere, Militärattachés, zahlreiche hohe Beamte der Außenministerien waren anwesend. Alle Sprachen der Welt schwirrten durcheinander, wie seinerzeit beim Turmbau zu Babel. Prunkuniformen aller Länder strahlten in der Menge. Es schien, als gebe es keine Feindschaft mehr auf der Welt, da Freund und Feind so einträchtig beieinander saßen. Und dennoch lastete auf der Versammlung eine dumpfe Atmosphäre voller Spannungen, voll Mißtrauen und voll Pessimismus. Hier wurden Gegensätze zusammengezwungen, die nicht zusammenkommen konnten, es sei denn, daß die Welt zerbrach. Die Abgesandten der Welt rüsteten sich zu einem der elementarsten Kämpfe seit Jahrtausenden, dem Kampfe zwischen dem Willen zur Macht und dem Willen zum Recht. Energien prallten aufeinander von urwüchsiger Wucht. Und im Mittelpunkt dieses Weltkampfes stand der Gegensatz Deutschland–Frankreich. Mit unheimlichem Fanatismus knüpfte Frankreich sein Fangnetz. Gerade in diesen Tagen hatte es ein geheimes Abkommen mit Japan getroffen. Es ließ den Japanern freie Hand im mandschurischen Konflikt gegen China, unterstützte sie mit Geld und Waffen, dafür sollte Japan auf der Konferenz die französische These: erst Sicherheit, dann Abrüstung, vertreten. Das war ein Schlag gegen Deutschland und England zugleich, denn England hatte kein Interesse, daß Japan in China stark wurde. In Amerika erhob Senator Borah abermals seine grollende Stimme. Die bisher bekanntgewordenen Vorschläge und Anträge zur Konferenz gingen alle um den Kern herum. Der sei doch, eine wirkliche und für alle Länder gleiche Abrüstung unter internationaler Kontrolle zu schaffen. Ein Fehlschlagen der Konferenz würde eine völlige Abkehr Amerikas von den [156] europäischen Vorgängen zur Folge haben. Senator Johnson machte den Erfolg der Konferenz von zwei Voraussetzungen abhängig: von der ungesäumten Liquidierung des japanischen Vorgehens gegen China und von der Anerkenntnis der Gleichberechtigung Deutschlands in der Abrüstungsfrage. In Deutschland veranstaltete die Studentenschaft, der Stahlhelm große Kundgebungen. Die Kriegervereine des Kyffhäuserbundes hatten vom August 1931 bis Januar 1932 12 Millionen Unterschriften für die Abrüstung gesammelt. Der Stahlhelm, der Kyffhäuserbund, der Reichsoffiziersbund, der deutsche Offiziersbund, der Nationalverband deutscher Offiziere, die Frontkämpfervereinigung Österreichs, Ungarns und Bulgariens sandten Telegramme nach Genf, worin sie verlangten, daß die die Wehrhoheit der Mittelmächte beschränkenden Vertragsbestimmungen aufgehoben würden. Am 3. Februar eröffnete der Präsident Henderson, der im Herbst 1931 zurückgetretene englische Außenminister, die Konferenz. Seine Rede hatte er vorher dem Generalsekretär Drummond vorgelegt. Der hatte gegen verschiedene scharfe Formulierungen protestiert, so daß Henderson umfangreiche Stellen streichen mußte. Er wies auf die Abrüstungsverpflichtung hin.
"Gegenwärtig kann es nur eine Gleichheit der Rechte für jede Nation in der von uns gebauten freien Gesellschaft der Völker geben. Es kann nur die Brüderlichkeit aller Völker geben, die in Zukunft nicht mehr Feinde, sondern treue Freunde sein werden. Es kann nur jetzt die Freiheit für jedes Volk geben, sein Leben ohne Furcht vor Ungleichheit, vor Bedrückung oder Krieg leben zu können. Laßt uns die große, uns auferlegte Aufgabe in Angriff nehmen, laßt uns Entscheidungen fällen und die Nationen den ersehnten Höhen entgegenführen." Daran glaubten zwar nur die wenigsten, und so kam es, daß die Rede Hendersons recht kühl aufgenommen wurde.
Diese Note war erfüllt von dem rücksichtslosen Militäregoismus Frankreichs und von seinem Bestreben, den Völkerbund für Vorspanndienste zu benutzen. Der erste Teil forderte zunächst Internationalisierung der Zivilluftfahrt. So wollte man die Zivilluftfahrt Deutschlands, das keine Kriegsluftfahrzeuge haben durfte, unter eine internationale Kontrolle stellen, daß sie nicht für kriegerische Zwecke verwendet wurde. Ferner sollten Militärflugzeuge von mittlerer, noch festzusetzender Tonnage, zur Verfügung nur derjenigen Staaten bleiben, die sich verpflichten, sie dem Völkerbund im Falle eines gemeinsamen Vorgehens zur Verfügung zu stellen. Diejenigen Staaten, die Opfer eines Flugangriffes seien, sollten im Angriffsfalle unverzüglich von ihren Verpflichtungen befreit werden. Im zweiten Teil wurde gefordert, daß die schwere Artillerie und Linienschiffe von mehr als 10 000 Tonnen und Geschützen mit mehr als 20,3 Kaliber nur noch im Besitze derjenigen Staaten sein dürften, die gegenüber dem Völkerbund Verpflichtungen aus Artikel 16 übernähmen. Das kam in erster Linie Frankreich zugute. Der dritte Teil befürwortete Schaffung einer internationalen Polizei zur Verhütung des Krieges sowie Schaffung einer besonderen Streitmacht, die einem angegriffenen Staate unverzüglich zur Hilfe kommen müsse. Die internationale Polizeimacht müsse ständig zur Verfügung des Völkerbundes sein, der auch das Kommando über sie bestimme. Dieser Polizeimacht stehe das freie Durchzugsrecht zu und sie dürfe schon in Krisenzeiten die Gebiete besetzen, in denen ein Konflikt auszubrechen drohe! Der letzte Teil befaßte sich mit der Organisation des Friedens. Eine allgemeine Verpflichtung zur Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Kontrolle der Rüstungen aller Staaten, unbedingte Aufrechterhaltung der Entwaffnungsbestimmungen über Deutschland und weitgehende gegenseitige Sicherheitsverpflichtungen der Staaten zur Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Lage seien notwendig. Es ließ sich kein listigerer und schlauerer Vorschlag denken, [158] wie Frankreich seine Politik durch den Völkerbund zu sanktionieren versuchte. Was das Genfer Protokoll von 1924, der Konventionsentwurf von 1930 und das Julimemorandum von 1931 gefordert hatten, all das kehrte hier wieder, übersteigert in diplomatischer Spitzfindigkeit. In England war man ungehalten. Hoover erklärte den Vorschlag für unannehmbar. Senator Borah bezeichnete ihn als das logische Erzeugnis des Versailler Vertrages und der anderen Friedensverträge, als einen Versuch, Europa in eine Zwangsjacke zu stecken. Der Popolo d' Italia höhnte, es sei ein schöner Kohl, womit Frankreich seine Vorherrschaft in Europa befestigen und die Konferenz torpedieren wolle. Der Neuyorker American bezeichnete den Vorschlag geradezu als eine Beleidigung der Abrüstungskonferenz, als einen jener schlauen Kniffe Tardieus, womit er andere Staaten einzuseifen pflege. Mit solchen Hintergedanken verscherze sich Frankreich das Recht, am Konferenztische zu sitzen. Die Teilnehmer der Konferenz faßten Tardieus Note als ein Ultimatum auf, sich Frankreichs Sicherheitsforderungen zu fügen oder die Konferenz zusammenbrechen zu lassen. Aber sie waren nicht willens, die Angelegenheit nach Frankreichs Wunsch als Sache des Völkerbundes zu behandeln, waren doch sehr maßgebende Staaten beteiligt, die keine Mitglieder des Völkerbundes waren.
"Ich erkläre hiermit, daß Deutschland als vollberechtigtes und vollverpflichtetes Mitglied des Völkerbundes vor dieser hohen Versammlung mit allem Nachdruck eintreten wird für eine allgemeine Abrüstung, für eine Abrüstung unmißverständlicher Art, wie sie im Völkerbundspakt für alle Mitglieder in gleicher Weise vorgesehen ist, eine allgemeine Abrüstung, die für alle Völker nach denselben Grundsätzen durchgeführt wird und für alle Völker ein gleiches Maß von Sicherheit schafft. Deutschland wird im Geiste weitgehender Solidarität und Verständigungsbereitschaft, aber auch unbeirrter Energie, diesem Ziele zustreben. Es bietet allen Völkern, die auf dieser hohen Versammlung vertreten sind, ehrlich seine Hand zur gemeinsamen Arbeit an diesem gemeinsamen Werke." Langer Beifall folgte den Worten des Kanzlers. In Deutschland, England und Amerika war man erstaunt über Brünings maßvolle Ruhe, und die Franzosen waren befriedigt.
"Wollen Sie von uns hier verlangen, daß wir durch einen frei einzugehenden Vertrag trotz des seinerzeit uns feierlich gegebenen Versprechens und trotz der bestehenden Gleichberechtigung aller Mitgliedstaaten des Völkerbundes alle Ungleichheit an Recht und Sicherheit aufrecht erhalten sollen, die Sie für sich selbst ablehnen würden? In dem ersten Abkommen über die Beschränkung und Begrenzung der Rüstungen, das von Österreich als vollkommen gleichberechtigten Partner unterzeichnet war, können wir den ersten Schritt zur Herstellung des organisierten Friedens in einer neuen Welt erblicken. Diesen ersten Schritt treten wir hier an!" Bei den weiteren Regierungserklärungen zeigte sich die Tschechoslowakei als Frankreichs treuer Vasall, während Dänemark den deutsch-italienischen Standpunkt vertrat und Spanien sich der Auffassung der angelsächsischen Mächte näherte. – Diese zweiundeinehalbe Woche dauernde Aussprache war der Auftakt der großen Abrüstungskonferenz. Drei Fronten standen hier gerüstet: Deutschland, Italien, Rußland, Österreich, Bulgarien, Ungarn, gefolgt von einer Schar Neutraler, war die eine. Frankreich, Japan, Polen, Tschechoslowakei und andere Trabanten war die zweite. Die dritte, mehr vermittelnd, stellten die angelsächsischen Großmächte, gefolgt von Spanien, dar, wobei sich allerdings schon ein Hinneigen Englands zu Frankreich erkennen ließ. Immerhin ging das, was die Mehrheit der Staaten forderte, weit über den Konventionsentwurf von 1930 hinaus. Jedoch Deutschlands Lage war nicht besonders günstig. Die Reichsregierung hatte den "psychologischen Augenblick" verpaßt. Statt daß Brüning der Versammlung, die darauf wartete, die konkreten deutschen Abrüstungsvorschläge unterbreitete, geschah dies erst über eine Woche später. Am 18. Februar überreichte der deutsche Führer der Abrüstungsdelegation, Botschafter Nadolny, die deutschen Vorschläge.
Als Nadolny die deutschen Vorschläge in französischer Sprache vor die Vollversammlung brachte, war kaum die Hälfte der Delegierten anwesend. Das Interesse war erheblich erlahmt, zahlreiche Delegierte waren bereits abgereist. Nadolny erntete nur einen außerordentlich dünnen Beifall. Allerdings stellte man fest, daß die deutschen Vorschläge sachliche Schärfe mit maßvoller Form verbanden. Die Konferenz hatte nun neben dem Konventionsentwurf und den französischen, amerikanischen, italienischen, russischen Vorschlägen auch noch den deutschen Vorschlag zu behandeln. Italiener und Engländer waren einverstanden, bis auf die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und der Grenzfestungen. Paul Boncour, der Führer der Franzosen, erklärte, die Vorschläge seien völlig unannehmbar für Frankreich, besonders, da die deutsche Regierung den von England und Amerika bereits grundsätzlich angenommenen Konventionsentwurf des Völkerbundes als Verhandlungsgrundlage ablehne. Frankreich, Belgien, Polen, Finnland und die kleine Entente beschlossen als Gegenvorstoß einen gemeinsamen An- [164] trag einzubringen, der im schroffen Gegensatz zu Deutschland als Hauptpunkt Überwachung der Herabsetzung der Heeresausgaben für alle Staaten fordern sollte.
Die deutsche Delegation hatte sich also bereit erklärt, den Konventionsentwurf als Rahmen für die Besprechungen zuzulassen. Sie fügte sich der Mehrheit der Konferenz, die beschloß, die Abrüstungsvorschläge aller Delegationen mit dem Konventionsentwurf zusammen zu besprechen. Das war ein Zurückweichen. Monatelang hatte die deutsche Regierung den Konventionsentwurf aufs schärfste bekämpft, weil er Deutschlands Gleichberechtigung nicht anerkannte und Frankreichs Sicherheit in den Vordergrund stellte, und jetzt plötzlich stimmte man der Einsetzung eines politischen Ausschusses, wie ihn Tardieu aus dem Konventionsentwurf her forderte, zu. An diesem 25. Februar 1932 war in Genf eine schwere Entscheidung gegen Deutschland, zu Frankreichs Gunsten, gefallen. Jetzt hatte Frankreich freie Bahn, als Vorbedingung für alle Abrüstungsforderungen politische Sicherheitsbürgschaften zu verlangen, die natürlich darauf hinzielten, den in Versailles geschaffenen Zustand nicht anzutasten. Tardieu war zufrieden. [165] Er hatte mit größerem deutschen Widerstand gerechnet. Monatelang hatte die Welt in Ängsten geschwebt, was da werden solle, wenn Deutschland fest auf seinem Standpunkte verharrte. Deutschland selbst löste das Problem, indem es großmütig wieder einmal seinen "guten Willen" bewies. Damit versöhnte Deutschland die angelsächsische und französische Gruppe miteinander, aber nicht die deutsche mit den andern. Der Pariser Populaire schrieb: "In wenigen Stunden hat die Konferenz sich selbst verurteilt. Der Abrüstungsgedanke ist fallen gelassen worden." Der Reichskanzler Brüning hatte den großen, hoffnungsvollen Kampf für Deutschland verloren, ehe er in sein entscheidendes Stadium trat. Das System der demokratischen Kompromisse hatte wieder einmal einen Triumph der Selbstverneinung gefeiert! – In den Einzelausschüssen gingen nun die Arbeiten der Konferenz mit der üblichen Verschleppungsmethode langsam weiter. Am energischsten drang noch der amerikanische Botschafter auf endliche Herbeiführung positiver Ergebnisse. Am 18. März vertagte sich die Konferenz bis zum 11. April. Der erste, siebenwöchige Abschnitt hatte keine praktischen Ergebnisse gebracht, sondern nur eine Stellung der Mächte zu den Abrüstungsfragen und den grundsätzlichen Fragen. Gibson verlangte noch, daß die Konferenz sogleich am 11. April beginnen sollte, ohne weitere Unterbrechung in fortlaufender Sitzung die Hauptfragen zu behandeln: Gleichberechtigung, vollständige Abrüstung oder lediglich Herabsetzung der Rüstungen, und die französischen Sicherheitsvorschläge. Er sagte: jetzt nun sei die Entscheidung über die Hauptfrage der Abrüstung unvermeidlich geworden. Nach menschlichem Ermessen konnte es kein Zurück mehr geben. – Plötzlich trat ein neues französisches Ränkespiel gegen Deutschland in die Erscheinung. Frankreich war aufs eifrigste bemüht, die Donaustaaten, insbesondere Österreich und Ungarn, in seine Gewalt zu bekommen. Seit Jahren befanden sich Österreich, Ungarn, Bulgarien, Südslawien, Rumänien in schweren wirtschaftlichen Nöten. Den Agrarstaaten fehlte die Möglichkeit, ihre landwirtschaftlichen Überschüsse zu verwerten, während die meisten Industrieerzeugnisse eingeführt wer- [166] den mußten. Dieser Zustand hatte Österreich besonders hart betroffen. Es stand vor dem wirtschaftlichen Ruin. Um ihm zu Hilfe zu kommen, hatte die deutsche Regierung Brüning-Curtius im Frühjahr 1931 den Plan einer Zollunion entwickelt. Das Projekt wurde durch Frankreich zu Fall gebracht durch einen Großangriff auf die österreichische und deutsche Wirtschaft.
Von Paris aus waren noch keinerlei direkte Verhandlungen über diesen Plan mit Wien geführt worden. An der Person des Außenministers Schober nahmen die französischen Politiker Anstoß. Er war durch das Projekt der Zollunion vorbelastet. Dennoch beunruhigten gelegentliche Zeitungsmeldungen die Bevölkerung, und die Heimwehren protestierten gegen eine neue Wirtschaftsversklavung, und der nationale Wirtschaftsblock lehnte mit aller Entschiedenheit den Donaubund ab. Ja, in Paris war man Anfang Januar 1932 auch schon so weit, den Plan fallen zu lassen. Bei seinen Bestrebungen, Österreich, Ungarn und Tschechoslowakei zu einem Dreibund zu vereinigen, begegnete Berthelot, der Direktor des Auswärtigen Amtes in Paris, heftigem Widerstande Südslawiens und Rumäniens, und er fürchtete die Einwände Deutschlands und Italiens. Am 27. Januar 1932, gerade als der frühere Bundeskanzler Streeruwitz dem deutschen Reichspräsidenten einen Besuch abstattete und im Rundfunk mahnte, Deutschland möge Öster- [167] reich nicht vergessen, trat die Regierung Buresch in Wien zurück. Die Christlichsozialen verlangten, daß die Autorität der Regierung gestärkt werde. Buresch bemühte sich um ein neues Kabinett. Er wandte sich an den nationalen Wirtschaftsblock wegen Mitbeteiligung; aber er stieß auf Ablehnung, weil aus der neuen Regierung Schober als untragbarer Außenminister verschwinden mußte. Das sei kein außenpolitischer Kurswechsel, betonte Buresch, er halte nach wie vor an seiner Ansicht fest, ein Donaubund ohne Deutschland sei unmöglich. Dies versicherte Buresch auch in seiner Regierungserklärung vor dem Nationalrat am 4. Februar, aber die Sozialdemokraten, der nationale Wirtschaftsblock und der Landbund konnten nicht umhin, Zweifel zu äußern. War doch von christlichsozialer Seite gesagt worden, Schober habe auf Wunsch verschiedener Herren in Paris aus der Regierung verschwinden müssen. Mitte Februar rief Bundeskanzler Buresch die Wiener Diplomaten zu sich und entwickelte ihnen Österreichs verzweifelte Finanzlage. Österreich brauche Erweiterung seines wirtschaftlichen Arbeitsraumes; die Regierung müsse deshalb mit allen Nachbarstaaten und allen Staaten, die dazu bereit seien, in Verhandlungen über eine wirtschaftliche Annäherung eintreten. Für Österreich komme es zunächst vor allem darauf an, die Einfuhr zu beschränken und die Ausfuhr zu heben, was jedoch nur unter Aufhebung der Meistbegünstigung zu erreichen war. Daraufhin bot die deutsche Regierung den Österreichern Anfang März an, mit ihr über Vorzugszölle zu verhandeln, "wenn die Empfehlungen des Finanzkomitees des Völkerbundsrates und die Mitwirkung der andern Staaten die Möglichkeit begründen, Österreich Zugeständnisse für seine Ausfuhr unabhängig von den Folgen der Meistbegünstigung zu machen." Tardieu aber, der seit Ende Februar französischer Ministerpräsident war, stürzte sich wie ein Habicht auf sein Opfer. Er unterbreitete dem österreichischen Vertreter in Genf einen Plan, den er mit dem Engländer Simon und dem Italiener Grandi besprochen hatte, der aber der deutschen Reichsregie- [168] rung nicht mitgeteilt worden war. Deutschland sollte ausgeschaltet werden. In diesem Vorschlag war Frankreich bereit, Österreich eine Anleihe zu geben, forderte aber, daß Österreich zunächst mit Ungarn und der Tschechoslowakei, sodann auch mit Rumänien und Jugoslawien eine Zollunion eingehe. Frankreich glaubte also, daß das System der Vorzugszölle innerhalb der agrarischen Donaustaaten schon zur wirtschaftlichen Sanierung führen könne. Bulgarien fehlte unter diesen Donaustaaten. Aber alle Donaustaaten standen diesem Plane äußerst kühl gegenüber. Enthielt er doch verdächtige Reminiszenzen an die Habsburger Zeit vor 1918, wie sie von Frankreich übrigens auch seit 1931 genährt wurden. Auch die Wiener Regierung ließ in Berlin mitteilen, daß sie eine Donauföderation nur dann abschließen werde, wenn Deutschland einbezogen würde, und Deutschland erklärte seine Bereitwilligkeit, in den Wirtschaftsbund der Donaustaaten eintreten zu wollen. Tardieu erkannte, daß sein Vorstoß gescheitert war, und er ließ am 5. März 1932, etwas spät, in Berlin unter gleichzeitiger offizieller Bekanntgabe seines Planes erklären, Frankreich habe den Wunsch, daß sich Deutschland an den Arbeiten für den europäischen Südosten beteiligen möge. England verfolgte das Vorgehen Tardieus mit Mißtrauen, und Italien meinte, die Donau-Union könne doch nicht nur auf den Gedankenaustausch der fünf beteiligten Mächte gegründet werden, es müsse zugleich eine Aussprache darüber zwischen den Vertretern Frankreichs, Deutschlands, Englands und Italiens erfolgen. Und dieser Auffassung trat Mitte März auch Deutschland bei. Italien wie Deutschland waren der Ansicht, ein Donaubund ohne Beteiligung Deutschlands sei ein Unding. Macdonald war der Ansicht, zunächst überhaupt nur erst einmal die vier Mächte zu einer Konferenz zusammenzurufen. Er führte durch Lord Tyrrell, den englischen Botschafter in Paris, Franzosenfreund und Deutschenhasser, die Verhandlungen mit Tardieu und lud Ende März zu einer Viermächtekonferenz Anfang April in London ein. Das paßte dem tückischen Franzosen gar nicht, am liebsten hätte er Deutschland [169] und Italien von der Konferenz ausgeschlossen. Tardieu bereitete Macdonald Schwierigkeiten, so daß die Viermächtekonferenz zunächst um eine Woche verschoben, dann aber ganz aufgehoben wurde. Am 1. April hob die englische Regierung die Viermächtekonferenz auf und wollte lediglich eine Vorbesprechung der vier Mächte in London stattfinden lassen. Dann sollte die Zehnmächtekonferenz tagen, die vier Mächte mit den sechs Balkanstaaten zusammen. Die Viermächtebesprechung fand dann auch in der ersten Aprilwoche 1932 statt, hatte aber nur ein negatives Ergebnis. An dem harten Widerstande Deutschlands und Italiens scheiterten Tardieus Pläne. Das war immerhin ein Erfolg. Und dennoch siegte Frankreich durch seine Taktik, die es ja auch auf der Abrüstungskonferenz übte, die Lösung des ihm höchst peinlichen Problems auf unbestimmte Zeit zu vertagen. So kam die Donaufrage vorläufig zum Stillstand. In der Folgezeit bot Frankreich der österreichischen Regierung finanzielle Unterstützung an, aber unter der Bedingung des ausdrücklichen Verzichtes auf jeden Anschluß wirtschaftlicher oder politischer Art. Doch auch diese Verhandlungen kamen nicht vom Flecke. – Frankreich verfolgte unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Annäherung politische Ziele. Die Donaustaaten sollten zu einer Gemeinschaft französischer Trabanten werden. Aber das war ja nur eine Seite der französischen Bestrebungen. Sie hatte noch eine andre, unsichtbare: die Donauföderation als Sprengmittel für das Deutsche Reich zu benutzen. Das letzte Ziel aller französischen Politik seit den Tagen Ludwigs XIV. ist die Auflösung des Deutschen Reiches. Die Rheinbundpolitik Ludwigs XIV., Napoleons, Poincarés, Briands, Lavals und Tardieus war zu alle Zeiten dieselbe. Jetzt hatte sie ein neues Gesicht bekommen. Sie war eine Donaubundpolitik geworden. Infolge der Katastrophe des rheinischen Separatismus hatte Frankreich sein Augenmerk auf die Donau gerichtet. Rheinbund – Donaubund, dies oder das; der letzte Sinn war jedesmal: Zertrümmerung Deutschlands. Und wenn Tardieu sich energisch dagegen wehrte, daß Deutschland an der Donaukonföderation teilhatte, so wünschte er es ebenso sehr, daß [170] Bayern, der Donaustaat, sich daran beteiligen würde, denn dies würde den Zerfall des Reiches bedeuten. Ende Januar 1932 wurde der französische Generalkonsul in München, Graf d'Ormesson, zum Gesandten ernannt. Aufgabe dieses geschmeidigen Mannes war es, die unterirdische französische Rheinbundpolitik zu betreiben. Seine Waffe war das französische Gold. Er verfügte über unerschöpfliche Mittel, über einen Geheimfonds, womit er den ehemaligen katholischen Geistlichen Dr. Mönius, Herausgeber der Allgemeinen Rundschau, die besonders im Rheinland separatistische Politik betrieb, unterstützte. Fäden geistiger Verbindung liefen von d'Ormesson und Mönius zu dem Professor Friedrich Wilhelm Förster, einem berüchtigten Separatisten, der in Paris wohnte. Jedoch war die separatistische Bewegung in Süd- und Westdeutschland zu schwach, als daß sie eine kräftige Unterstützung für Tardieus Donaupläne gebildet hätte. Vor allem aber war das bedeutsam: Bayern war die wichtige Brücke zwischen Rheinbund und Donaubund. – Aber so war die Lage Deutschlands: seit dem Frühjahr 1931 ward es aufs ärgste bedrängt durch Frankreichs Vernichtungswillen, teils wirtschaftlich durch Verweigerung der Tributrevision, teils finanziell durch Rückziehung von Krediten, teils militärisch durch Verweigerung der Abrüstung und Forderung neuer Sicherheiten, teils politisch durch Verweigerung der Zollunion mit Österreich und durch den Plan einer neuen Donaukonföderation sowie durch die separatistischen Umtriebe in Süd- und Westdeutschland.
Am 6. Februar 1932 ließ der litauische Gouverneur Merkys plötzlich durch litauische Offiziere den Präsidenten Böttcher, welcher der deutschen Mehrheit angehörte, verhaften und im Auto nach Kowno ins Gefängnis bringen, angeblich wegen einer Reise Böttchers nach Berlin, die nach litauischer Behauptung dazu diente, Verhandlungen mit einer fremden Macht (d. h. Deutschland) gegen das Interesse Litauens zu führen. Litauisches Militär besetzte Memel und alle Bahnhöfe, begann sofort mit wildem Terror gegen das deutsche Volk. Eine mächtige Erregung ging durch Ostpreußen. In Tilsit, Königsberg und andern Städten fanden gewaltige Massenversammlungen gegen den litauischen Überfall statt. Die Reichsregierung legte beim Völkerbund sofort geharnischten Protest gegen den Rechtsbruch ein, und der Norweger Colban wurde beauftragt, mit einigen Juristen die Rechtsfrage zu klären. Während so die Zeit verschleppt wurde, drängten immer mehr Litauer ins Memelland, und in größter Schnelligkeit wurden die deutschen Beamten abgesetzt und ausgewiesen. Der litauische Außenminister Zaunius hatte inzwischen die Aufgabe, in Genf durch hartnäckigen Widerstand alle Beschlüsse zu sabotieren. Mit Protest nahm er, von Frankreich unterstützt, den Bericht Colbans, den dieser am 20. Februar vorlegte, entgegen und worin er folgendes forderte:
1. gewissenhafte Einhaltung sämtlicher internationaler Verpflichtungen für das Memelland, 2. dringende Maßnahmen zur Vermeidung jeder Verschärfung der Lage, 3. sofortige Bildung eines rechtmäßigen Direktoriums, das sich dem Landtag vorstellen und sein Vertrauen haben muß, 4. Klärung der Rechtsfrage, ob die Abberufung des Präsidenten Böttcher rechtsmäßig war oder nicht, durch den Haager Gerichtshof. Doch in Kowno selbst empfand man diesen Bericht Colbans als einen Sieg. Man hatte ja erreicht, was man wollte: durch Verweisung an den Haager Gerichtshof wurde die ganze Angelegenheit auf Monate verschleppt, und Litauen machte in- [172] zwischen mit Memel, was es wollte. Diese Verschleppung durch den Völkerbund erkannte auch der Präsident Böttcher, und so legte er, in gewisser Enttäuschung, am 23. Februar sein Amt nieder. Litauen aber höhnte den Völkerbund, indem es mit aller Energie in der Entdeutschung des Memellandes fortfuhr. Am 22. März löste der neue litauische Landespräsident Simaitis, unterstützt von seinen beiden litauischen Direktoren, den memelländischen Landtag auf. Die Neuwahlen sollten nach dem neuen litauischen Sejmwahlgesetz stattfinden, das nicht mehr die Kandidaten von politischen Parteien, sondern nur von wirtschaftlichen Organisationen gelten ließ, – denn Litauen wurde seit Herbst 1926 diktatorisch regiert. Dies sollte der Todesstoß für das Deutschtum in Memel sein. Denn jetzt setzte das litauische Gewaltregiment mit Wahlterror und Versammlungsverboten ein, und Massenausweisungen von Deutschen wurden verfügt. Bis 1. Mai 1932 sollten 600 Reichsdeutsche das Memelland verlassen, ja einige von ihnen wurden sogar verhaftet. Und dennoch brachten die Neuwahlen Anfang Mai 1932 trotz Terror einen deutschen Sieg! Das böse Beispiel Litauens wirkte auf Polen zurück. Der Stahlhelmtag in Breslau Anfang Juni 1931 hatte bereits die Polen verstimmt, und es gab daraufhin einen diplomatischen Notenwechsel zwischen Warschau und Berlin. Die stete Angst, die geraubten Gebiete Westpreußens, Posens und Oberschlesiens wieder zu verlieren, veranlaßte Polen, jede Abrüstung abzulehnen, aber ebenso energisch an der Entwaffnung Deutschlands festzuhalten und das Verbot des Stahlhelms zu fordern. Die Polen wurden um so nervöser, da in Deutschland immer lauter die Rückgabe des Weichselkorridors verlangt wurde und sogar Senator Borah in Amerika dafür eintrat. Alle Bemühungen Frankreichs um ein Ostlocarno waren fehlgeschlagen.
Und das geschah in Danzig! Infolge dieser unerhörten Drohungen ward das Volk Ostpreußens von ungeheurer Unruhe erfüllt. Der Provinzialausschuß forcierte Hilfe vom Reich, Stahlhelm und Studenten erklärten, daß sie den Kampf nicht scheuen würden für die Freiheit des ostpreußischen Landes. Aber Polen wurde nur noch ausfallender. Der polnische Schützenverband in Danzig hielt Kriegsübungen ab, Lieder wurden gesungen, worin schärfste Drohungen gegen Danzig und Ostpreußen ausgestoßen wurden. Und gleichzeitig wurden ausgesuchte polnische Truppen in der Stärke von zwei Armeekorps Ende Februar 1932 an der Grenze des deutschen Oberschlesien versammelt. In Ostpreußen ließen die Polen die Festungsanlagen Königsbergs ausspionieren. Der polnische Angriff auf Danzig wurde dadurch eröffnet, [174] daß die wirtschaftliche Autonomie der Hansestadt aufgehoben werden sollte und diese wirtschaftlich in den polnischen Staat eingegliedert werden sollte. Um diese Forderung tatkräftig zu unterstützen, erschienen am 9. März polnische Kanonenboote im Danziger Hafen. In den Straßen Danzigs nahmen während der folgenden Tage die polnischen Marinesoldaten immer mehr zu. Es war die Absicht Polens, der Freistadt die Zollverwaltung völlig zu entwinden; die Danziger Zollbeamten sollten auf Polen vereidigt und Polen unterstellt werden. Am Widerstande des Völkerbundskommissars Gravina scheiterte dieser Versuch. Um Deutschland auch von Rußland zu isolieren und zwischen beide Mächte Zwietracht zu säen, wurde von einer polnischen Organisation ein Subjekt angestiftet, das am 5. März 1932 auf den deutschen Botschaftsrat von Twardowski in Moskau einen Revolveranschlag verübte und ihn durch mehrere Schüsse verletzte. Doch die Untersuchung legte die polnischen Ränke klar zutage.
Die deutschen Regierungsstellen betrachteten die Lage in Osteuropa sehr ernst. General Groener sah sich veranlaßt, in der Osterausgabe der Königsberger Allgemeinen Zeitung Polen nachdrücklich zu warnen. Der Wehrminister versicherte, Ostpreußen sei nicht schutzlos fremden Mächten preisgegeben. Ein feindlicher Einfall in Ostpreußen, unter welchem Vorwand er auch erfolgen möge, stoße nicht auf passiven, sondern auf aktiven
Widerstand. – 
Die Persönlichkeit Hindenburgs stand bereits seit langer Zeit im gewissen Sinne im Vordergrunde des öffentlichen Interesses. Es war bestimmt sehr verhängnisvoll für den Reichspräsidenten, daß er bereits sehr früh von den bürgerlich-demo- [175] kratischen Mittelparteien in Anspruch genommen wurde. Die Mitte war angenehm enttäuscht, daß der von dem nationalen Teile des Volkes gewählte Generalfeldmarschall sich so reibungslos in den seit 1919 gewordenen Zustand einfügte. Mahraun hob bereits 1927 den greisen Hindenburg als Führer der volksnationalen Mitte auf den Schild, und drei Jahre später schlug Mahraun vor, eine Volksabstimmung über die lebenslängliche Wahl des Reichspräsidenten von Hindenburg stattfinden zu lassen. Nach dem Ausfall der Septemberwahlen 1930 in Deutschland fürchtete Mahraun nämlich, daß die radikalen Parteien einen Bürgerkrieg heraufbeschwören könnten. Die einzige Persönlichkeit, die diese Gefahr bannen könne, sei Hindenburg an der Spitze des Reiches. Hindenburg war kein Demokrat. Persönlich lehnte er die Herrschaft der Masse ab. Sie war ihm zuwider. In ihm lebte noch das Bewußtsein von Herrentreue und Mannentreue, wie sie in letzter großer ritterlicher Verklärung das Verhältnis Bismarcks zu Wilhelm I. veredelte. Das war die Atmosphäre, in welcher Hindenburg zum Manne gereift war. In ihr lebte er noch als Reichspräsident. Er hatte es mit erlebt, wie seit 1871 eine erbärmliche Parteiwirtschaft durch Mißgunst, Feindschaft und Feilschen das Reich Jahr um Jahr geschwächt hatte, und eine tiefe Abneigung gegen dieses Treiben erfüllte ihn. Hindenburg, der Aristokrat, erblickte das höchste Ideal des Herrschers darin, daß er dem Volke ein Vater, ein Beschützer sein sollte. Diese Staatsauffassung des Präsidenten wurde vertieft durch seine soldatische Vergangenheit. Der Generalfeldmarschall hatte ein in langen Jahrzehnten bis ins kleinste ausgeprägtes Gefühl für Pflichterfüllung und Treue. In seinem Herzen war er Monarchist, aber es war in seinen Augen ein schändliches Verbrechen, nachdem er einmal die Vertrauensstellung als Reichsoberhaupt erhalten hatte, der Verfassung, die er beschworen, die Treue zu brechen. Das wäre unwürdig, unadlig gewesen. Was war denn Treue, wenn sie nicht gehalten wurde? Und darin stimmten ihm alle anständigen Deutschen bei. Den Generalfeldmarschall erfüllte ein gewisses Gefühl patriarchalisch-väterlicher Güte. Als Soldat lehnte er aber das [176] Massengetriebe des Parlamentarismus ab. Er hatte ohne Zweifel auch eine gewisse diktatorische Ader. Als Mensch und als Reichspräsident mußte er eine Übereinstimmung zwischen seinem Treuegewissen und seinem, die parlamentarische Massenherrschaft ablehnenden diktatorischen Willen herbeiführen. Dies gelang ihm mit Hilfe des Diktaturartikels 48 der Weimarer Verfassung.
War auch das Ideal Hindenburgs von der Treue eines Staatsmannes ein zeitlos deutsches Ideal, im 20. Jahrhundert ebenso geachtet und erstrebt wie im 19. oder 12. Jahrhundert, so war doch der Maßstab, den der Generalfeldmarschall an die deutschen Dinge legte, zeitlich durchaus veraltet. Er hatte seine Ansichten über Parteiwesen und Parteiherrschaft in dem halben Jahrhundert von 1870 bis 1918 gebildet, und da waren [177] sie zutreffend. Es entsprach aber nicht dem Fortschritt der Entwicklung, wenn er das ganz neue, junge, erst nach 1918 entstandene Gebilde der Nationalsozialistischen Partei mit den liberal-bourgeoisen-marxistischen Interessenverbänden der vergangenen Epoche identifizierte. Er schätzte die junge Bewegung, die ihrem Wesen nach keine auf Gegensatz und Verneinung beruhende Interessenvertretung, sondern eine Großvolkbewegung war, falsch ein und widersetzte sich selbst so dem Fortschritt. Indem er selbst seine gesetzmäßige, "parteilose" Diktatur ableitete aus einem Zustand, der an sich nur als letzte Erfüllung aus der Parteiwirtschaft des 19. Jahrhunderts heraus geboren war, stellte er die Vergangenheit als Bollwerk gegen die Zukunft auf. Da nun einmal nach seinem Prinzip keine Partei in Deutschland herrschen sollte, mußte er also, seiner Auffassung nach, auch die nationalsozialistische Bewegung ausschließen. Aber noch viel verhängnisvoller war es, daß sich die herrschenden Kreise des demokratischen Systems die Auffassung des Greises zu nutze machten, und nun mit Hilfe Hindenburgs einen widerlichen Parteikampf gegen die Rechtsopposition entfesselten. Der Reichspräsident Hindenburg wurde erfüllt von einer unbezwingbaren Abneigung gegen den Nationalismus. Systematisch prägte man dem Greise ein, das Volk werde im Bürgerkrieg versinken, wenn die Nationalsozialisten regieren würden. Mit der Starrheit des Alters hielt Hindenburg an dieser These fest, und darum schien es ihm höchste Zeit, zur verfassungsmäßigen Diktatur überzugehen, als die Nationalsozialisten bei den Reichstagswahlen 1930 große Erfolge erzielt hatten. Ohne daß er es wußte und wollte, wurde der Reichspräsident als Werkzeug demokratischer Parteipolitik gegen die nationale Opposition mißbraucht. Diejenigen, welche die Verfassung von 1919 gemacht hatten, erkannten, daß diese Verfassung allein durch Hindenburg noch gerettet werden konnte, weil sie den bevorstehenden Kampf um diese Verfassung scheuten und fürchteten. Am tragischsten jedoch war es, daß Brüning das Vertrauen und die Gutgläubigkeit Hindenburgs mißbrauchte. Für Brüning war der Reichspräsident das demokratische Mittel zum [178] Zwecke der Errichtung einer Zentrumsdiktatur. Der Kanzler täuschte dem Präsidenten ein parteiloses, "überparteiliches" Regiment vor und trieb dabei ausgesprochene Zentrumspolitik; trotzdem ihm Hindenburg ausdrücklich zur Pflicht machte, keinerlei Parteibindungen einzugehen, blieb Brüning in dauerndem und engstem Zusammenhange mit seiner Partei und ließ sich von ihr beraten. Ja, noch mehr! Hindenburg wünschte, daß auch den Deutschnationalen eine gewisse Mitverantwortung an der Regierung übertragen wurde. Dieser Tendenz widersetzte sich Brüning zielbewußt, indem er den Präsidenten täuschte. Er erklärte Hindenburg, daß er, der Kanzler, den Deutschnationalen öfter angeboten habe, in die Regierung einzutreten, daß aber Hugenberg diese Angebote stets abgelehnt habe. Dies aber entsprach durchaus nicht den Tatsachen. Auch später, nach der Wiederwahl Hindenburgs, täuschte Brüning den Präsidenten. Er verschaffte sich Hindenburgs Zustimmung zu dem Verbot der nationalsozialistischen S.A. durch die Behauptung, diese Organisationen trieben hochverräterische Dinge, obwohl dafür nicht der geringste Beweis vorlag. – Diese Unaufrichtigkeit Brünings, welche die Niederzwingung der nationalen Opposition und die Errichtung der Zentrumsdiktatur bezweckte, brachte den ahnungslosen Reichspräsidenten um einen großen Teil seiner Sympathien, die er einst in den nationalen Volkskreisen genoß. Ahnungslos, überzeugt, das Beste zu tun, geriet der greise Feldmarschall, umgarnt und umstrickt von unsichtbaren Fesseln, in die bedenklichste Lage vor dem deutschen Volke. –
Die Nationalsozialisten verfolgten schon längst mit Unmut, welchen Kurs Hindenburg mit und wider seinen Willen steuerte. Hatten sie ihm es schon verübelt, daß er seinen Namen unter den Westpakt von Locarno gesetzt hatte, so waren sie noch viel mehr verstimmt, daß er auch den Youngplan angenommen hatte und sich so in ganz offenen Gegensatz zur nationalen Bewegung gebracht hatte. Als er nun gar anfing, diktatorisch zu regieren und mit der Notverordnung vom März 1931 durch wesentliche Beschränkung der politischen Freiheiten insbesondere die Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung zu hemmen suchte, da war der Bruch vollkommen. Die Reichsleitung in München faßte eine Entschließung, worin sie von Hindenburg die Zurücknahme verlangte. Er solle "die Grundrechte der Verfassung gegen die Gesetzesbrüche der parlamentarischen Mehrheitskoalition verteidigen", oder, wenn er das nicht könne oder wolle, solle er zurücktreten. Anfang Mai 1931 sagte Frick ganz offen, man müsse Hindenburg, der nicht von seinen Ratgebern, dem Staatssekretär Meißner, den Ministern Severing, Wirth, Braun, gewählt sei, in aller Ehrerbietung, aber auch mit aller Entschiedenheit bitten, sein Amt niederzulegen. Schon im April 1931 hatte Schifferer, als Antwort auf die nationalsozialistische Entschließung, seinen Vorschlag wiederholt. Dieser schien auch Brüning und Hindenburg selbst sehr geeignet. Sie fürchteten die Hitzigkeit des Wahlkampfes und die Entscheidung des erbitterten und tobenden Volkes, die vielleicht gegen die Machthaber ausfallen konnte. Sie sagten, sie wollten die Persönlichkeit Hindenburgs nicht den Widerwärtigkeiten eines Wahlkampfes im Volke aussetzen. Brüning betonte außerdem, infolge außenpolitischer Notwendigkeiten müsse die "Stabilität der Regierungsgewalt" gesichert sein. Ein Präzedenzfall ereignete sich in Österreich. Im Oktober 1931 sollte der Bundespräsident neugewählt werden, durch das Volk. Aber man umging die Wahl. Die Bundesversammlung wählte am 9. Oktober den bisherigen Bundespräsidenten Miklas wieder. Die Germania, das offiziöse Brüningorgan, [180] meinte hierzu, die österreichischen Sozialdemokraten hätten durch den Verzicht auf eine Volksbefragung einen Beweis staatspolitischer Einsicht erbracht, der unter den obwaltenden Krisenumständen einem Gebot der Vernunft entspreche. Man könne hieraus Parallelen für die deutsche Präsidentenwahl ziehen.
Mitte Dezember standen die Dinge so, daß nur das Zentrum und sein rechter Flügel, die bürgerliche Mitte, für den Regierungsplan eintraten. Doch Brüning verlor nicht den Mut, er äußerte nochmals den Wunsch der Regierung, der Reichstag möge sich aussprechen, "ob es nicht nützlicher sei, die Reichspräsidentenwahl auf einen ruhigeren Zeitpunkt zu verschieben und die Amtszeit Hindenburgs um etwa ein Jahr zu verlängern". Da schoß noch einmal ein kalter Gegenstrom in die Regierungsbemühungen. Die Landwirtschaftskammer Ostpreußens, der Provinz, die Hindenburg 1914 von den Russen befreit hatte, forderte am 15. Dezember den Rücktritt des Reichspräsidenten und der Reichsregierung. Der preußische Ministerpräsident Braun löste darauf die Landwirtschaftskammer auf und ordnete Neuwahlen an. Mit diesem Beschluß habe die Kammer ihre Befugnisse überschritten. (Die Neuwahl fand Anfang April 1932 statt und brachte den Nationalsozialisten zwei Drittel aller Mandate.) [181] Nach Ablauf des weihnachtlichen Gottesfriedens nahm Brüning die Besprechungen mit den Parteiführern wieder auf, und zwar in der Richtung, daß eine Neuwahl auf sieben Jahre durch den Reichstag zustande kommen sollte. Breitscheid und Wels erklärten im Namen der Sozialdemokratie, die Partei wolle zustimmen, wenn der nationalen Opposition für ihre Zustimmung keine Gegenleistungen versprochen würden. Das war auch Hindenburgs Wunsch. Nun war es soweit, daß der bürgerliche rechte und der sozialdemokratische linke Flügel mit dem Zentrum und der Regierung einig waren. Das waren aber insgesamt nur 350 Stimmen im Reichstag. Doch das beabsichtigte Gesetz war verfassungsändernd, und insofern war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Es mußten also 386 Stimmen im Reichstag dafür abgegeben werden. Von den Kommunisten waren die fehlenden 36 Stimmen nicht zu erwarten, also mußte die Regierung Bundesgenossen bei den 150 Abgeordneten der nationalen Opposition suchen! Zwischen dem 6. und 12. Januar fanden die Besprechungen zwischen Brüning, Groener, Hitler und Hugenberg statt. Hitler erhob Bedenken gegen eine parlamentarische Wiederwahl Hindenburgs aus verfassungsrechtlichen und politischen Gründen. Hitler erklärte, nur dann vielleicht über den Plan verhandeln zu können, wenn der Reichstag neugewählt würde, dies sei infolge außenpolitischer Gründe nötig. Er forderte aber einen neuen Reichstag, um die Regierung Brüning stürzen zu können. Hugenberg machte geltend, er könne einem vom Zentrum ausgehenden Vorschlage nicht zustimmen, wenn dem schon die Sozialdemokraten zustimmen. Der gegenwärtige Reichstag entspreche nicht der Volksmeinung, und ein parlamentarischer Wahlakt sei keine Vertrauenskundgebung für den Reichspräsidenten, sondern für die von den Deutschnationalen bekämpfte Brüningregierung. Hitler und Hugenberg kamen so nach gemeinsamer Besprechung zur Ablehnung des Regierungsvorschlages; diese Ablehnung war keineswegs gegen den mit aller Hochachtung behandelten Hindenburg, sondern lediglich gegen die Regierung Brüning gerichtet. Hindenburg ersuchte darauf Brüning, von weiteren Bemühungen Abstand zu nehmen. [182] Inzwischen war eine gewisse Annäherung des Reichswehrministers an die Nationalsozialisten erfolgt. Während Brüning und Hitler Noten über ihre gegensätzlichen Standpunkte wechselten, gab Groener Ende Januar 1932 einen Erlaß heraus, wonach auch Nationalsozialisten in die Reichswehr eintreten durften. Bisher war ihnen dies versagt. Dieser Erlaß Groeners zeigte, welche Rolle die Nationalsozialisten im Staate bereits spielten. Zwei Jahre vorher hatte derselbe Reichswehrminister die Nationalsozialisten als hochverräterische Staatsfeinde gebrandmarkt und ihren Eintritt ins Heer versagt. Im Herbst 1930 wurde sogar ein Prozeß gegen Nationalsozialisten wegen Zersetzungstätigkeit in der Reichswehr geführt. Jetzt war die Hitlerbewegung eine Macht im Staate, und der Erlaß Groeners war gewissermaßen auch symptomatisch für die Bedeutung, die der Partei Hitlers für die bevorstehenden Wahlen zukam. Die Vorbereitungen zur Reichspräsidentenwahl traten Anfang Februar 1932 in ihre letzte Phase. In Berlin ward ein "überparteilicher" Hindenburgausschuß unter Vorsitz des "überparteilichen", aber von demokratischer Gesinnung erfüllten, seit Frühjahr 1931 zum Oberbürgermeister von Berlin gewählten Sahm gegründet. Dieser Ausschuß erklärte, daß er keine Beziehungen zu Parteien, aber um so engere Beziehungen zur Regierung habe. Er ließ in allen deutschen Städten Listen auslegen, in denen sich die Freunde Hindenburgs einzeichnen sollten. Die Namen der Eintragenden gingen bereits in den ersten Tagen in die Millionen. Auch unter den Hochschullehrern wurde in diesem Sinne gearbeitet. In Halle, in Marburg, in Jena erklärte sich etwa die Hälfte der Hochschullehrer für Hindenburg. Die Sozialdemokratie begann eine matte Propaganda für Hindenburg. Sie war nicht mit dem Herzen dabei. Sie riet ihren Anhängern, wenn sie Hindenburg nicht aus Liebe wählen könnten, sollten sie ihn aus Haß wählen – aus Haß gegen die nationalen Volksteile. Die große Stunde der Sozialdemokratie war vorüber: sie hatte keinen eigenen Mann und Führer mehr, sie segelte in Brünings Schlepptau. Es machte der Parteileitung Schwierigkeiten, die Massen für Hindenburg zu gewinnen. Besonders stark war der Widerstand innerhalb der sozialdemokratischen Gewerkschaften. [183] Und dann kamen die Absagen an Hindenburg: die Nationalsozialisten, die Deutschnationalen, der Stahlhelm, die Vaterländischen Verbände. Im Kyffhäuserbund gab es Zwietracht, weil der Vorsitzer, General Horn, Hindenburg empfahl, die Mehrheit der Vereine ihn aber ablehnte. Der Reichslandbund erhob sich gegen Hindenburg, gegen den Sahm-Ausschuß. Der Adelsmarschall von Berg-Markienen trat vom Vorsitz der Adelsgenossenschaft zurück, weil er für Hindenburg plädiert hatte und auf die Ablehnung der Mitglieder gestoßen war.
So trennten sich die Wege. Hugenbergs Harzburger Front, die nur ein kümmerliches Dasein geführt hatte, war endgültig zerbrochen. Wie schon beim Youngplan-Volksbegehren 1929, so war auch Hugenberg diesmal gescheitert in seinen Bemühungen, Führer der nationalen Opposition zu sein. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei stellte jetzt Adolf Hitler als Präsidentschaftskandidaten auf. Da er noch staatenlos war, wurde seine Einbürgerung nachgeholt. Der nationalsozialistische Minister Klagges in Braunschweig betrieb die Aktion. Er ernannte Hitler zum Regierungsrat und braunschweigischen Geschäftsträger in Berlin. Die Deutschnationalen entschieden sich für Düsterberg. Hugenberg gab seiner Parteikandidatur ein unparteiisches Gepräge, indem er Deutschnationale Volkspartei und Stahlhelm, was im Grunde dasselbe war, als "Schwarz-weiß-roten Block" dem Volke vorstellte. Ein kurzes Zwischenspiel bildete die viertägige Reichstagssitzung vom 23. bis 26. Februar 1932, die schon ganz von den [184] heftigen Gegensätzen der heraufziehenden Präsidentenwahl beherrscht war. Gleich zu Beginn wurde der Nationalsozialist Göbbels wegen einer ungemein scharfen Rede gegen die Kandidatur Hindenburgs ausgeschlossen. Als Brüning seine Verteidigungsrede gehalten hatte, schritt man zur Abstimmung. Die Mißtrauensanträge der Nationalsozialisten, Deutschnationalen, der Deutschen Volkspartei und der Kommunisten, für welche auch die Landvolkpartei und die Sozialistische Arbeiterpartei gestimmt hatten, wurde mit 289 gegen 264 Stimmen abgelehnt, auch wurden die Anträge auf Reichstagsauflösung mit 299 gegen 228 Stimmen abgelehnt. Darauf verließ die nationalsozialistische Fraktion den Saal. Immer mehr setzte sich die Auffassung durch, daß der Reichstag unfähig sei, seine Aufgaben zu erfüllen. Das stellte der Zentrumsabgeordnete Bolz fest. Dennoch aber scheute sich die Regierung, ihn aufzulösen. Er wurde aber auf unbestimmte Zeit vertagt. Der demokratische Parlamentarismus war in Starrkrampf verfallen.
Man wollte ritterlich kämpfen. Der ritterliche Kampf äußerte sich in Verboten nationalsozialistischer Zeitungen von Staats wegen, in Versammlungsverboten und ‑auflösungen, in einseitiger Begünstigung des mittelparteilichen Kandidaten Hindenburgs, der im Rundfunk seine Politik verteidigen durfte, während den anderen Bewerbern dies versagt war, in einer verbissenen Verschärfung des heimlichen Bürgerkrieges. Man scheute auch vor häßlichen persönlichen Verleumdungen nicht zurück. So wurde Hitler entgegen aller Wahrheit als Deserteur beschimpft, obwohl es bekannt war, daß er vier Jahre lang an vorderster Front gekämpft und hohe Auszeichnungen dafür erhalten hatte. In den meisten deutschen Großstädten sprach Hitler vor zehntausenden begeisterter Zuhörer. Derart gewaltige Kund- [185] gebungen wie diejenigen Hitlers hatte Deutschland noch nicht erlebt. Sie wirkten geradezu wie antike Volksversammlungen, auf ausgedehnten Plätzen unter freiem Himmel ein Menschenmeer, einig in seiner Begeisterung, keine Unterschiede, keine Gegensätze mehr kennend.
Düsterberg und Hugenberg veranstalteten große Kundgebungen, die Minister, auch Brüning, sprachen für Hindenburg. Dennoch war die Hindenburgfront nicht geistig geschlossen. Die Volkspartei gab die Parole aus: Für Hindenburg gegen Brüning, die Sozialdemokraten forderten: Für Hindenburg gegen Hitler. So strebten Dingeldey und Wels auseinander, und Brüning hielt die Zügel der Gegensätzlichen in seiner Hand. Das waren eben Gegensätze, unter denen die Republik schon seit Monaten zu bersten drohte. Wie denn der Reichsinnenminister Groener erklärte, die Nationalsozialisten seien nicht staatsfeindlich, der preußische Innenminister Severing aber das Gegenteil behauptete!
Um zu illustrieren, wes Geistes Kind die Eiserne Front, die für Hindenburg eintrat, war, soll ein Bericht von einer Kundgebung in Kassel am 11. März 1932 gegeben werden. Zunächst erklärte hier der Reichsbannerführer, Sozialdemokrat und frühere thüringische Ministerialrat Seele: Der Tag könne sehr bald kommen, "wo wir mit unsern Fäusten und Leibern zu kämpfen haben werden. Wir werden, wenn dieser Kampf auch noch so schwer werden und noch so viele Opfer kosten sollte, ihn zu Ende kämpfen, bis zur Errichtung eines sozialen Staates". Philipp Scheidemann knüpfte an seine am 11. September 1919 ausgegebene Parole an: Der Feind steht rechts! Eine Rechtsorientierung der Reichsregierung würde schon am ersten Tage den Bürgerkrieg bedeuten. Er beklagte, daß man mit den Kommunisten nicht wenigstens eine Viertelstunde vernünftig reden könnte; dann hätte man doch Hindenburg nicht gebraucht! Und schließlich sprach als Vertreter der Eisenbahner-Hammerschaften das Hauptvorstandsmitglied des Einheitsverbandes der Eisenbahner, Jahn:
"Die Fronten sind klar: wer nicht mit uns ist, ist gegen uns und wird rücksichtslos und restlos zu Boden geschlagen werden. An die Kommunisten richte ich in diesem Augenblick die Frage: Wollt ihr die Faschisten schlagen? Wenn ja, dann kommt her zu uns zu gemeinsamem Kampf. Wir sagen es mit vollem Bewußtsein der Tragweite dieser Worte: der Faschismus wird auf keinen Fall zur Macht gelangen, weil wir von der Eisernen Front es nicht wollen. Man hat uns Eisenbahner mit Recht als die Avantgarde der Eisernen Front bezeichnet, weil man weiß, wie groß unsere Macht ist. Wir werden die Faust an der Gurgel des Staates halten, den wir schützen als Voraussetzung zum sozialistischen Staat. Wir drehen aber jeden, der uns nicht paßt, den Gashahn ab. Heute rufen wir, morgen schlagen wir!" Dann fand die Vereidigung des "Antifaschistischen Regiments der Eisernen Front" statt. Ihr ging das Kommando voraus: "Die Fahnen hoch!" Und die roten Fahnen des Umsturzes erhoben sich. – Welche Gegensätze im Namen Hindenburg! Der Aristokrat, [187] der seine Treupflicht gegenüber der Verfassung so gewissenhaft erfüllte, daß sie zur Ungerechtigkeit für weite Volkskreise wurde, und der Prolet, der fähig war, brutal und gewissenlos die Verfassung zu brechen, wenn dies seinen egoistischen Wünschen entsprach!
Die meisten Stimmen erhielt Hindenburg in Süd- und Westdeutschland, in den Domänen der Bayrischen Volkspartei, des Zentrums und der Demokratie. Auch Hamburg, Leipzig, Dresden-Bautzen, Oppeln hatten Hindenburgmehrheiten. Die folgenden Tabellen mögen dies veranschaulichen. Die Zahlen geben die Vonhundertteile der abgegebenen gültigen Stimmen an:
In den westdeutschen Wahlkreisen, Westfalen-Nord und ‑Süd,
Düsseldorf-Ost und ‑West, Köln-Aachen,
Koblenz-Trier, Hessen-Nassau erhielten die Parteien Hitlers, Hindenburgs, Düsterbergs und Thälmanns folgende Stimmanteile:
In Mittel-, Ost- und Norddeutschland dagegen war Hindenburg in der erklärten Minderheit. Im Wahlkreis Halle-Merseburg erhielten Hitler 31,5, Düsterberg 11,9, Hindenburg 33,4 und Thälmann 23,2 Prozent der Stimmen. Insbesondere rechneten es sich die Gewerkschaften zum höheren Ruhm an, daß Hindenburg fast allein durch sie gewählt worden sei. Man bewies das rechnerisch: von den 8½ Millionen Gewerkschaftsmitgliedern mußten ½ Million noch nicht wahlberechtigte und 1 Million Kommunisten abgezogen werden. Von den übrigbleibenden 7 Millionen befanden sich die meisten im Alter von 30–40 Jahren, besaßen also meist noch eine wahlberechtigte Ehefrau, die natürlich auch für Hindenburg gestimmt hatte. So stammten also etwa 14 Millionen, annähernd vier Fünftel der gesamten Hindenburgstimmen, aus dem gewerkschaftlichen Lager! Das war natürlich Unsinn, aber bezeichnend für die demokratische Mentalität. Der große Stimmengewinn Hitlers erfüllte Hugenberg mit Sorge und die Gegner mit Grimm. Der Führer der Deutschnationalen nahm den Sieg Hindenburgs als endgültig gegeben hin. Aber die katastrophale Niederlage Düsterbergs bewog Hugenberg, der Welt noch einen weiteren schmerzlichen Beweis politischer Schwäche zu geben. Hugenberg war kein Epaminodas, aber sein Gebaren nach dem ersten Wahlgang erinnerte an Falstaffs Gepflogenheit, daß Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit sei. Hugenberg machte den Vorschlag, da ja nach dem Ergebnis des ersten Wahlganges Hindenburgs Wahl auch für den zweiten Wahlgang feststehe, von einem zweiten Wahlgang als zwecklos abzusehen, dafür aber Neuwahlen zum Reichstag abzuhalten! Dieser Vorschlag wurde vom Brüningblock, vom Zentrum und der Sozialdemokratie mit Hohngelächter zurückgewiesen. Hugenberg erklärte darauf, daß er und der Stahlhelm an dem zweiten Wahlgange nicht mehr interessiert seien und alle Kraft auf die späteren Preußenwahlen konzentrieren würden. Auf Preußen käme es an, von [189] Preußen aus müsse das Reich erobert werden. So desertierte Hugenberg vor dem zweiten Wahlgang aus der von ihm selbst geschaffenen Harzburger Front, aus parteipolitischem Egoismus und Neid gegen Hitler. Hugenberg brachte nicht die Disziplin auf, den weitaus Stärkeren anzuerkennen. Er, der die "Überparteilichkeit" immer so sehr im Munde führte, war parteipolitisch derart befangen, daß er lieber kampflos kapitulierte, als die Forderung des Vaterlandes über die Forderung der Partei zu stellen. Übrigens hatte der Stahlhelm selbst sich den schlechtesten Dienst erwiesen, daß er sich vor den Wagen der Deutschnationalen hatte spannen lassen. Er geriet in einen schweren Gewissenskonflikt. Zunächst waren von der Bundesleitung diejenigen Mitglieder gemaßregelt worden, die vor der Wahl für Hindenburg eingetreten waren. Darauf verlangte Hindenburg von der Bundesführung Mitteilung, ob sie bereit sei, die Maßregelungen zurückzunehmen. Die Bundesleitung willfahrte dem Wunsche ihres Ehrenmitgliedes! Der Mut zum Bekenntnis war ihr abhanden gekommen. Eine große Anzahl Bundesmitglieder war aber nicht einverstanden, daß der Stahlhelm nicht der Aufforderung des Grafen von der Goltz, des Führers der Vereinigten Vaterländischen Verbände, nun Hitler zu wählen, folgte, sondern aus den Vereinigten Vaterländischen Verbänden ausschied und erklärte, wie es Hugenberg ihm vorschrieb, er sei nicht mehr am zweiten Wahlgang interessiert. Auch beim Stahlhelm hieß es, wie der Parteidiktator Hugenberg kommandierte: "Keine Stimme dem System! Keine Stimme einer Parteidiktatur! Unsere Kampfparole bleibt: Preußen den Preußen!" Der Stahlhelm, der ganz zum Werkzeug Hugenbergs herabgesunken war, fuhr dennoch fort, seine Überparteilichkeit zu preisen. Damit aber waren, wie gesagt, viele Mitglieder nicht einverstanden, und eine Anzahl von ihnen trat daraufhin aus dem Stahlhelm aus. Die Opposition, an deren Spitze Männer von hohem Namen wie der Herzog von Sachsen-Gotha und Koburg standen, erließen einen Aufruf, in dem sie für Hitler eintraten. Dieses selbständige Vorgehen wurde von der Führung des Stahlhelms, Seldte und Düsterberg, aufs [190] schärfste verurteilt. So trieb Hugenbergs verfehlte Politik der Schwäche einen Keil in den Stahlhelm.
Reichsinnenminister Groener war vor der Wahl von der nationalsozialistischen Leitung über die Konzentration der S.A.-Mannschaften ordnungsmäßig unterrichtet worden und erblickte in der Begründung, die ihm gemacht worden war, keinen Anlaß zum Vorgehen. Nun erhielt der Minister eine [191] anonyme Denunziation über Zusammenziehungen angeblich bewaffneter S.A.-Formationen und Vorbereitungen zum Umsturz. Da Groener selbst keine Polizeigewalt besaß, gab er das Schreiben zur weiteren Bearbeitung an die Innenminister der Länder weiter. Das war für Severing der gewünschte Anlaß, den großen Schlag zu tun. Hier hatte man ja die Beweise, daß die Nationalsozialisten den Staat verhöhnten, daß sie einen Putsch vorbereitet hatten! Am 17. März ließ er in ganz Preußen Haussuchungen in den Gauleitungen und bei führenden Nationalsozialisten an mehr als 170 Stellen abhalten, ungeheure Mengen Material beschlagnahmen, verbot Zeitungen, so daß vor Ostern die Hälfte aller nationalsozialistischen Zeitungen unterdrückt war, drohte mit Verbot der Partei und der S.A.-Formationen. Fiebernd wartete Severing jetzt auf eine gewaltsame Erhebung der Nationalsozialisten. Er wünschte sie sehnlichst herbei, daß nun die Eiserne Front und die liebevoll geschonten Kommunisten über die Anhänger Hitlers herfallen und sie niedermetzeln könnten. Nichts von alledem geschah. Severing konnte nur in ohnmächtiger Wut die vorzügliche Disziplin der Nationalsozialisten höhnen. Sofort protestierte Hitler energisch bei Groener. Dieser selbst billigte keineswegs das Vorgehen Severings und widersetzte sich einem Verbot der Partei. Eine solche Maßnahme, wie sie Severing durchgeführt, habe er keineswegs veranlassen wollen. Groener, der nicht die Zentrumsbindungen Brünings besaß, hatte sich von der Legalität der Hitlerbewegung überzeugt und sah deshalb verfassungsrechtlich keinen Grund zum Einschreiten. Er war, wie gesagt, von den Maßnahmen der Partei längst unterrichtet worden und erblickte nichts Gefährliches darin, um so weniger, als er durch die Verantwortlichkeit der obersten Führung der Sturmabteilungen der Reichsregierung gegenüber die Mitglieder dieser Sturmabteilungen fest im Rahmen des gegenwärtigen Staates hielt. Im übrigen wußte der Minister, und insbesondere sein Mitarbeiter General Schleicher, daß bei allen irgendwie gearteten Erschütterungen des Reiches die einzig zuverlässige Stütze des Reichsgedankens und Reichswillens der mächtige nationalsozialistische Block war. [192] Es wäre unwürdig und unklug gewesen, maßlosem Haß die Zügel schießen zu lassen und um lächerlicher Lappalien willen die wertvollen Kräfte der nationalsozialistischen Partei zu zersplittern. Der Minister war also keineswegs einverstanden mit dem selbständigen Vorgehen Severings, das Groener weder beabsichtigt hatte noch vorher davon unterrichtet worden war.
Zähneknirschend mußte Severing seine Niederlage erkennen. Er war ohnmächtig in Taten, und mit Worten höhnte er. Aber er sann mit verzweifelten Kräften auf neue Schläge gegen seine Todfeinde. Tag und Nacht wurde im Preußischen Innenministerium gearbeitet, um neue Gründe zu finden. Die Regierung werde es sich unter keinen Umständen gefallen lassen, daß unter dem Deckmantel politischer Erziehung Rüstungen für eine Privatarmee betrieben würden, die innenpolitisch zu einer großen Gefahr geworden sei und auch sonst eine Gefahr zu werden drohe, meinte Severing. "Mit der genüglichen Existenz der Sturmabteilungen und Schutzstaffeln ist es vorbei!" Am 5. April 1932 wurden abermals in einer großen Anzahl preußischer Städte nationalsozialistische Büros und Heime [193] geschlossen. So rüstete sich Severing zu einem neuen Angriff, bei dem er die ideelle Unterstützung Bayerns, Württembergs, Badens und Hessens hatte. Seit dem Herbst 1931 hatte die kranke deutsche Sozialdemokratie nur noch ein Lebensziel: den Nationalsozialismus niederzukämpfen. Aber diese Aufgabe ging über ihre Kräfte. Die eiserne Front hatte versagt. Der feierliche Akt vom 1. Februar 1932, als Wels dem Minister Groener acht Bände Anklagematerial gegen die Nationalsozialisten überreichte und sicherheitshalber auch dem Reichskanzler und Severing Abschriften zukommen ließ, blieb ohne die erhofften Folgen. Alle schmutzigen Lügen und Verleumdungen hatten zu nichts geführt. Und nun mußte Severing erleben, wie seine große, mit genialischer Überraschung und Geschlossenheit durchgeführte Aktion ein Schlag ins Wasser war! Severing, Breitscheid und die ganze Sozialdemokratie grollten laut und vernehmlich gegen die Reichsregierung, insbesondere gegen Groener. Sie hatten allen Anlaß: nicht nur, daß der Minister den bewegten Klagen der Sozialdemokratie kein Gehör schenkte, nein, er räumte den Nationalsozialisten offensichtlich Vorteile ein: dem Reichswehrerlaß von Ende Januar, der auch den Nationalsozialisten das Recht gab, in das Heer einzutreten, ein Erlaß, der auch den Zorn der Staatspartei hervorgerufen hatte, folgte jetzt eine neue Tat, welche die Republikaner in Aufregung versetzte. Während Severing nämlich über neue Maßregeln gegen die Hitlerbewegung nachsann, weilte Reichsinnenminister Groener am 1. April 1932 in Harzburg und stellte mit dem deutschnationalen braunschweigischen Minister Küchenthal fest, daß die braunschweigische Regierung, an der auch der Nationalsozialist Klagges beteiligt war, und die Reichsregierung sich in vollster Übereinstimmung befinden. Das sah man doch nun ganz deutlich. Groener schien dabei zu sein, sich von der sterbenden, innerlich morschen Sozialdemokratie abzuwenden und sich an den jungen kräftigen Nationalsozialismus anzulehnen.
Gewaltig aber war der Angriff der Nationalsozialisten. Millionen deutscher Menschen füllten Tausende von nationalsozialistischen Versammlungen bis auf den letzten Platz. Hitler selbst sprach vor etwa einer Million Menschen in allen Teilen des Reiches. In Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen, Berlin, Königsberg, Düsseldorf, Köln, Essen, Nürnberg, Münster, Frankfurt, Darmstadt, Ludwigshafen – überall empfingen zehntausende von begeisterten Deutschen den Führer der Bewegung. Es waren Riesenversammlungen, wie sie Deutschland noch nicht erlebt hatte! In der Eisenbahn, im Kraftwagen, im Flugzeug eilte Hitler von Stadt zu Stadt. Oft auch mußten die Nationalsozialisten Widerstände überwinden, die ihnen von den Stadtverwaltungen bereitet wurden. Man verweigerte ihnen die Säle, dann wurden Riesenzelte gebaut, in die sich die Menschen drängten, trotzdem der kalte Nachtwind durch den luftigen Bau pfiff.
[195] Am 10. April 1932 fand der zweite Wahlgang statt. Im allgemeinen war es ein ruhiger Tag. Es kam hier und da zu Zusammenstößen, in Berlin, Hamm, Kassel, Lauterberg, Gadebusch, Hagenow, in Hamburg gab es sogar zwei Tote. Das Ergebnis des Ringens war: Hindenburg 19,36 Millionen = 53,21 Prozent, Hitler 13,42 Millionen = 36,88 Prozent und Thälmann 3,71 Millionen =: 9,91 Prozent Stimmen. Hindenburg also war der dritte deutsche Reichspräsident geworden. Viele Kommunisten hatten sich der Aussichtslosigkeit wegen der Stimme enthalten, vier Fünftel der Deutschnationalen und des Stahlhelms hatten Hitler ihre Stimme gegeben. Die volksparteiliche Zeitung Leipziger Neueste Nachrichten schrieb: "Schon steht heute Hitler, wie Banquos Geist, hinter dem Stuhle der Regierenden und fordert sein Recht."
Interessant war bei dieser Wahl der Verlust der Stimmen, den Hindenburg vom 13. März bis 10. April in Leipzig-Stadt und Hamburg erlitten hat:
Es war überhaupt merkwürdig, wie sich die Schwerpunkte der beiden Gegenkandidaten verteilten: Hitler, der Katholik, fand seine meisten Anhänger im evangelischen Norddeutschland; die Wahlkreise Chemnitz-Zwickau, Thüringen, Halle-Merseburg, Osthannover, Schleswig-Holstein und Pommern brachten mehr Stimmen für Hitler als für Hindenburg auf. Hindenburg dagegen fand die Hauptmasse seiner Wähler im katholischen Süden und Westen des Reiches. Hitler stützte sich auf die Landbevölkerung, auf die Bauern, doch stimmten in den Großstädten Wuppertal, Plauen, Chemnitz, Erfurt, Halle, Kiel mehr Wähler für Hitler als für Hindenburg. Dieser dagegen [196] fand seine Anhänger hauptsächlich in der städtischen und großstädtischen Bevölkerung. In dieser Wahl kam es klar zum Ausdruck, daß süddeutscher Volkstumsgeist und preußischer Staatsgeist im Nationalsozialismus zu einer Einheit zusammengeschmolzen waren: die junge Bewegung war reif zur Übernahme der Macht: es galt nur noch den störrischen Widerstand des Alten niederzuzwingen, jenes demokratischen Geistes, der ohne jede Berechtigung seine eigene parteipolitische Unzulänglichkeit den Nationalsozialisten zum Vorwurf machte. – Brüning, durch die starke Gegnerschaft Hitlers bewogen, bot dem Reichspräsidenten seinen und seiner Regierung Rücktritt an. Doch Hindenburg überredete den Kanzler, sein Demissionsgesuch zurückzuziehen. Kaum war die Reichspräsidentenwahl vorüber, da rüsteten sich die deutschen Parteien zum Wahlkampf für die Länderversammlungen zahlreicher deutscher Staaten, insbesondere Preußens und Bayerns. Auch hier wieder stand der große Kampf der bürgerlichen und marxistischen Gruppen gegen die Hitlerbewegung im Mittelpunkte: es sollte um alles in der Welt verhindert werden, daß die junge Bewegung an die Macht gelangte, und der Kampf gegen die Hitlerbewegung war so verzweifelt, daß man selbst nicht vor einem Bruch mit den demokratischen Errungenschaften zurückschreckte. In der Tat war die nationalsozialistische Partei die einzige, feste und unerschütterliche Organisation, die den Wahlen entgegenging. Den Kern der 13 Millionen Hitlerwähler bildete die Million der eingeschriebenen Mitglieder, die Anfang April erreicht war und die durch eine strenge Disziplin auf die eine und wichtige Aufgabe der Machtergreifung zusammengefaßt wurden. Und von dieser festgefügten Partei ging eine starke Anziehungskraft aus, die selbst bis in die Reichsregierung hineinstrahlte. Während Brüning und Stegerwald dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstanden, erblickte der Demokrat Groener in ihm einen Faktor, mit dem man rechnen mußte.
Dieser Plan Brauns von Ende März 1932 begegnete selbst innerhalb der preußischen Koalition starken Bedenken. Das Zentrum meinte, wenn auch ein solcher Plan sachlich-politisch zu begrüßen wäre, weil er verhindere, daß eine radikale Minderheit ans Ruder komme, so sei doch der Augenblick recht ungünstig. Man könne nur allzusehr von der Gegenseite darauf hinweisen, daß es sich um eine Wahlmache der Regierungsparteien handele, und man habe der nationalen Opposition einen großen Trumpf in die Hände gegeben. Doch Braun ließ sich durch solche Bedenken keineswegs stören. Da er erst befürchtete, der Landtag könne nicht rechtzeitig vor den Neuwahlen zusammengerufen werden, hatte er die absurde Idee, nach bereits erfolgter Neuwahl nochmals den alten Landtag einzuberufen und die Änderung der Geschäftsordnung beschließen zu lassen. Aber das war gar nicht nötig. Noch in letzter Stunde war es gelungen, den Landtag auf den 12. April zusammenzurufen, so wie es die Fraktionen der Staatspartei, des Zentrums und der Sozialdemokratie gewünscht hatten. Und da, unmittelbar am Vorabend dieser historischen Landesversammlung, wurde Braun andern Sinnes, denn er erkannte jetzt wohl auch das politisch Verhängnisvolle des ganzen Planes. Aber seine Bitten an die Fraktionsführer, den Antrag fallen zu lassen, kamen zu spät. Nicht mehr derjenige, der dem Staate dienen sollte, sondern [198] die herrschsüchtigen Koalitionsparteien der Regierung heischten das Recht, über die Zukunft des Staates zu bestimmen. So brachten sie am folgenden Tage ihren Antrag ein, verzichteten aber auf jede Begründung vor dem Parlamente. Lediglich der Staatsparteiler Nuschke konnte sich nicht enthalten, eine seinem Umgangston entsprechende Äußerung zu tun: Es handle sich darum, die Geschäftsordnung mit der preußischen Verfassung in Einklang zu bringen; die Regierungsparteien hielten es für absolut notwendig, Verbrecher von der Regierungsgewalt fernzuhalten. Mit den Verbrechern bezeichnete er die Nationalsozialisten! So stand dann folgender Antrag der Staatspartei, des Zentrums und der Sozialdemokratie zur Abstimmung: § 20 der Geschäftsordnung hatte bisher folgenden Wortlaut:
Man verlangte nun, daß der dritte Satz gestrichen würde. Da dies keine Verfassungs-, sondern nur eine Geschäftsordnungsänderung war, brauchte man keine Zweidrittelmehrheit, sondern nur die einfache Mehrheit. An der Abstimmung beteiligten sich nicht die andern Parteien. Zwei Zentrumsabgeordnete, von Papen und Linneborn, verließen vorher den Sitzungssaal, weil sie gegen den Antrag waren, der Zentrumsabgeordnete Maaßen enthielt sich der Stimme, der Staatsparteiler und ehemalige Finanzminister Höpker-Aschoff war nicht anwesend. Eine Stimme, die eines Volksparteilers, war ungültig. Sämtliche 227 anderen Abgeordneten der Sozialdemokratie, des Zentrums und der Staatspartei nahmen den Antrag an. Es war eine Stimme mehr als zur absoluten Majorität in dem 451 Abgeordnete zählenden Parlament nötig war. Es war bezeichnend, daß kein einziger preußischer Minister an der Sitzung teilnahm. Nun waren die Würfel gefallen: Das sterbende System zügelloser Parteiherrschsucht hatte sich [199] noch einmal zu einer rohen Gewalttat aufgerafft, zu deren Durchführung es einzig und allein die Kraft nicht aus staatsmännischer Überlegung, sondern aus seinem maßlosen Hasse zog. Die Änderung der preußischen Geschäftsordnung war die große politische Tat der Sozialdemokratie! Dem Zentrum war gar nicht recht froh zumute, an der Seite der Sozialdemokratie solch eine politisch zweifelhafte Tat begangen zu haben. Schon vor der Einberufung des Landtages erklärte die Germania, so unanfechtbar nach der sachlichen Seite die beabsichtigte Korrektur der Geschäftsordnung sei, so unklug und bedenklich sei es, das allzulang Versäumte in letzter Stunde vor der Neuwahl des Landtages noch nachholen zu wollen. Nach der Landtagssitzung schrieb das Zentrumsblatt: "Wir haben gegen die Vornahme der Änderung für den gegenwärtigen Augenblick lebhafte Bedenken geäußert, und diese Bedenken bestehen fort." Es sei aus psychologischen und taktischen Gründen nicht nützlich, eine Tatsache zu schaffen, die zu anderer Zeit ohne weiteres zu rechtfertigen wäre. Was die politische Seite betreffe, so könne es sich, soweit die Zentrumspartei in Frage komme, selbstverständlich nicht darum handeln, etwa die bisherige Koalition oder das Kabinett Braun in alle Ewigkeit an der Macht zu erhalten. Das Zentrum lehne es ab, ausgesprochene Minderheitsregierungen, noch dazu von radikaler Prägung, zur Macht gelangen und von dieser Macht entgegen der Volks- und Parlamentsmehrheit Gebrauch machen zu lassen. Die Partei wolle gerade einen starken Zwang dahin ausüben, daß auch im neuen Landtag eine Mehrheitsregierung unter allen Umständen zustande komme. Wenn also das Zentrum an der Änderung mitgewirkt habe, so sei das keine Option für das Fortbestehen des Kabinetts Braun in der Form eines geschäftsführenden Ministeriums. So zeigte sich auch hier wieder einmal, daß die beiden Bundesgenossen Zentrum und Sozialdemokratie, von inneren Gegensätzen auseinandergedrängt, einig waren in dem einen Ziele, dem Nationalsozialismus die Regierungsgewalt vorzuenthalten. Sie waren es aber auch noch in anderer Weise. Das aus den Anhängern der drei Koalitionsparteien bestehende Preußenkabinett war einmütig darin, mit den vom ganzen Volke ein- [200] gehenden Steuergeldern Wahlpropaganda für sich zu treiben. In jenen Tagen warfen die Minister Braun, Severing, Hirtsiefer Millionen aus, um damit Zeitungen des Zentrums und der Sozialdemokratie zu unterstützen in ihrem Verzweiflungskampf gegen den Nationalsozialismus. Eine Reihe koalitionsparteilicher Zeitungen in allen Teilen Preußens wurden Nutznießer dieser Freigebigkeit. Auch von der rechten bürgerlichen Seite war ein Anschlag auf die "radikale" Rechte geplant worden. Die sich national nennende, aber durchaus vergreiste Wirtschaftspartei brachte Mitte März 1932 im Landtag einen Antrag ein, den sie schon einmal im Dezember 1930 vorgelegt hatte und der eine Erhöhung des Wahlalters von 20 auf 25 Jahre forderte. Diesen Antrag lehnte die Sozialdemokratie von vornherein ab, da er eine "Errungenschaft" von 1918 betraf, auch die Kommunisten wandten sich scharf dagegen. Bei der Abstimmung am 18. März 1932 gaben nur 105 Abgeordnete ihre Karten ab. Es wäre aber, da es sich um ein verfassungsänderndes Gesetz handelte, Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen, es hätten also 301 Abgeordnete dafür stimmen müssen.
Allerdings konnte die Volkspartei sich nicht mit solchen Plänen ernstlich befassen – aus Selbsterhaltungstrieb. Ihr Eintreten für Hindenburg hatte doch starke Erschütterung in den Reihen der Mitglieder hervorgerufen, und um so entschlossener mußte der Parteiführer Dingeldey die politische Linie herausarbeiten: Für Hindenburg, aber schärfster Kampf gegen Brüning. Sie konnte also nicht eine Verbindung mit Parteien eingehen, welche das System Brüning stützten. Unter der Losung: Beseitigung der Herrschaft der Weimarer Koalition trat sie selbständig in den Wahlkampf ein. Lediglich mit der Volksrechtpartei kam Ende März ein Abkommen zustande, worauf die [201] Reststimmen beider Parteien auf eine gemeinsame Landesliste vereinigt werden sollen. Auch die Wirtschaftspartei, die Landvolkpartei und die Volkskonservative Partei lehnten einen Wahlblock mit der Staatspartei ab. Dagegen kam zwischen diesen drei Parteien Anfang April eine Listenverbindung zustande. Sie verabredeten, die Reststimmen in den Wahlkreisen auf eine Liste "Nationale Front deutscher Stände" zu vereinigen. Diesen Schritt begrüßte besonders die Wirtschaftspartei, da sie mit einem starken Verlust bei den Neuwahlen rechnete und befürchtete, in den neuen Landesversammlungen nicht mehr Fraktionsstärke zu erhalten. Eine Hinzuziehung der Volkspartei, die in den Reihen dieser Gruppe geplant war, scheiterte an der Ablehnung der Partei Dingeldeys, die mit ganzer Kraft einer Sammlung des nationalen Bürgertums zustrebte und daher jede Verbindung mit Gruppen ablehnte, welche in Reich und Preußen nicht einheitlich vorgingen. So waren also Anfang April die bürgerlichen Heeressäulen der Mitte zum Marsch in den Wahlkampf gerüstet: ganz rechts marschierte die Volkspartei mit der Volksrechtpartei, ihr schloß sich die "Nationale Front deutscher Stände" an, der Christlich-Soziale Volksdienst blieb allein und ohne jede Bindung und ebenso die deutsche Staatspartei, die einen zaghaften aber erfolglosen Versuch gemacht hatte, mit dem Zentrum zu einer Listenverbindung zu kommen.
Hugenberg entschloß sich also, die großartige Stellung der Partei, die ihr nach den Preußischen Landtagswahlen zufallen sollte, beizeiten vorzubereiten. Wie die Macht des Zentrums sich auf den bürgerlichen und marxistischen Flügel seiner Koalition stützte, so wollte Hugenberg die neue geschlossene Macht der Deutschnationalen auf den nationalsozialistischen und bürgerlichen Flügel stützen. Es wäre dann ein mächtiger nationaler Block von den Nationalsozialisten bis zu den Christlich-Sozialen entstanden, der ebenso stark gewesen wäre wie der demokratische Block von Staatspartei über Zentrum zur Sozialdemokratie und in welchem die Deutschnationalen die Rolle des Zentrums gespielt hätten. Dieses Ziel, einen bürgerlich-nationalen Block in Preußen zu schaffen, verfolgte der Vorschlag, den Hugenberg Ende März 1932 machte:
"Ließe sich nicht ein Abkommen folgenden Inhalts mit der Deutschnationalen Volkspartei treffen: Die Reststimmen der Deutschen Volkspartei, der Landvolk- und Wirtschaftspartei kommen, da sie mangels der entsprechenden Stärke sonst im Lande verloren sein werden, auf die deutsch-nationale Liste.... die so Gewählten wären Hospitanten der Landtagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei, da auf Fraktionsstärke der betreffenden Parteien nicht zu rechnen ist." In drei Grundzielen müßte man allerdings völlig einig sein: Klarer und entschiedener Nationalismus, Ablehnung jeder Sorte von Sozialismus, Bildung eines nationalen, antimarxistischen Kabinetts in Preußen und im Reich. Hugenberg machte seinen Vorschlag ganz öffentlich in der Presse, um nicht von vornherein durch die Parteileitungen Ablehnung zu erfahren. Er rief die Entscheidung der Wähler, nicht der Führer an. Die Landvolkpartei stand zunächst dem Vorschlag nicht ablehnend gegenüber, ging aber dennoch nicht darauf ein, da sie die diktatorischen Absichten Hugenbergs fürchtete, sondern verband sich mit Wirtschaftspartei und Volkskonservativen. Die Volkspartei dagegen lehnte von vornherein eine [203] Verbindung mit den Deutschnationalen ab. Es bestehe für sie keine Veranlassung, auf das Scheinangebot einzugehen. Dingeldey empfand in Hugenbergs Vorschlag ein "verletzendes Prestigebedürfnis" und machte am 4. April 1932 seinerseits folgenden Vorschlag: Die Deutschnationale Volkspartei und die Deutsche Volkspartei stellen in den Wahlkreisen eigene Listen auf, die Wahlkreislisten werden in den Wahlkreisen untereinander verbunden, die Reststimmen gehen auf eine gemeinsame preußische Landesliste. Für die Aufstellung gemeinschaftlicher Landeslisten sei das Verhältnis maßgebend, wie es sich nach den Reichstagswahlen vom September 1930 darstellt. Aber gerade dieses Letzte widerstrebte Hugenberg und seinen Ratgebern, die von einem mächtigen Anwachsen der Deutschnationalen seit dem 14. September 1930 träumten. Und so kam es, daß der Vorschlag Hugenbergs ohne Folgen blieb, wie auch derjenige Dingeldeys. Es stand fest, daß Hugenbergs Politik, die eine Vormachtstellung der Deutschnationalen in der nationalen Front erstrebte, gescheitert war. Allein und ohne Bundesgenossen ging er in den Wahlkampf. Kaum war die letzte Stimme im zweiten Gang für die Präsidentenwahl abgegeben, da begann auch schon der Kampf um die Vorherrschaft in den neuen Landesversammlungen, letzthin um die Macht im Staate. Schon waren die ersten Redeschlachten geschlagen, da trat Hindenburg mit seiner ersten Tat nach seiner Wiederwahl hervor. Er erließ am 13. April 1932 eine Notverordnung, welche sämtliche militärähnlichen Organisationen der Nationalsozialistischen Partei, die Sturmabteilungen und Schutzstaffeln mit allen dazugehörigen Stäben und Einrichtungen auflöste. Die Sturmabteilungen und Schutzstaffeln bildeten gewissermaßen die Kerntruppe der nationalsozialistischen Partei. Diese Formationen umfaßten Anfang 1931 100 000, ein Jahr später bereits 300 000 und zum Zeitpunkte des Verbotes annähernd 400 000 deutsche Männer, von denen allein drei Viertel arbeitslos waren. Die festgefügten Verbände gliederten sich in einer Weise, welche die Durchführung des Führerwillens bis zum letzten Manne gewährleistete und insofern gewisse Parallelen mit der Gliederung militärischer Verbände aufwies. An [204] der Spitze stand Hauptmann Röhm, und die Führer der Unterverbände waren bewährte Offiziere der alten Armee aus der kaiserlichen Zeit. In der Disziplin und der persönlichen Tüchtigkeit der Formationen sahen die Franzosen eine große Gefahr für die Zukunft, denn sie hatten Angst, daß hieraus einst das deutsche Freiheitsheer hervorgehen würde; die Sozialdemokraten kämpften bereits seit dem Herbst 1931 um die Auflösung der Verbände, denn sie erblickten in ihnen die drohende Gefahr, welche über der Novemberrepublik schwebte.
Eine Woche lang hat man in der Reichsregierung heftig um das Verbot gekämpft. Brüning und Hindenburg haben sich lange gesträubt, bis sie dem von Gröner geforderten Verbot [205] beistimmten. Sie fürchteten nicht mit Unrecht, daß man das Verbot als den Dank Hindenburgs an die Sozialdemokratie für seine Wiederwahl auslegen würde. Hatte doch das Reichsbanner am 11. April an Hindenburg ein Glückwunschtelegramm gesandt, worin die "völlige Niederwerfung" der Nationalsozialisten erwartet wurde. Der Vorwärts schrieb am 11. April:
"Die sozialdemokratischen Arbeiter haben wieder einmal Staat und Volk vor dem Sturz in den Abgrund gerettet (durch die Wahl Hindenburgs) und sie wissen schon aus alter Erfahrung, daß man ihnen das außerhalb ihrer eigenen Reihen nicht danken wird.... Die sozialdemokratischen Arbeiter haben das Ihre getan, sie verlangen jetzt vom Reich, daß es das Seine tut." Hindenburg und Brüning wußten, daß diese marxistischen Stimmen dem von Groener geforderten Verbot einen recht üblen Beigeschmack gaben, sie wußten, daß die Gegner des Verbotes von einem Druck der Gewerkschaften sprechen würden; aber Groener drohte mit seinem Rücktritt. Endlich stimmten dann auch der Reichskanzler und der Reichspräsident zu. Man kann wohl sagen, daß das Verbot einzig und allein Groeners Werk war. Selbst mit seinen Mitarbeitern, General Schleicher, und General von Hammerstein, dem Chef der Heeresleitung, hatte er tiefgehende und sehr ernste Meinungsverschiedenheiten und Widerstände zu überwinden. Schleicher schätzte zwar den militärischen Wert der Verbände gering ein, aber er sah doch in ihnen eine gute Schule für die jungen Leute, Pflichterfüllung, Opfermut und Gemeinschaftsgeist zu lernen. Wenn auch Groener behauptete, daß er bei dem Verbot ganz selbständig vorgegangen sei, weder von Severing noch von der Eisernen Front sich habe beeinflussen lassen, so war doch darüber kein Zweifel, daß starke sozialdemokratische Einflüsse im Innenministerium auf diese Entwicklung hinarbeiteten. Zu der Frage des Verbotes der S.A. und S.S. geriet Groener in eine verzwickte Lage zwischen den beiden von ihm verwalteten Ministerien: das Innenministerium forderte eine Tat, welche das Reichswehrministerium nicht billigte. Das Verbot wurde folgendermaßen begründet: Die Organisation sei militärischen Formationen nachgebildet, sie stelle ein Privatheer, ein Parteiheer dar, wenn auch zum Teil [206] unbewaffnet. Die kasernenmäßige Unterbringung sei besonders gefährlich und die Gefahr von Gewalthandlungen sei jederzeit gegeben. Es sei ausschließlich Sache des Staates, eine organisierte Macht zu unterhalten, und ein Staat im Staate könne nicht geduldet werden. Die Verbotsmaßnahme sei streng überparteilich. Es gehe dabei nicht um Partei oder Regierungen, sondern um den deutschen Staat selbst. Aus dem gleichen Grunde sei 1929 schon der Rote Frontkämpferbund aufgelöst worden. Das deutsche Volk lebe unter einer freiheitlichen Verfassung und die brauche Ordnung. Die Reichsregierung wisse sich in der Auffassung der Lage mit der großen Mehrzahl der Länderregierungen einig. "Sie ist fest entschlossen, auch in Zukunft gegen jeden Versuch, einen Staat im Staate zu bilden, ohne Ansehen der Person und der Partei mit allen Machtmitteln des Staates rücksichtslos einzuschreiten." Die Auflösung der Sturmabteilungen und Schutzstaffeln vollzog sich in aller Ruhe und ohne Widerstand von seiten der betroffenen Verbände. Große Polizeiaufgebote drangen in die nationalsozialistischen Häuser ein, durchsuchten und versiegelten die Räume und führten viel Material fort. Die Sozialdemokratie, die Gewerkschaften, das Reichsbanner, die Eiserne Front triumphierten. Mancher sozialdemokratische Polizeibeamte glaubte, die Stunde sei gekommen, sein Mütchen zu kühlen. In vielen Städten spielten sich unwürdige Szenen ab. Mit Gummiknüppeln gingen die Polizisten gegen wehrlose Frauen und Kinder vor. Skandalöse Vorgänge rief die Polizei in Breslau hervor. In einem provisorischen Lazarett in der nationalsozialistischen Geschäftsstelle wurden 20 schwerverletzte Nationalsozialisten eingeliefert, zum Teil mit Gehirnerschütterung von den Gummiknüppelschlägen. Auch gegen Frauen wurde von den ritterlichen Beamten die Kosakenmethode angewendet, ja, der Reichstagsabgeordnete Schönwälder wurde sogar, als er Zeuge dieser Vorgänge war, von einem Beamten mit der entsicherten Pistole bedroht! In Hamburg wurden 20 Männer verhaftet, darunter 7 Bürgerschaftsmitglieder und ein Reichstagsabgeordneter. Grzesinski in Berlin verfügte sofort die Schließung von 60 S.A.-Heimen. Ist es doch vor- [207] gekommen, daß in dem thüringischen Ort Langewiesen bei Arnstadt der sozialdemokratische Bürgermeister das Reichsbanner zusammenrief und bewaffnete, damit es die Notverordnung des Reichspräsidenten durchführte, weil die zur Verfügung stehende Polizei "zu schwach" war! Das Banditentum des Reichsbanners trieb üppige Blüten. Es maßte sich Polizeirechte an und oft kam es vor, daß eine Rotte feigen Gesindels einzelne Nationalsozialisten griff und nach Waffen durchsuchte: "Wir stellen jetzt Polizeigewalt dar!" In München befand sich die "Eiserne Front" allenthalben in höchster Alarmbereitschaft. Von Wirtschaften, die als Sammelort dienten, wurden Patrouillen ausgesandt, Nachrichtensysteme unterhalten und Leute abkommandiert, vor dem Braunen Haus und sonst als Lockspitzel zu wirken, um Zusammenstöße zwischen Polizei und Nationalsozialisten herbeizuführen. Polizeibeamte wurden wiederholt auf das Treiben aufmerksam gemacht, doch ohne Erfolg! Sie hatten kein Interesse dafür, weil es keine Nationalsozialisten waren! Es war ein herrlicher Rausch für das Reichsbanner, darauf zu lauern, um als hungriger Schakal über den gefällten Löwen herzufallen, dem man zu Lebzeiten feige aus dem Wege ging! Hitler mahnte zur Ruhe, warnte vor unbedachten Schritten. Es war das Schicksal der Kämpfer für Deutschlands Freiheit, daß sie Verfolgung und Verfemung dulden mußten. Das aber, was die Eiserne Front sehnlichst wünschte, um einen Grund zum Bürgerkrieg zu haben: die Nationalsozialisten möchten losschlagen, das trat nicht ein. Denn auf den Bürgerkrieg als letzte Rettung zielte ja die ganze Politik der Braun, Severing, Höltermann, Breitscheid, Wels ab!
Die Bedeutung dieses Ereignisses rechtfertigt es, wenn einige Urteile der führenden deutschen bürgerlichen Presse wiedergegeben werden. Die der Volkspartei nahestehende Deutsche Allgemeine Zeitung schrieb unter der Überschrift "Der Staat steht links":
"Während behauptet wird, daß die Auflösung auch aus außenpolitischen Gründen erfolgt sei, und zwar deshalb, weil der Reichskanzler den Hinweis auf die Auflösung bei der Abrüstungskonferenz nützlich verwenden könne, ist in Wirklichkeit hier eine Organisation der Entente denunziert worden. Wenn die Reichsregierung offen diese Organisation als eine private Armee bezeichnet, so wird jedenfalls dieses Stichwort in Frankreich begierig aufgegriffen und dem Reichskanzler von Herrn Tardieu sehr oft vorgehalten werden. Die innerpolitische Begründung bedarf keiner weiteren Beleuchtung mehr. Daß jetzt einseitig die Parteitruppe Hitlers verboten wird, wird sicher von weitesten Kreisen eben nicht als eine Maßregel der Staatspolitik aufgefaßt werden, sondern als eine Maßregel des Wahlkampfes gegen die Nationalsozialistische Partei. Es ist anzunehmen, daß die Erregung eine ungeheure sein wird und daß, wie schon früher in einzelnen S.A.-Gruppen, Zweifel an der Richtigkeit des Legalitätskurses, den Adolf Hitler eingeschlagen hat, laut werden. Es ist schmerzlich, daß sich auch Reichswehrminister Dr. Groener und Reichskanzler Dr. Brüning den sozialdemokratischen Wünschen gefügt haben." Die volksparteiliche Kölnische Zeitung meinte:
"Die Be- [209] gründung der Notverordnung kann uns nicht überzeugen, doch die Auflösung ist jetzt ausgesprochen, und es bleibt nur übrig, das Fehlerhafte des Vorgehens zu betonen und besonders unser Bedauern auszusprechen, daß man den Reichspräsidenten vor die Notwendigkeit gestellt hat, als erste Handlung seiner neuen Amtszeit ein Verbot zu verhängen." Die überparteiliche nationale Berliner Börsenzeitung sagte, das Verbot sei erfolgt zu einem Zeitpunkt, der kurz nach der Reichspräsidentenwahl die Motive in einem besonders merkwürdigen Lichte erscheinen lasse. Das Verbot trage nicht im entferntesten zur Beruhigung des deutschen Volkes bei. Man müsse feststellen, daß der Reichsinnenminister so schlecht wie möglich beraten war, als er vor dem Drängen linksgerichteter Länderregierungen die Waffen streckte. Der deutschnationale Tag urteilte:
"Bis in die letzte Stunde haben rechtsparteiliche und mittelparteiliche Zeitungen, die parteienmäßig mit der N.S.D.A.P. nicht das geringste zu tun haben, die Reichsregierung aus staatspolitischen Gründen und aus Gründen der persönlichen Zuneigung zu dem greisen Generalfeldmarschall von Hindenburg eindringlich vor dem Verbot gewarnt. Es muß festgestellt werden, daß die Zahl der ermordeten S.A.- und S.S.-Männer in die Hunderte geht und daß bisher die Staatsautorität nicht in der Lage war, insbesondere die Untaten aus der Eisernen Front und aus dem Reichsbanner zu verhindern. Staatspolitisch ist es äußerst bedenklich, jetzt die 400 000 Menschen der S.A.- und S.S.-Organisationen, die zu einem Teil aus Arbeitslosen bestanden, welche in den Quartieren ihrer Organisation Unterkunft und Verpflegung fanden, der Verantwortung ihrer Führer zu entziehen." Dingeldey, der Führer der Deutschen Volkspartei, erklärte in einer Wahlrede: es sei ein trauriger Tag für Deutschland gewesen, an dem es Reichsminister Groener gelungen sei, beim Reichspräsidenten das Verbot der S.A. zu erreichen. Wenn man bei der Eisernen Front, dem Reichsbanner und den Hammerschaften usw. Haussuchungen veranstaltet hätte, würde sich eine Fülle von Material finden lassen, mit dem das gleiche Verbot auch nach dieser Richtung hin hätte begründet werden können. Deshalb sei es zu bedauern, daß das S.A.-Verbot einen [210] einseitigen Charakter trage und daß nicht mit derselben Schärfe und Überparteilichkeit ein Verbot ähnlicher Organisationen verlassen worden sei. Die Regierungspresse anderseits war nicht nur befriedigt über das Verbot, sondern forderte sogar zu weiteren Schritten gegen die N.S.D.A.P. auf! Die Einseitigkeit der Maßnahme, daß man nur die "Privatarmee" Hitlers, nicht aber die Privatarmee der Sozialdemokratie, das Reichsbanner, verbot, erregte nicht den geringsten Anstoß. Die linksdemokratische Vossische Zeitung gab ihre Meinung dahin ab:
"Hitler ist am 13. März und am 10. April in der ersten und zweiten Instanz unterlegen. Der Versuch, bei den Landtagswahlen Revision einzulegen, muß zurückgewiesen werden. Je stärker und einheitlicher der Abwehrwillen gegen die Zerstörung von Staat und Wirtschaft durch größenwahnsinnige Dilettanten und wilde Demagogen hervortritt, desto leichter wird es auch gelingen, dem Spuk der S.A., dieser Karikatur und Parodie auf den nationalen Wehrgedanken, zum Verschwinden zu bringen." Sehr treffend charakterisierte der Nationalsozialist Dr. Hans Frank in einem Offenen Brief an Groener die psychologischen Hintergründe des Verbotes:
"Die Notverordnung vom 13. April 1932 wurzelt nicht in den Erkenntnissen einer Politik, die, wie die nationalsozialistische, ihr Weltbild aus Jahrhunderten und Kontinenten formt, sondern eingestandenermaßen aus der reinen Nützlichkeitsbetrachtung einer 'Staatsautorität', die vor der Jugend des eigenen Volkes zurückschreckt." Natürlich fand die schwerwiegende Tat der Reichsregierung auch im Ausland große Beachtung. Frankreich war hocherfreut und wunderte sich nur, daß die deutsche Regierung solange gewartet hätte, bis sie endlich die "illegale Armee" von 400 000 Mann verboten habe. Da allerdings die Beziehungen zwischen Reichswehr und Hitler sehr eng gewesen seien, war man immerhin noch skeptisch. In Italien sah man in dem Verbot den Preis, den Hindenburg der Sozialdemokratie für seine Wiederwahl am 10. April gezahlt habe. Die deutsche Sozialdemokratie sei ja von der fixen Idee der Sicherheit befallen. In England beschränkte man sich zumeist auf die kühle und nüchterne Meldung des Verbotes, wies aber doch auf die [211] Disziplin und die Ruhe der S.A. und die Bedeutung Hitlers hin. Der Daily Expreß schrieb:
"Wenn es Hitler gelingt, seine Armee aufzulösen und trotzdem ihre Treue zu erhalten, wenn er seine Leibwache entlassen kann und trotzdem die öffentliche Achtung behält, wenn er die Staatsgewalt anerkennen kann, ohne seine Überzeugung zu opfern, dann wird er es erleben, als Herrscher Deutschlands erwählt zu werden. In der gleichen Stunde, da Hitler seine größte Krisis erlebt, hält er auch seine größte Gelegenheit in Händen!.... Dies ist Hitlers Stunde, mit erbarmungsloser Feder wartet die Geschichte." Allsogleich rührten sich in den deutschen Ländern eifrige Kräfte, um die nationalsozialistische Partei weiter zu unterhöhlen. So beeilte sich der sozialdemokratische Polizeipräsident Grzesinski in Groß-Berlin, für seinen Bezirk auch die Hitler-Jugend und den nationalsozialistischen Volkssportverein zu verbieten. Auch die demokratische Regierung Badens fühlte sich plötzlich nach dem Verbot stark genug, nicht nur zu erklären, daß ihr seit Monaten wiederholt und nachdrücklichst in Berlin vorgetragener Wunsch endlich erfüllt sei, sondern auch ihren Beamten mit schweren Maßregelungen und Strafen zu drohen, wenn sie der Partei Hitlers angehörten. Ähnliche Strömungen zeigten sich in Hessen.
In der Tat verfügte das Reichsbanner im Frühjahr über zahlreiche heimliche Waffen und Waffenlager. Es gab geheime Verbindungen zwischen Reichsbanner und Suhler Waffenfabrikanten, und die Zwickauer Reichsbannerzentrale brachte es fertig, tausend Mann mit Pistolen und Munition zu versehen. Die Garde Severings hatte den Vorteil, daß sie unter dem Schutze mächtiger Staatsmänner stand. Hindenburg gab das ihm überreichte Material am 17. April an Groener weiter, indem er dem Minister einen Brief dazu schrieb:
"Inzwischen ist mir unter Übergabe von Belegmaterial mitgeteilt worden, daß ähnlich geartete Organisationen wie die hier verbotenen auch bei anderen Parteien bestehen. In Erfüllung meiner Pflicht zur überparteilichen Ausübung meines Amtes muß ich verlangen, daß, falls dieses richtig ist, auch diese Organisationen der gleichen Behandlung verfallen." Groener hatte zwar keine besonderen Sympathien für das Reichsbanner. Als dies im Februar 1932 dem Reichsinnenminister seine Dienste als Hilfspolizei anbot, dankte Groener sehr entschieden dafür. Das Reich besitze genügend eigene Machtmittel und brauche keine Unterstützung von privater Seite. Alle derartigen Versuche werde er, der Minister, im Keime ersticken. Jetzt jedoch bewies der Minister der sozialdemokratischen Weltorganisation ein ganz außerordentliches Wohlwollen, das in weiten Kreisen des Volkes ernste Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Worte vom Februar aufkommen ließ. Groener versprach zwar, das übersandte Material eingehend und gewissenhaft zu prüfen, wollte aber dem Reichsbanner durch inoffizielle Fühlungnahme Gelegenheit geben, von sich aus die militärähnlichen Formationen aufzulösen. Der Reichsinnenminister wollte die ganze Sache als er- [213] ledigt betrachten, wenn Höltermann freiwillige Auflösung der Schutzformationen versprach und durchführte. Führende Sozialdemokraten beeilten sich, nachzuweisen, daß ein Verbot des Reichsbanners unnötig, ja unsinnig sei. Der preußische Ministerpräsident Braun ereiferte sich dagegen, daß man die S.A. mit dem Reichsbanner gleichsetzen wollte. Die Gleichstellung einer Organisation, die sich zum Ziele gesetzt habe, den Staat mit Gewalt umzuwandeln, mit einer solchen, die sich zum Schutze des Staates zusammengetan habe, zeige eine völlige Verkennung der Lage. In seinen Wahlreden erklärte er, es wäre eine Verzerrung des Begriffes der Unparteilichkeit, wenn der Reichspräsident Vereinigungen, die in ihrer republikanischen Form wie in ihrer Zweckbestimmung und Tätigkeit auf dem Boden der Verfassung und der Gesetze stehen, ebenso behandeln wolle wie die mit Recht verbotenen Organisationen. Das Reichsbanner habe den republikanischen Parteien erst die Ausübung der in der Verfassung gewährleisteten Versammlungs- und politischen Meinungsfreiheit gesichert, ja, es habe die Wähler Hindenburgs bei der letzten Reichspräsidentenwahl gegen den Terror derer, die ihn beschimpften, geschützt. Höltermann, der Führer des Reichsbanners, sagte mit Emphase, das Reichsbanner habe nicht den Ehrgeiz, eine militärische Organisation zu sein. "Wir bleiben, was wir immer sein wollten, eine freiwillige Organisation, die den Staat verteidigt und für ihn eintritt, wo es nottut." Er gab Befehle an die Unterführer heraus, daß "alle außerordentlichen Schutzmaßnahmen" aufzugeben seien. "Es kommt darauf an, bis in die Reihen unserer Gegner die Überzeugung zu tragen, daß das Reichsbanner nie ein Staat im Staate sein wollte und sein will. Daß wir nie daran gedacht haben und nicht daran denken, gegen Recht und Verfassung unsere Ziele mit Gewalt durchzusetzen." Die "Eiserne Front" löste sich befriedigt in Kegelklubs und Turnvereine auf. Dann rief Groener, bewogen durch seine sozialdemokratischen Ratgeber, Höltermann zu sich und ließ sich von ihm erklären, daß alle Vorwürfe der Gegner unbegründet seien! Aber aus dem Lager der bürgerlichen Parteien verstummte nicht die Forderung nach der Auflösung. Der voll konservative [214] Graf Westarp verlangte die Beseitigung der sozialdemokratischen Privatarmee. Der Volksparteiler Dingeldey meinte: Wenn man mit derselben Energie bei der Eisernen Front, dem Reichsbanner, den Hammerschaften usw. Haussuchungen veranstaltet hätte, würde sich eine Fülle von Material haben finden lassen, mit dem das gleiche Verbot auch nach dieser Richtung hin hätte begründet werden können. Auch verschiedene Länderregierungen forderten das Verbot: Die beiden Mecklenburg, Braunschweig, Thüringen und Sachsen. In diesen Tagen ging Höltermann, infolge der starken sozialdemokratischen Stützpunkte im Innenministerium, wie ein Diktator bei Groener ein und aus. Groener behandelte die ganze Sache mit geflissentlicher Verzögerung. Er reiste nach Süddeutschland, traf sich mit Brüning, der auf der Genfer Abrüstungskonferenz weilte, kam wieder und erklärte, die Entscheidung werde nach der Wahl fallen. Dann empfing er wieder Höltermann, und der war über die Aussprache mit dem Minister tief befriedigt: "Wir bleiben!" Die Reichsbannerangelegenheit wuchs sich zu einem regelrechten Skandal aus. Der Rotterdamer Courant, das größte Blatt Hollands, urteilte:
"Man erlebte das seltsame Schauspiel, daß die Reichsstellen und die preußischen Minister gegen Hindenburgs ehrlichen Willen, unparteiisch das Verbot aller politisch-militärischen Parteiformationen durchzuführen, zu rebellieren beginnen. In jedem Falle sind Reichsbanner und Eiserne Front genau so Kampftruppen in der Politik wie die aufgelöste S.A. Die verschiedenartige Behandlung rechts- und linkspolitischer Privatarmeen in Deutschland kann noch zu ernsten Krisen führen." – Es war, als zeigte sich jetzt, in dem Augenblick, da die Nationalsozialisten ganz dicht an das Staatsruder herangetreten waren, das gewalttätige Wesen der Demokratie in seiner ganzen Nacktheit. Die Ungerechtigkeit im Präsidentschaftswahlkampfe, die Tücken der Preußenregierung, die Ungerechtigkeit beim Verbot militärähnlicher Organisationen enthüllten dem Volke deutlich genug, daß es seine demokratische Freiheit verloren hatte und unter der harten Parteidiktatur von Zentrum und Sozialdemokratie stand, welche durch Preußen und Bayern [215] zum "Staatswillen" geformt und von Groener als "Reichswille" anerkannt war. Das war der entscheidende Schlag, mit dem die herrschende Regierung sich vollends die Sympathien der stets für "Freiheit" eintretenden bürgerlichen Mitte verscherzte und diese zerstörte, beziehungsweise dem Nationalsozialismus in die Arme trieb. Groener, von Severing unterstützt, brachte es durch sein wenig staatsmännisches Benehmen dahin, daß die demokratische Regierungsgewalt auf einen immer kleiner werdenden Kreis beschränkt wurde. Um sich zu behaupten, beging die schwache Demokratie Selbstmord: Ausschaltung des Reichstages, Aufhebung der demokratischen Grundrechte und Einengung der politischen Freiheit, und nun einseitige Gewaltanwendung gegen das nationale junge Deutschland – der Verzweiflungskampf eines seiner inneren Schwäche erliegenden reaktionär-demokratischen Systems. Die Staatsfeinde waren nicht mehr die Nationalsozialisten, sondern diejenigen, die ohne Kenntnis historischer Volksentwicklung und ohne staatsmännische Begabung glaubten, ihre doktrinäre Gewalttätigkeit gegen das national empfindende Volk anwenden zu können. Graf von der Goltz, der Führer der Vereinigten Vaterländischen Verbände, erließ folgende Kundgebung:
"Im Verbot der S.A. erblicken wir die Unfähigkeit des schwarz-roten Parteisystems, die deutsche Freiheitsbewegung in den Dienst des Staates zu stellen, wie es von jeher als Pflicht nationalen Staatswillens galt. Das Verbot entbehrt jeden außenpolitischen Augenmaßes. Es muß als Verbeugung vor der Genfer Abrüstungsmaskerade empfunden werden. Seine Einseitigkeit untergräbt nicht nur das Vertrauen zur Gerechtigkeit, sondern liefert den Staat dem roten Reichsbanner aus, das seinen Lohn fordert. Das Verbot ist ein weiterer Schritt zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen, die sich dadurch mitbetroffen fühlen. Die freiheitsliebenden Deutschen aller Parteien fordern wir deshalb auf, auf legalem Wege ihre letzte Energie zur Wiedergewinnung eines freien, nationalen Staates einzusetzen."
Hitler fuhr durch Deutschland und sprach vor vielen Hunderttausenden von Menschen. Die größten Säle reichten nicht aus, um alle zu fassen, die Hitlers Name zusammenrief. Zelte wurden vor den Toren der Städte errichtet, oder gar auf großen Plätzen unter freiem Himmel strömten Männer und Frauen zusammen, 60 000, 100 000, noch viel mehr. Diese gewaltigen Volksversammlungen unter den wehenden Hakenkreuzfahnen stehen einzig in der Weltgeschichte da. Als der Führer erschien, reckten sich hunderttausend Hände ihm entgegen, brauste der Ruf der Begeisterung über das weite Feld. So war es überall, wohin der Führer kam, manchmal stand er zwei-, dreimal am Tage vor solchen ungeheuren Versammlungen. Sein Flugzeug wartete schon, ihn nach der nächsten Stadt zu bringen. Schlicht und natürlich trat Hitler auf, und dieses Auftreten eroberte sofort die Herzen derer, die ihn noch nicht kannten. Er sprach ruhig, beherrscht, ohne Pathos, sehr nüchtern. Die Größe seines Strebens ward nicht durch kleinlichen Haß verdunkelt. Er schimpfte nicht. Er sagte nur: "Seht, das hat das heutige System vor dreizehn Jahren versprochen, und das hat es geleistet." Er entwickelte kein Programm. Er machte keine Versprechungen. Er hämmerte immer nur den einen lapidaren Satz: "Deutschland muß gerettet werden!" Er verbreitete nicht ausschweifende Siegeshoffnungen, sondern er sagte: "Es ist möglich, daß wir nicht siegen, aber es ist nötig, daß wir weiter kämpfen!" Er rühmte sich nicht des Dreizehn-Millionen-Heeres, das hinter ihm stand, sondern er bezeichnete es als das Wertvolle, daß es ihm gelungen sei, alle deutschen Volksschichten, Berufe und Stände in seiner Bewegung zu vereinigen: Geistes- und Handarbeiter, Bauern und Kaufleute und Handwerker. Das war ja eben das Neue, das Große: "Nur in der Dreieinigkeit von Geist, Faust und Bauerntum liegt die Zukunft Deutschlands." Vor allem leuchtete aus seinen Worten ein un- [217] bezwingbarer Wille. "Sie können uns weiter unterdrücken, sie können uns weiter verbieten, aber eines werden sie nie erreichen, daß ich kapituliere!" "Das Ziel heißt Deutschland. Es ist gleichgültig, wie der Kampf ausgeht. Wesentlich ist nur, daß wir niemals das Ziel verlieren!" Es waren nicht die Worte, von denen die Kraft der Überzeugung ausging, sondern es war die Persönlichkeit des Mannes, der alle in seinen Bann riß und an sich kettete. Auch Hugenberg und seine Getreuen versammelten das Volk um sich. Aber seine Kampftaktik wurde doch in den eigenen Reihen oft recht mißtrauisch betrachtet: er kämpfte nach zwei Fronten, gegen den Marxismus und gegen den Nationalsozialismus. Im übrigen betonte die Deutschnationale Volkspartei in ihren Kandidatenlisten nur allzu sehr ihre enge Verbindung mit dem Stahlhelm: die aufgestellten Kandidaten wurden ausdrücklich als Mitglieder oder Führer des Stahlhelms bezeichnet. Die enge Verbindung zwischen der Partei und dem Bund der Frontsoldaten erwies sich so der Öffentlichkeit. Die sterbende Demokratie pries sich als die Auslese der Vernunft und Besonnenheit. Wehklagend warnte sie vor den Gefahren des "Radikalismus". Die Demokratische Partei, die mit allen Kräften in den letzten Monaten mitgeholfen hatte, die deutsche Freiheit mit Knüppeln totzuschlagen, appellierte an den "Freiheitssinn des deutschen Bürgertums", den sie zu schützen vorgab. Aber kein Mensch glaubte mehr diese Lügen. Die einzige Propaganda der Sozialdemokratie bestand in einer maßlosen, von Lüge und Verleumdung erfüllten Hetze gegen die Nationalsozialisten. Diese Partei, zu welcher sich Minister und Oberpräsidenten zählten, nahm die Maske vom Gesicht und enthüllte sich als eine Kulturschande für das deutsche Volk. In Millionen und Abermillionen Exemplaren verbreitete sie unflätige und schamlose Flugblätter, und unter diesen unanständigen Sudeleien stand dann: "Wählt Braun-Severing!" Die Kommunisten verlegten den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Straße. Die Agitatoren folgten den Weisungen der [218] Moskauer, sie sammelten mitten im Strudel des Großstadtverkehrs kleine Debattierklubs um sich und priesen die Herrlichkeit der kommunistischen Herrschaft.
Am 24. April fielen die Würfel. Er brachte durch ein gewaltiges Anschwellen des Nationalsozialismus den Untergang der demokratischen Parlaments- und Mehrheitsherrschaft. Zwar gelang es, durch das Versagen der Deutschnationalen, der nationalen Opposition nicht, die absolute Mehrheit zu erringen, aber die Sozialdemokratie erlitt schwere Verluste, und die bürgerliche Mitte wurde fast gänzlich aufgerieben. Das Ergebnis war, in Millionen Stimmen, folgendes:
In Anhalt machte die nationale Opposition, bestehend aus 15 Nationalsozialisten und 2 Deutschnationalen, 47,2 Prozent aus. Die 12 Sozialdemokraten und der eine Staatsparteiler machten 36,1 Prozent, die 3 Kommunisten 8,3 Prozent aus. Hinzu kommen noch 2 Volksparteiler und 1 Hausbesitzer. Die Nationalsozialisten hatten gegen 1928 14 Sitze gewonnen, die Sozialdemokratie 3, Staatspartei und Hausbesitzer je 1, die Volkspartei 4 Sitze verloren. Kein Mandat erhielten der Landbund (vorher 4) und die Wirtschaftspartei (vorher 1). Wesentlich ungünstiger war das Hamburger Ergebnis. Hamburg war ja ein Hauptbollwerk der Staatspartei. Immerhin vermochten die Nationalsozialisten gegen den 27. September 1931 ihre Mandate von 43 auf 51 zu vermehren, mit den 7 Deutschnationalen (früher 9) bildeten sie als nationale Opposition 36,2 Prozent (vorher 32,5). Die 49 Sozialdemokraten, 18 Staatsparteiler und 2 Zentrumsabgeordneten machten 43,1 Prozent aus (vorher 62 Sitze oder 39 Prozent). Den Zuwachs erhielten sie von den Kommunisten, die von 35 auf 26 Sitze oder von 22 Prozent auf 16 Prozent zurückgingen. Volkspartei, Mittelstandspartei und Christlich-Soziale hatten insgesamt 4 Mandate eingebüßt, sie hatten zusammen 9 Sitze. In Bayern hatten die Nationalsozialisten 43 Sitze, also ihre 9 Mandate von 1928 fast verfünffacht. Aber die Deutschnatio- [220] nalen hatten 10 verloren: sie verfügten nur noch über 3. Die nationale Opposition hatte jetzt 40 Prozent aller Mandate inne. Die Kommunisten zählten 8 Sitze, sie hatten 3 gewonnen; sie machten im neuen Landtag 6 Prozent aus. Die Bayrische Volkspartei hatte nur 1 Sitz eingebüßt: sie verfügte über 45 Mandate oder 35 Prozent. Aber die Sozialdemokratie war von 34 auf 20 zurückgegangen. Hatte sie vorher 26,5 Prozent, so konnte sie diesmal nur 15,6 Prozent aller Sitze beanspruchen. Der Bayrische Bauernbund hatte von seinen letzten 17 Sitzen 8 verloren, die Deutsche Volkspartei, die vordem 4 Mandate hatte, errang diesmal nicht ein einziges! Ähnlich war es in Württemberg: von 21 Sozialdemokraten zogen nur 12, von 8 Staatsparteilern nur 3 wieder ins Parlament ein. Die demokratische Front war von 36,2 Prozent auf 20,2 Prozent gesunken. Das Zentrum behauptete sich mit 16 Sitzen (21,6 Prozent). Die Nationalsozialisten, die vorher nur einen Sitz hatten, verfügten jetzt über deren 20, während die Deutschnationalen von ihren 4 Sitzen 1 verloren hatten. Die nationale Opposition hatte also jetzt 31 Prozent der Mandate inne. Die Kommunisten hatten mit ihren 7 Mandaten nur 1 neues erobert (9,5 Prozent). Auch hier hatte die vielgestaltige bürgerliche Mitte – 8 Bauern und Weingärtner, 1 Volksparteiler, 1 Volksrechtparteiler und 3 Christlich-Soziale – fast die Hälfte ihrer ehemaligen Gesamtmandate (24) eingebüßt. Immerhin verfügte sie noch über 17,5 Prozent der Parlamentssitze und konnte so das Zünglein an der Waage zwischen dem nationalen Block und der Mitte bilden.
Das jedenfalls war das große geschichtliche Ergebnis der Länderwahlen vom 24. April 1932: im sieghaften Erobern hatte der nationale Sozialismus von den Deutschnationalen bis zu den Sozialdemokraten das alte Parteigefüge zerschmettert. Auf dem weiten Trümmerfelde erhob sich nur noch der Zentrumsturm, dessen zuverlässigstes Fundament die Frauen waren. In Westdeutschland hatte man die Männer und Frauen gesondert abstimmen lassen, dabei ergab sich, daß der prozentuale Anteil der Frauen beim Zentrum am größten war, während die meisten Männer nationalsozialistisch gewählt [221] hatten. Es ist ein interessanter Vergleich, der hier nicht fehlen darf:
Die Sozialdemokratie glich schon einer stark verfallenden Ruine, das war nicht mehr abzustreiten. Die demokratische Ära war überwunden, das Zeitalter des Dritten Reiches zog herauf. Der seltene Fall war wieder eingetreten, daß ein Hohenzollernprinz als nationalsozialistischer Abgeordneter eingezogen war in das Parlament des Staates, den seine Vorfahren ein halbes Jahrtausend regiert hatten: Prinz August Wilhelm. Nur einmal vorher war ein ähnlicher Fall vorgekommen. Im Jahre 1848 war Prinz Wilhelm von Preußen, Bruder des Königs Friedrich Wilhelms IV. und selbst später König, in die preußische Nationalversammlung gewählt worden. Doch machte Prinz Wilhelm nur einmal, am 8. Juni 1848 Gebrauch von seinem Mandat. Der Nationalsozialismus hatte die letzte Etappe erreicht im Kampfe um die Macht. Mit dem Youngplan und seiner Bekämpfung im Herbst 1929 begann das Ringen gegen die internationalen Gewalten der Demokratie, des Zentrums und des Marxismus. Im Anfang 1930 wurde der erste Nationalsozialist, Dr. Frick, Minister in Thüringen. Den weiteren Sieg brachte die Reichstagswahl von 1930. Seit dem 14. September 1930 war der Nationalsozialismus das feste Rückgrat der nationalen Bewegung geworden. Stahlhelm und Deutschnationale Volkspartei schlossen sich an ihn an. Diese Etappe ist gekennzeichnet durch das Volksbegehren und dann den Volksentscheid des Stahlhelms wegen der Auflösung des preußischen Landtages. Den endgültigen Übergang der Führung an den Nationalsozialismus bereitete das kurze Zwischenspiel von Hugenbergs Harzburger Front vor. Die hessischen Landtagswahlen Mitte [222] November erwiesen zum ersten Male, daß der Nationalsozialismus über die demokratischen Parteien das Übergewicht gewonnen hatte. An dieser Entwicklung scheiterte Brünings Versuch, die Reichspräsidentenwahl zu umgehen und Hindenburg durch das Parlament wiederwählen zu lassen. Die Länderwahlen von Ende April forderten nun kategorisch die nationalsozialistische Regierungsweise. Im Ausland wurde das Wahlergebnis verschieden beurteilt. Die Franzosen verbargen ihre Bedrückung hinter der Feststellung, daß Hitler doch noch nicht die absolute Mehrheit erhalten habe. Immerhin gab man zu, daß die nationale Opposition an der Schwelle des endgültigen Sieges stehe. Auch in England erkannte man den großen Schritt vorwärts und sprach davon, daß das Ansehen der Brüning-Regierung untergraben sei. Hitler sei ein bleibender beherrschender Faktor in den deutschen politischen Verhältnissen geworden. Italien war voll Genugtuung, daß nun die Abrechnung mit den Sozialdemokraten erfolgen werde. Polen sprach von einer Gefahr für den Weltfrieden und Abschüttelung der Reparationen. Die Amerikaner waren von der Sorge erfüllt, ob wohl nun die demokratischen Parteien die nötige Kontrolle über die Regierung behalten würden.
Ganz eigentümlich war die Stellung des Zentrums. Vor den Wahlen verhandelte das Zentrum mit den bürgerlichen Splitterparteien der Mitte, der "nationalen Front deutscher Stände", wegen etwaiger Bildung einer Minderheitsregierung, die von Sozialdemokraten und vielleicht sogar Kommunisten geduldet würde. Die Deutsche Volkspartei wurde allerdings nicht in die Verhandlungen einbezogen. Überdies lehnte sie jede Minderheitsregierung ab und forderte schon vor der Wahl eine klare nationale Regierung, die in keinerlei Beziehung zur Sozialdemokratie stehen solle. Vor der Wahl scheuten sich auch nicht die Redner der Zentrumspartei, die Nationalsozialisten als Bolschewisten mit nationalem Vorzeichen zu bezeichnen. Gewiß war es dem Zentrum gelungen, seine Stimmenzahl noch um etwas zu erhöhen. Nach der Wahl aber rückte doch die Möglichkeit bedenklich nahe, daß das Zentrum mit den Nationalsozialisten eine Regierung bilden müsse. Der Vorstand der preußischen Zentrumspartei erließ einen Aufruf, der auf den erheblichen Stimmenzuwachs der Partei hinwies und daraus folgerte, daß das Zentrum die Achse der deutschen Politik bleibe. Die Partei sei bereit, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, die auf der Grundlage der Verfassung dem Wohle des gesamten Volkes zu dienen entschlossen seien. Die Zentrumsfraktion werde sich auch fürderhin mit aller Kraft Bestrebungen widersetzen, die Staat und Verwaltung einer einseitigen Parteidiktatur ausliefern wollen. Gleichzeitig erklärte man, Aufgabe der Rechtsgruppen sei es nun, zu erklären, ob sie weiterhin in ihrer Opposition verharren oder ihre negative Opposition aufgeben wollten und voll auf dem Boden der Verfassung zur positiven Mitarbeit bereit seien. Immerhin hatte durch das Wahlergebnis der rechte, nationale, von Herrn von Papen geführte Flügel an Einfluß gewonnen. Ein Kurswechsel in der bisher stark links orientierten Zentrumspolitik bahnte sich an, der sich durch einen Rücktritt des bisherigen Germaniahauptschriftleiters ankündigte. Herr von Papen, der [224] Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende der Germania, war bemüht, das Steuer der Partei nach rechts zu drehen.
Das war der Gang der Dinge: Die Deutschnationalen waren im Wirbel des katastrophalen Zusammenbruchs mitgerissen worden. Sie kamen als Machtfaktor nicht mehr in Frage. Von den Koalitionsparteien stand nur noch das Zentrum aufrecht. Deutschnationale, Deutsche Volkspartei, bürgerliche Mitte, Staatspartei, Sozialdemokratie,
Kommunisten – sie alle hatte der Nationalsozialismus zerrieben oder geschwächt. Nur das Zentrum war noch da. Und nun ward dem Nationalsozialismus die letzte und schwerste Aufgabe gestellt, sich mit dem Zentrum auseinanderzusetzen. Drei Möglichkeiten gab es da: Die Gewalt, wie einst Mussolini den Faschismus ins Regiment einsetzte; aber dieser Weg schaltete von vornherein aus nach den Erfahrungen von 1923; die zweite Möglichkeit war, zu warten, bis die Freiheitsbewegung bei einer kommenden Wahl die absolute Mehrheit erhielt; dieser Weg war legal, er war außerdem der sicherste, aber er setzte Selbstbeherrschung und Mäßigung voraus, man mußte sich einrichten, noch einige Zeit zu warten; die dritte Möglichkeit war die, mit dem Zentrum eine Koalition einzugehen und die Regierung in die Hand zu nehmen; dieser Weg war der schwierigste, denn er war nicht nur von der Gefahr bedroht, einen Teil der Grundsätze, wenn auch nur vorübergehend, zu opfern und das Vertrauen der Anhänger zu erschüttern, sondern er enthielt auch die Forderung der friedlichen Überwindung des Zentrums durch die Zusammenarbeit mit ihm. Der dritte Weg mußte aber nach reiflicher Überlegung abgelehnt werden, denn die Hitlerbewegung durfte an keiner Koalition teilnehmen, dadurch würde sie zum Teilhaber des Systems werden, das sie bis auf den Tod bekämpfte. So blieb dem Nationalsozialismus kein anderer Weg als der
zweite. – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||