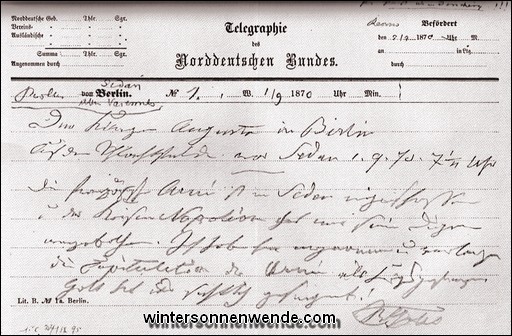|
[Bd. 3 S. 370]

Das Schicksal hat Wilhelm I. auf einen Platz von entscheidender Bedeutung gestellt. Die Aufgaben, die es ihm zu lösen aufgab, hat er erfüllt; er bestand seine Lebensprobe. Als er ein Kind war, lag Deutschland in hoffnungsloser Entmannung am Boden; als sich sein Leben endete, betrauerte es in ihm das Symbol seiner Größe und Einheit.
 Am 22. März 1797, noch unter der Regierung Friedrich Wilhelms II., wurde Prinz Wilhelm geboren. Seine erste Kindheit fiel in die stillen Regierungsjahre seines Vaters, der im November 1797 den Thron bestieg. Unter der Hut der Mutter floß sie dahin, unberührt von der fortschreitenden Auflösung des friderizianischen Staates, dessen Machtstellung versank. Ein schönes Familienleben von äußerlich anspruchslosem Zuschnitt umhegte die Jugend des Prinzen und seiner Geschwister. Hinter den Familienkreis, dessen Mittelpunkt die reiche und hochgestimmte Königin Luise war, trat für die Kinder der Hof weit in den Hintergrund. Wurde der Kronprinz Friedrich Wilhelm von der Mutter früh als problematische Natur erkannt und umsorgt, so war sie über die ruhige Entwicklung des Prinzen Wilhelm ohne alle Ungewißheit. Schon als Kind war er von der schlichten und eindeutigen Haltung, die sein Wesen auszeichnet. Das Schicksal des preußischen Staates, der bei Jena unter den Schlägen Napoleons zusammensank, störte jäh die Stille dieser Jugend und zwang zur Flucht nach Königsberg und Memel. Die Eindrücke dieser Jahre blieben in des Prinzen Denken und Fühlen unauslöschlich eingegraben: die Niederlage, die Fremdherrschaft und das verehrungswürdige Heldentum der Mutter, das ihm zeitlebens als Beispiel vorleuchtete. [371] Als die königliche Familie um Weihnachten 1809 nach Berlin zurückkehrte, zählte Wilhelm dreizehn Jahre. Bald traf die königliche Familie neues Unglück. Am 19. Juli 1810 stand Prinz Wilhelm mit dem Vater und dem älteren Bruder am Sterbebett der Mutter. Von der Liebe seiner Mutter blieb seiner Jugend nur mehr eine kostbare Erinnerung. Nicht lange währte die Ruhepause, die dem preußischen Staat vergönnt war. Napoleons Niederlage in Rußland führte Preußen an dessen Seite. Den Prinzen lockte die Vergeltung. Aber wegen seiner körperlichen Schwächlichkeit durfte er erst am Winterfeldzug 1813/1814 teilnehmen. Sechzehnjährig begleitete er die siegreichen Truppen in Frankreich und erlebte stolz im Gefecht von Bar-sur-Aube seine Feuertaufe. Die Rückkehr Napoleons von Elba bringt ihm von neuem die Teilnahme am Feldzuge. Vorher war er in der Schloßkapelle zu Charlottenburg eingesegnet worden. Mit schlichter Selbstverständlichkeit legte er das Bekenntnis seines Glaubens ab. Zweifel an seinem Gott hat er sein Leben hindurch nicht gekannt. Erziehung und Ausbildung galten jetzt als beendet. Fortan stand sein Leben im Dienst der Armee. Die Erlebnisse und Erfahrungen seiner Kindheit hatten ihn reifer gemacht, als die bloße Spanne der Jahre es erwarten ließ. Es war damit ein gewichtiges Pfund in seine Hand gelegt, das er ernst und treu verwaltete. Die Höhe des Menschentums, die er in seinem Leben sich gewinnen sollte, ruhte auf einem festen Grunde.
 Prinz Wilhelm sollte zum ersten Soldaten Preußens erzogen werden. Seine Stellung in der Familie, seine Stellung im Staate wies ihm diese Rolle zu. Er selber fand in ihr vollste Befriedigung; sie entsprach seinen Neigungen und seinen Fähigkeiten. Seit er als Knabe in die Armee aufgenommen worden war, hat er rasch die Stufenleiter der militärischen Grade durchlaufen. Den Pflichten seiner Ämter gab er sich mit Eifer und Beharrlichkeit hin. Gleichmäßig war sein Interesse für die Einzelheiten des praktischen Dienstes und für die Gesamtheit der Armee und für ihre Stellung im Rahmen des Staates. Als er älter wurde, wandte sich sein Blick auch den politischen Dingen zu, denen er lange gänzlich ferngestanden hatte. Das dritte Jahrzehnt ist in seiner zweiten Hälfte erfüllt von den Hoffnungen und Enttäuschungen einer tiefen Liebe. Die Liebe des Prinzen Wilhelm zu Elisa Radziwill hat von allen seinen Erfahrungen sein Innerstes zutiefst und am nachhaltigsten aufgerührt. Niemals hat sonst sein von Natur so gefestigtes Gleichgewicht ähnliche Erschütterungen zu bestehen gehabt als in den Verwicklungen dieser Liebe. Ihre Erfüllung wurde durch das sachliche Recht der Krone verhindert, nachdem die unentschlossene Bereitwilligkeit eines im Grunde gütigen und wohlwollenden Vaters sie hatte nahe erscheinen lassen. Das kühle Temperament des Prinzen aber [372] sicherte ihn vor Zerwürfnis und offenem Konflikt. Er gehorchte dem Willen des Königs und unterwarf sich. Er war nicht der Mensch, an den Nöten einer Herzenstragödie zu scheitern; die pathetische Rolle eines Stiefkindes des Schicksals konnte er nicht spielen. Die Prinzessinnenschau, der er sich auf Wunsch seiner Familie bald nach der Lösung von Elisa unterziehen mußte, war ihm zuwider. Doch er fügte sich auch da. Im Sommer 1829 vermählte er sich mit Augusta von Weimar, der Enkelin Karl Augusts. Die frühen Jahre seiner Ehe brachten ihm häusliches Glück. Die beiden Kinder, die ihm Augusta schenkte, bereicherten es. Aber der Schwerpunkt seines Lebens lag auch in dieser Zeit in ihm selber, mehr noch: in seiner Pflicht, in seinem Beruf, den er verkörperte.
Für den Sohn des Königs war es selbstverständlich, daß sein Leben nicht auf den militärischen Dienst beschränkt blieb, mochte dieser noch so sehr im Vordergrunde stehen. Er war notwendig mit der politischen Welt des Hofes verbunden und erlebte die politischen Ereignisse nicht nur als Soldat, sondern auch als preußischer Prinz. Daß er ohne Einschränkung Monarchist war, versteht sich für ihn von selbst. Aber wir sehen keine Berührung mit dem romantisch-ständischen Ideenkreis seines geistreichen Bruders Friedrich Wilhelm und dessen Getreuen. Er war eine viel zu praktisch-nüchterne Natur, als daß er seine Anschauungen von einer Idee her bestimmen ließ. Er blieb eng auf dem festeren Boden der nahen Wirklichkeit. Das war in mancher Hinsicht ein Mangel. Aber eine solche Veranlagung gestattete ihm einen freien, unvoreingenommenen Blick in die politischen Zusammenhänge. Nur so konnte er, wie es sein Leben erforderte, ohne Bruch veränderte Wirklichkeiten anerkennen und auf ihnen weiter bauen. Friedrich Wilhelm war nach dem Erlebnis von 1848 im Grunde ein gebrochener Mann. Sein Bruder hat es vermocht, diese und spätere tiefgreifende Umbildungen der politischen Situation zu ertragen. Denn er sah in allem die gemeinsame Grundtatsache, auf die allein es ihm ankam. Das war der preußische Staat. Der Gedanke der preußischen Großmacht stand ihm immer und in allem vor der Seele, verschleiert vielleicht einmal und mit verminderter Bestimmtheit, aber nie ausgelöscht und immer von neuem wirksam. Von dieser Grundlage aus will sein Wirken für die preußische Armee verstanden sein. Mehr als der inneren Politik wandte sich sein Interesse den Fragen der auswärtigen Politik zu. Der Tradition des Hauses entsprach es, daß er der Freundschaft mit den Staaten der Heiligen Allianz größere Bedeutung beimaß, als sich vielleicht mit seinem preußischen Selbstbewußtsein vertrug. Namentlich nach der Julirevolution von 1830 schien ihm monarchische Solidarität gegen den Ansturm der Revolution das erste Gebot der Politik, so daß er in jenen Jahren nicht wesentlich verschieden war von einem doktrinären Legitimisten. Bei einem vierzigjährigen Manne, das war er am Ende der Regierungszeit Friedrich Wilhelms III., konnte man seine politische Entwicklung als abgeschlossen [373] betrachten. In ihm selber lagen keine Notwendigkeiten zu einer Umkehr. Aber die Ereignisse haben ihn in den kommenden Jahrzehnten seines langen Lebens noch mehrmals gezwungen, sich mit neuen politischen Situationen auseinanderzusetzen.
 Als Friedrich Wilhelm III. gestorben war, wurde Prinz Wilhelm von seinem königlichen Bruder, nach Friedrichs des Großen Vorbild, zum "Prinzen von Preußen" ernannt. Da die Ehe Friedrich Wilhelms IV. mit Elisabeth von Bayern kinderlos geblieben war, war er der mutmaßliche Thronfolger in Preußen und deshalb berufen, über seinen bisherigen Wirkungskreis hinaus eine Stellung im politischen Leben des Staates einzunehmen. Friedrich Wilhelm IV. ernannte ihn zum Vorsitzenden des Staatsministeriums. In amtlicher Eigenschaft eröffnete sich ihm ein weiter Bezirk des staatlichen Lebens. Da er aus innerstem Beruf Soldat war, verzichtete er nicht auf seine militärischen Ämter, sondern vermehrte sie. Er war Kommandeur des Gardekorps und Leiter zahlreicher militärischer Kommissionen, deren Arbeiten er sich nach wie vor mit hingebendem Interesse zugewandt hielt. Auf das politische Gebiet hinüber spielten Auseinandersetzungen mit dem wiederberufenen Kriegsminister Boyen über die Landwehr und ihre Stellung zur Armee, die er, anders als der Reformer Boyen, rein militärisch ansah und regeln wollte. Unter den politischen Fragen, die der Lösung harrten, nahmen die Verfassungspläne Friedrich Wilhelms IV. die erste Stelle ein. Prinz Wilhelm hatte sich gewöhnt, [374] in der Regierungsweise seines Vaters den Gipfel der Staatsweisheit zu sehen. Der staatliche Zustand seines Preußen erschien ihm keiner Änderung bedürftig. Deshalb wies er die von mittelalterlichen Gedanken durchsetzten romantischen Pläne des Bruders ebenso weit von sich, wie er die Ansprüche einer liberalen Opposition für unerträglich hielt. Das Verfassungsversprechen Friedrich Wilhelms III. von 1815 galt ihm durch die bestehende Einrichtung der Provinziallandtage erfüllt, jeder Weiterbau überflüssig und gefährlich. So mußte er als Warner den Plänen des Königs begegnen. In seinen Briefen klingt erregt und grollend die Unzufriedenheit auf. Er wich dann doch vor dem König und seinen Ratgebern im Ministerium zurück und setzte seinen Namen unter das königliche Dekret, das die Einberufung des Vereinigten Landtages ankündigte. Friedrich Wilhelm IV. selbst hatte sich erst nach vielem Schwanken und Zögern zur Einberufung des Vereinigten Landtages entschlossen. Nur die dringende Notwendigkeit, staatliche Aufgaben zu erfüllen, wie sie die wirtschaftliche Entwicklung im Bau von Eisenbahnen und anderen Verkehrsanlagen stellte, zwang ihn, auf die Stände zurückzugreifen. Aber die Halbheit des Königs sollte sein Werk zum Scheitern verdammen. Er wollte den Vertretern des Volkes nicht die Rechte einräumen, die sie verlangen mußten: die Periodizität ihrer Sitzungen, die Aufsicht auf den Staatshaushalt, die Aufhebung der Ausschüsse. So gingen die Kämpfe des Vereinigten Landtages ohne Ergebnis zu Ende. Der Prinz von Preußen stand zur Krone. Der Widerspruch der Volksvertretung gegen den königlichen Willen bedeutete ihm nur Ungehorsam. Das Hin und Her löste das Jahr 1848. Die Revolution, wieder ausgehend vom alten Herd des Aufruhrs, Paris, drängte zu Entschlüssen. In der Nacht vom 17. zum 18. März rang sich Friedrich Wilhelm IV. die volle Zusicherung einer Konstitution ab. Auch der Prinz von Preußen gab seine Unterschrift her. Aber es war zu spät. Die Dämme der Gesetzlichkeit waren auch in Berlin nicht mehr zu erhalten. Es folgte die Unterwerfung der Krone. Der Prinz von Preußen erlebte sie in England, wohin ihn die Wut des Volkes und die Rücksicht auf den König trieben. Das Volk fühlte mit sicherem Instinkt, daß er seinen Wünschen entgegenstand; freilich hatte es seinen Einfluß gewaltig überschätzt. Der nationale Schwung, der diese Revolution des Jahres 1848 durchbebte, hat dann selbst den Prinzen mitgerissen. Er war bereit, für Deutschland Preußen zu opfern, ähnlich wie sein Bruder, der Preußen in Deutschland aufgehen lassen wollte. Unter diesem Eindruck hieß er das Programm der Frankfurter Paulskirche gut und ertrug auch die preußische Konstitution. Sein Preußenstolz fand eine Brücke zur Zukunft in dem offenbaren Vortritt Preußens an Deutschlands Spitze – denn Österreich lag zertrümmert am Boden. Prinz Wilhelm wollte den König von Preußen als Kaiser sehen. Aber die verfassungsmäßige Stellung, die dieser Kaiserkrone in Frankfurt dann gewährt wurde, genügte auch ihm nicht, und so billigte er ihre Ablehnung [375] durch Friedrich Wilhelm durchaus. Die Ansprüche der Revolution waren ihm verhaßt. Er hatte die Genugtuung, in der Pfalz und in Baden ihr neues Aufflackern ersticken zu können. Von der Zustimmung seiner Londoner Tage war er weit abgerückt. Geblieben aber war die Erkenntnis: nicht Österreich, nur Preußen kann die deutsche Einheit bringen. So stellte er sich bis zum letzten Augenblick hinter Radowitz' und Friedrich Wilhelms IV. Unionspolitik. Schmerzerfüllt hat er dann die Tage von Olmütz erlebt, die alle preußischen Hoffnungen begruben. Vor Rußland und Österreich wich Preußen zurück. Er litt unter der Niederlage, die er bereit gewesen ist, mit dem Schwerte zu hindern, aber er war kühl und sachlich genug, die Dinge zu nehmen wie sie waren. Er versank nicht in unfruchtbare Verbitterung, wenn er sich auch in den nächsten Jahren von der amtlichen Politik fernhielt, die jetzt auf selbständige Regungen verzichtete. Österreich herrschte wieder in Deutschland. Als ihm der Vorsitz im wiederzuerrichtenden Staatsrat angeboten wurde, lehnte Prinz Wilhelm ihn ab. Er blieb, was er seit der Revolution war, Gouverneur der Rheinlande und Westfalens. Wesentlich ist, daß er die preußische Wirtschaftspolitik in ihrer politischen Bedeutung erkannt hat. Den Zollverein wollte er gegen Österreich, das dessen Wirkung durch den eigenen Eintritt aufheben wollte, verteidigt wissen. Er sah in einer Angliederung Österreichs an den Wirtschaftsbund eine wirtschaftliche Unmöglichkeit; aber die Frage des Zollvereins war ihm auch eine Frage der Ehre. Erregten Anteil hat er genommen an dem großen Ereignis des Jahrzehnts nach der Revolution, an dem Krimkrieg. Er ist von weittragender Bedeutung gewesen für des Prinzen politische Formung. Er war zwar von seinem Vater her gewohnt, mit den Augen des Freundes auf Rußland zu sehen, auf das mächtige, ehrwürdige Rußland, das einst an der Befreiung Preußens mitgeholfen hatte. In der Beurteilung des Krimkrieges aber hat Prinz Wilhelm sich nicht von solchen gefühlsmäßigen Bindungen leiten lassen. Er nahm allein das Interesse Preußens als Maßstab, das er im Lager der Westmächte sah. In dieser Frage stand er in Opposition zur Politik seines Bruders; er kam in die Opposition schlechthin. Notwendig war er dadurch in Berührung gekommen mit der liberalen Parlamentsopposition, auch wenn der äußeren Gemeinsamkeit verschiedenartige Motive zugrunde lagen. Er, der 1830 keinen Orleans auf dem Thron Frankreichs hatte dulden wollen, hatte 1852 den Staatsstreich Louis Napoleons anerkennen können. Das war namentlich der Einfluß seiner Gemahlin und ihrer liberalen Freunde. Die Selbständigkeit seiner Haltung gegen die Politik der Krone war in gewissem Sinne eine Abhängigkeit von dem Ideenkreis des "Koblenzer Hofes", dem er verfallen war, nachdem er in Berlin den Rückhalt verloren hatte. Völlig zugehörig wird er diesem Kreise nicht gewesen sein, aber er argumentierte auf seine Art und stimmte praktisch mit ihm überein, und von jenem konservativen Legitimismus, der ihn beim Tode des Vaters umfangen gehalten hatte, war er weit abgerückt. [376] Die Russenfreunde des Hofes aber, die Gerlach und Genossen, bekämpften ihn deshalb aufs heftigste und suchten die Männer, die in seinem Sinne wirkten, aus der Regierung und ihrem Amtskreis zu beseitigen. Tief gekränkt verließ der Prinz Berlin, um auch äußerlich kundzutun, daß er an der Politik des Hofes, die das ganze Volk mißbilligte, keinen Teil hatte. Die persönliche Differenz mit dem Bruder war zwar bald beseitigt, aber der sachliche Gegensatz blieb bestehen. Er trat nicht wieder zurück an die Seite des Königs und seiner Freunde. Nur in einem hatte er sich durch seine politische Umorientierung nicht beirren lassen. Das war seine Stellung zur Armee. Stand er auch politisch im Gegensatz zur Regierung, so blieben seine Arbeit und sein Eifer für die Armee gleich hingebend. Und es wurde ihm in diesen Jahren der Enttäuschungen die Genugtuung, das Ziel erreicht zu sehen, für das er ununterbrochen gewirkt hatte. Die volle Durchführung der dreijährigen Dienstzeit war möglich geworden. An der Überzeugung von ihrer Notwendigkeit hatte die Berührung mit dem Liberalismus des Koblenzer Kreises nicht zu rütteln vermocht. Der als Vierzigjähriger am Ende einer Entwicklung angelangt schien, stand jetzt als Sechzigjähriger auf gänzlich anderem Boden. Er war nicht stehengeblieben. Er hatte der jungen Zeit einen Schritt nachgetan. Auch weiterhin sollte er sich jünger erweisen, als er sich selber glaubte. Er nannte sich einen Greis und hielt sein Leben für abgeschlossen. Von der Zukunft, deren Inhalt er spüren mochte, erwartete er vieles für seine Kinder, nichts mehr für sich. Das Schicksal wollte es anders.
 Während eines Aufenthaltes am sächsischen Hofe im Juli 1857 war Friedrich Wilhelm IV. von einem Schlaganfall betroffen worden, dessen zweimalige Wiederholung während der nächsten Monate ihm die Führung der Regierungsgeschäfte unmöglich machte. Der Prinz von Preußen mußte mit der Stellvertretung beauftragt werden. Da keine Aussicht bestand, daß der Zustand des Königs sich jemals endgültig besserte, erhob sich bald die Notwendigkeit, für die bloße Stellvertretung die vollverantwortliche Regentschaft eintreten zu lassen. Aber erst nach dreimaliger Erneuerung der auf je drei Monate sich erstreckenden Stellvertretung hat der Prinz zu der verfassungsmäßig notwendigen Regelung sich verstanden. Schwer spürte er die Last der Verantwortung, die er übernahm. Am 7. Oktober 1858 hat Friedrich Wilhelm IV. die Urkunde unterzeichnet, die den Bruder zum Regenten in Preußen bestellte. Es konnte nicht zweifelhaft sein, daß der Prinzregent, der seit einer Reihe von Jahren in vielen Fragen von Belang der alten Regierung oppositionell gegenübergestanden hatte, der preußischen Politik eine andere Richtung vorschreiben würde. Das Ministerium des Freiherrn von Manteuffel, das er so lange geduldet hatte, fiel. Die neuen Männer gehörten zumeist der Partei des "Koblenzer Hofes" an. [377] Der Einfluß der Prinzessin Augusta bei der Bildung des Ministeriums war deutlich sichtbar. In den feindlich gesinnten Kreisen des alten Hofes und des konservativen Adels sprach man wohl von dem "Ministerium der Prinzessin". Die Öffentlichkeit jedoch begrüßte es als das der "Neuen Ära". Das Ende der Reaktion schien endlich gekommen. Aber der Prinzregent hatte sich so viel Selbständigkeit bewahrt, daß er dem Ministerium mit einem eigenen Programm entgegentreten konnte. Es hatte wohl Raum für liberalen Ausbau des Staates, im Grunde aber war es das Zeugnis einer gemäßigt konservativen Gesinnung: Durchführung der Verfassung, aber Behauptung der monarchischen Rechte. Doch in Verbindung mit dem praktischen Verhalten des Regenten bei der Kabinettsbildung verhieß dieser Regierungsbeginn die Erfüllung der Hoffnungen, die auf ihn gesetzt waren. Nicht lange nach der Übernahme der Regentschaft sah sich der Prinz vor eine schwere Entscheidung gestellt. Um italienischer Angelegenheiten willen erhoben Frankreich und Österreich gegeneinander die Waffen. Österreich verlangte Preußens Hilfe. Unter der Parole: der Rhein müsse am Po verteidigt werden, suchte es Preußen seinem Interesse dienstbar zu machen, aber der Prinzregent hatte keine Neigung, mit den preußischen Waffen die österreichische Vormacht in Italien zu schützen. Er behauptete seine ablehnende Haltung auch vor der Forderung des kriegslustigen Patriotismus in allen deutschen Landen. Dagegen war er bereit, für die Unversehrtheit des Bundesgebietes mit allen Machtmitteln seines Staates einzutreten. Er begehrte dafür den Oberbefehl über alle nichtösterreichischen Bundestruppen. Österreich aber, in blinder Eifersucht, wollte ihn nur als Bundesfeldherrn unter der Aufsicht des Bundestages zum Verbündeten. Anstatt die angebotene Hilfe Preußens anzunehmen, streckte Österreich vor den siegreichen Franzosen die Waffen und schloß einen Frieden, für den es eine Provinz hergeben mußte. Als den Schuldigen für diesen Frieden mühte es sich den Prinzregenten hinzustellen. Wilhelm hat die Vorwürfe Österreichs zurückgewiesen. Er war völlig überzeugt von der Rechtlichkeit seiner Politik; wie niemals sonst beruhte sie ohne Einschränkung auf eigener Erkenntnis und auf eigenem Wollen. Die nächste Zeit bewies es, daß die Verdächtigung, er habe durch sein Verhalten den Deutschen Bund sprengen wollen, unbegründet war. Seine Politik ging vielmehr auf dessen Stärkung hinaus. Freilich eine Stärkung, die dem preußischen Egoismus Spielraum gewährte. Er machte die Anerkennung der Gleichberechtigung Preußens neben Österreich zur Voraussetzung. Da er mit militärischen Augen sah, zielte er auf eine Reform des Bundesheeres ab, dessen Schwäche im italienischen Kriege von neuem sichtbar geworden war. Er hielt einen militärischen Dualismus der beiden Großmächte für die beste Gewähr. Die politischen Auswirkungen dieses Programms überblickte er wohl nicht in voller Konsequenz. Er wollte damit ganz im Rahmen des alten Bundes bleiben. So sehr er ein Gefühl für den preußischen Gegensatz zu Österreich hatte, die Kühnheit des [378] Gedankens einer Lösung der Rivalität zugunsten des deutschen Volkes auf gesamtdeutschem und auf europäischem Boden hat er nicht besessen. Er sah weder die Möglichkeit noch suchte er sie zu schaffen. Zu sehr stand er im Banne der Bundesordnung, als daß er imstande gewesen wäre, sich von ihrem Boden zu erheben, obwohl er preußischen Ehrgeiz genug besaß. Die Befürchtungen, Preußen werde alle deutschen Länder verschlucken – diese von Österreich seit einem Jahrhundert geweckten Befürchtungen –, fanden in der Gesinnung des Prinzregenten keine Stütze. Um ihnen deutlich zu begegnen, trat er Napoleon, der in Baden-Baden eine Begegnung mit ihm erwirkt hatte, inmitten der meisten deutschen Fürsten entgegen. Der Verdacht sollte nicht aufkommen, er paktiere auf deren Kosten mit dem begehrlichen Nachbarn. Ihm kam es darauf an, den deutschen Mitfürsten, als er sie nach Baden lud, seine Friedfertigkeit und Aufrichtigkeit zu zeigen, mochte es nach außen hin auch scheinen, als stehe er an ihrer Spitze. Daß gerade er die Umwälzung der deutschen Staatenordnung durchführen mußte, war in seinem Wesen nicht begründet. Es bedurfte des folgerichtigen Denkens und der entschlosseneren Hand eines anderen, um ihn die Schranken, die seiner Natur gesetzt waren, überwinden zu lassen. Bis er Bismarck an die Spitze seines Ministeriums berief, war er selber durch die Verschärfung der politischen Lage vorangetrieben worden: durch die Gegenaktion der Mittelstaaten, eine Bundesreform anzubahnen, die Preußen in seiner Großmachtstellung matt setzen sollte, und durch Österreichs Streben nach einer Sprengung des preußischen Zollvereins durch den Eintritt seiner Länder. Beides, der Angriff Österreichs und das Vorgehen der Mittelstaaten, traf Wilhelm in seinem preußischen Stolz. Allein von diesem aus konnte er den Aufgaben des nächsten Jahrzehnts entgegenreifen. Ein anderes kam hinzu. Das war die Entwicklung im Innern. Auch hier hatte seine Politik ihren Ausgang genommen von einer militärischen Frage, der Heeresreform: dreijährige Dienstzeit, Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, enge Verbindung von Landwehr und Linie. Von hier aus rollte er die Position auf, in welcher er als der Mann der "Neuen Ära" seine Regierung begonnen hatte. Mehr noch als die Vorgänge der deutschen Politik drängte ihn die Frage der Heeresreform, die zu einer Verfassungsfrage von größter Tragweite wurde, auf sein Altpreußentum zurück, das seines Wesens Kern ausmachte. Nur in den Jahren der Opposition hatten fremde Einflüsse ihn verschleiern können. Sein Ministerium, mit dem er begonnen hatte, zerrieb sich an dieser Frage, die die Kammer zum Prüfstein der Macht erwählte. Krone oder Parlament? Die Militärreform war ihm eine persönliche Sache. Er war in dem Kampf um sie mit seiner ganzen Persönlichkeit beteiligt, nicht nur als Inhaber der Regierungsgewalt. Er führte ihn entschlossen und zäh, aber nach seiner Art doch wieder nur zögernd und Schritt um Schritt. Nach und nach ersetzte er die liberalen [379] Minister durch Männer, die ihm in ihrer Auffassung näherstanden. So gewann er Roon, der ihn stützte und auch im Zweifel und in vorübergehender Schwäche zur Festigkeit anhielt. Die Kammer war ebensowenig zum Nachgeben bereit wie der Prinzregent. Immer geringer wurde die Aussicht auf Verständigung. Es änderte nicht den Gang der Dinge, daß Friedrich Wilhelm IV. starb und der Prinzregent die Krone sich aufs Haupt setzte. Er war jetzt nur noch mehr von seinen Königspflichten durchdrungen, noch unnachgiebiger. Der Konflikt verschärfte sich. Schließlich war niemand mehr da, der an des Königs Seite ausharren wollte. Nur Albrecht von Roon. Der König war zur Abdankung entschlossen. Er hatte schon früher mit diesem Gedanken gespielt. Dann machte er unter dem Einfluß Roons noch einen letzten Versuch, den Kampf weiterzuführen. Er berief Bismarck. Im Bunde mit ihm errang er den Sieg, der für Deutschlands Geschicke bestimmend werden sollte.
 Der Kampf um die Macht der Krone im preußischen Staat, den Wilhelm als Prinzregent zu führen gezwungen wurde, hatte alle Hoffnungen des Volkes zunichte gemacht, mit denen sein Regiment begrüßt worden war. Die "Neue Ära" war bald vergessen. Der Vorwurf eines Frontwechsels aber traf Wilhelm nicht. Er hatte mit uneingeschränkter Ehrlichkeit gehandelt. Er folgte nur seiner Natur, seiner tiefsten Überzeugung, wenn er mit seiner ganzen Kraft die Würde des Königtums zu wahren suchte, als das Parlament ihm seine hauptsächliche Stütze zu entwinden trachtete. Der Angriff auf die Armee traf ihn in seinem Kern: er war wieder, was er im Grunde einzig und allein war, der altpreußische Soldat. Das war zukunftbestimmend für den preußischen Staat und auch für Deutschland: der Grund wurde gelegt für Deutschlands Einigung unter der Führung Preußens. Allein hätte er den Weg, der dahin führte, nicht zu Ende gefunden. Die Grenzen und die Schranken seines Wesens, das sich in diesen Jahren wieder klar herausstellte, mußten überwunden werden durch die Schwungkraft seiner Helfer. Als er Roon gewann, bedeutete das eine Verstärkung und Verfestigung seines Preußentums. Als er Bismarck berief, verknüpfte er sein Schicksal mit dem Manne, der über das Eng-Preußische hinaus ihn der größeren und weiteren deutschen Welt zuführen sollte. Roon war nur Helfer und Freund gewesen, Bismarck wurde mehr: Führer. Keiner von Bismarcks Vorgängern hatte Wilhelm durch seine Fähigkeiten so sehr überragt, daß dadurch auch der Vorsprung seiner königlichen Stellung eingeholt wurde. Bismarck legte ein ganz anderes Gewicht für sich in die Waagschale. Er war in allem ein Überlegener. Zudem hatte er für sich den Umstand, in einem Augenblick größter Hilflosigkeit mutig in die Bresche getreten zu sein. Von vornherein verpflichtete er sich dadurch den König. Und dieser König war kein Jüngling mehr. Es waren schon ein paar Jahre vergangen, seit er sich einen Sechziger nennen mußte, er war fast ein Greis. Die Jahre seiner [380] eigenen und alleinigen Regierung hatten ihn nicht zu einer Überschätzung seiner Fähigkeiten geführt. Jetzt erkannte er dankbar die überlegene Sicherheit seines Ratgebers an und gab die Führerschaft dem Minister, der es freilich nie leicht gehabt hat, des Königs Willen, der immer den Ausschlag geben mußte, für sich zu gewinnen.

Selten ist wohl ein Sieger demütiger und bescheidener gewesen als Wilhelm I. Als er nach den unvergleichlichen Erfolgen des Feldzuges heimkehren konnte, hätte auch der mißgünstigste Beobachter nicht den leisesten Zug von überhebendem Hochmut an ihm gewahren können. Der Stolz, den er mit Recht über den Gewinn des Krieges empfand, berührte nicht im geringsten die ehrwürdige Haltung des greisen Kaisers. Für sich selbst nahm er keine Verdienste in Anspruch. Er schrieb sie seiner Armee und ihren Führern zu und Bismarck, den er in aufrichtiger Dankbarkeit und neidloser Anerkennung durch die Erhebung in den Fürstenstand ehrte. [381] Am 5. Mai 1871 sollte im Opernhaus ein Wagnerkonzert stattfinden, bei dem der Kaiser zu erscheinen zugesagt hatte. Man wollte mit dem Kaisermarsch und einer Hymne auf den Kaiser beginnen. Dem Grafen Waldersee, seinem Adjutanten, sagte er darüber: "Ich kenne so etwas schon und habe mir glücklicherweise die Worte, die man singen will, geben lassen. Lesen Sie mal diesen Unsinn. Es ist natürlich nichts als Lobhudelei, und ich will unter keinen Umständen zugegen sein. Gehen Sie hinüber und arrangieren Sie, daß man zu bestimmter Zeit anfängt. Sagen Sie nur, ich würde wahrscheinlich gar nicht kommen. Sonst wartet man, und das Publikum wird unruhig. Ich richte mich dann so ein, zu erscheinen, wenn das erste Stück vorüber ist." Dem neuen Reiche, das in den Königssälen von Versailles seine feierliche Begründung erlebt hatte, stellten sich mannigfache Aufgaben. Die außenpolitische Situation war durch den Erfolg des Krieges klar. Ernstliche Gefahren drohten dem Reiche nicht. Die Überlegenheit des Bismarckschen Deutschland war allen sichtbar. Im innerpolitischen Ausbau des Reiches dagegen lag eine Fülle von schwierigen Aufgaben. Das Werk des Norddeutschen Bundes war noch unvollendet, und schon forderte die Angliederung des Südens neue Anstrengungen. Wohl war als wertvollste Grundlage das gemeinsame Erlebnis eines siegreichen Krieges da, aber es gab doch Gegensätze zu überbrücken und Unterschiede auszugleichen. Der behutsamen und sicheren Hand Bismarcks und seinem staatsmännischen Geschick gelang es, den Boden zu bereiten. Deutschland wuchs über die Grenzen der Länder hinweg zusammen. Schwieriger war die Abstimmung und der Ausgleich der Parteifaktoren zu zweckvoller Leistung. Das Reich war das Ziel des Liberalismus gewesen. Es war nur natürlich, daß sein Einfluß jetzt vorherrschend wurde – in den Grenzen, die Bismarcks persönliches Gewicht ihm setzte. War es zu erwarten, daß der Kaiser, der durch den preußischen Heeres- und Verfassungskonflikt Seite an Seite mit Bismarck in die schärfste Opposition zum Liberalismus gedrängt war, die Rückkehr zur eigenen liberalisierenden Ära seines Regierungsbeginnes vollzog? War er noch spannkräftig genug, innerlich den Weg zu beschreiten, den die Staatsräson seinen Minister gehen hieß? Es genügte, daß er die Politik der Regierung duldete und persönlich deckte. Er konnte das, weil er Bismarck vertraute. Aber sein Herz blieb dieser Wendung fremd. Gab es doch auch bald nach dem Kriege (1874) etwas wie einen neuen Heereskonflikt mit dem Reichstag, wenn auch in milderen Formen und mit abgeschwächter Heftigkeit. Wieder mußte der Kaiser um sein Heer kämpfen, bis das Parlament das Septennat bewilligte. Für sieben Jahre war die Friedensstärke der deutschen Armee gesichert. Der Kaiser hatte durch ein "Äternat" den Grundbestand des Heeres für immer dem Machtkampf der Parteien entziehen wollen, aber am Ende tröstete er sich: in unseren Tagen sind sieben Jahre fast ein halbes Jahrhundert! Und er erkannte auch versöhnlich an, daß der Reichstag "Pietätsgefühle" gezeigt hatte. [382] In diesem Ringen, das weite Kreise zog, war eines klargeworden: die tiefe Verbundenheit des ganzen Volkes mit seinem Kaiser. Das tat ihm wohl, und er vermerkte es mit Dankbarkeit. Er fühlte, daß er der Mittelpunkt der Nation war. Er konnte es sein, weil er, aufgeschlossener als mancher seiner preußisch-konservativen Getreuen in der Armee, unter dem Gewichte seiner Kaiserwürde nun doch gänzlich ein Deutscher geworden war. Er hatte sein Altpreußentum in das weitere deutsche Gewand kleiden können, auch wenn er diesen Kern unerschütterlich festhielt. Und wiederum: die Durchdringung des Reiches mit altpreußischem Geist und altpreußischer Kraft und Strenge im besten Sinne hatte in seiner lauteren Persönlichkeit eine der wesentlichsten Quellen. Engen inneren Anteil hat er genommen an jener Auseinandersetzung des neuen Deutschland mit dem Katholizismus. Der Kulturkampf, emporgewachsen aus dem entschlossenen Abwehrwillen des Staates gegen übergreifende weltliche Ansprüche Roms, sah den Kaiser, im Gegensatz zu seiner Gemahlin, als Parteigänger. Sein Staatsbewußtsein war empfindlich getroffen. Überdies lebte in ihm ein überzeugtes protestantisches Empfinden, das ihn wohl bis zur Ungerechtigkeit gegen die katholische Kirche führen mochte. Spannungen zwischen Kaiser und Kanzler, die freilich ebensosehr wie von politischen Differenzen von der nervösen Gereiztheit und Ungeduld Bismarcks herrührten, konnten nicht ausbleiben. Denn trotz seines hohen Alters behauptete der Kaiser neben Bismarcks Riesengestalt immer noch zäh und unvermindert seine Geltung. Bismarck konnte in den Jahren nach dem Kriege sogar davon sprechen, er fühle seinen Einfluß auf den Kaiser schwinden, und er hatte oft den Widerspruch und auch den Zorn seines Herren gegen sich. Mehrfach half erst das Druckmittel des Entlassungsgesuches den Widerstand überwinden. Es ist überhaupt wohl so, daß niemals, höchstens in den letzten Jahren des Kaisers, die beiden Männer in völliger innerer Übereinstimmung nebeneinander standen. Bei aller Ergebenheit und Verehrung, die der Kanzler ehrlich und aufrichtig dem Monarchen bewies, blieb es doch deutlich, daß sie von zweierlei Maß waren. Eine Herzensverbundenheit zu gleich und gleich konnte es zwischen ihnen kaum geben. Dem Herzen des Kaisers nahe stand der getreue Roon, der unbeirrbar an dem altpreußischen Konservatismus festgehalten hatte und 1873, der neuen Politik des Reiches abhold und durch Krankheit geschwächt, aus dem Dienste schied. Roon war das eigentliche Gewissen des Königs und Kaisers, wenn dieser sich unter dem Drängen Bismarcks zu weit von sich selber entfernte. Er war sein Warner und Mahner und bedeutete auch rein menschlich für Wilhelm vieles. Als der Kaiser im Februar 1879 an Roons Sterbebett trat, selber noch leidend unter den Nachwirkungen des Nobilingschen Attentates, sind seine Augen naß geworden. Er verlor einen Freund. Das Jahr vorher hatte bittere Erfahrungen für den greisen Herrscher gebracht. Zweimal hob fanatischer Wahnwitz die Waffe gegen das ehrwürdige Haupt [383] Deutschlands. Gottes Hand ließ den Frevel nicht zu. Der Kaiser genas. Er genas nicht nur, er stand von seinem Krankenlager auf gleichsam verjüngt und erfrischt. Und noch ein volles Jahrzehnt war ihm zu leben vergönnt. So tief auch die Attentate sein Herz verwundet hatten, ihre Aufnahme im ganzen Volke zeigte ihm auch wohltuend und tröstend dessen Liebe und Mitgefühl. Es traf sich, daß mit jenen Ereignissen das Absinken der liberalen Welle zusammenfiel. Bismarcks Politik schlug sich wieder in konservativere Bahnen. Sozialistengesetz, Schutzzoll und Sozialreform bezeichnen diesen Umschwung. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen sollten, nachdem erst mit den liberalen Bundesgenossen partikulare Hindernisse beiseite geräumt waren, dem Reiche den festesten Zusammenhalt verleihen. Aktiver Anteil wird dem Kaiser an dieser Richtung in bedeutendem Umfange nicht zukommen. Die treibende Kraft allein war Bismarck. Der Kaiser aber stimmte ihm hier mit freudiger Seele zu. Schwerer ward ihm die Zustimmung zu der außenpolitischen Wendung der Bismarckschen Politik. Vor der Gefahr des Zweifrontenkrieges schloß Bismarck das österreichische Bündnis, nachdem seine beherrschende Stellung in der europäischen Politik durch die Entfremdung Rußlands nach dem Berliner Kongreß und durch das Erstarken Frankreichs den ersten noch kaum sichtbaren Stoß erhalten hatte. Der Kaiser, groß geworden in der Verehrung Rußlands, gab erst nach schwerem Kampf seine Einwilligung zu dieser Politik, die, wenn auch nur in der Abwehr, gegen Rußland sich wandte. Es war daher ganz in seinem Sinne, daß Bismarck den Draht nach Petersburg trotzdem nicht zerriß, sondern ihn zu festigen suchte. Die Rückversicherungsverträge mit Rußland, die Bismarcks Ansehen und Kunst trotz dem Bündnisse mit der Donaumonarchie zustande brachte, erleichterten dem Kaiser das Festhalten an der neuen Außenpolitik. Die Anlehnung an das Zarenreich war ihm Herzensbedürfnis. Bismarcks kunstvolle politische Führung sicherte im letzten Regierungsjahrzehnt dem Reiche einen gesättigten Frieden, der seine Kräfte gewaltig aufschwellen ließ und seine Macht befestigte. Alle gefährlichen Spannungen in der Innen- und Außenpolitik waren abgedämpft. Stetigkeit und selbstsicheres Maßhalten strömten von dem Reiche Wilhelms und Bismarcks aus.
Auf schlichte und gedämpfte Harmonie war auch die Lebensführung des alten Kaisers gestimmt, in seinem persönlichen Lebensbezirk herrschte die versöhnliche Stille des Alters. Die politischen Stürme, die früher auch sein persönliches Leben berührt hatten, waren abgeebbt. Das Verhältnis zu Bismarck gewann freundschaftliche Färbung, und die Reibungen in seiner Familie, die den fein empfindenden Mann bedrückt haben mochten, hatten ihre Schärfe verloren. Die Gatten standen sich in diesen letzten Jahren herzlich nahe, herzlicher als es je sonst der Fall gewesen war. Der Kaiser blieb in seinen Amtsgeschäften und ließ sich den Faden nicht entgleiten. Mehr, als sein hohes Alter es vermuten läßt, sieht man seine Teilnahme an schwierigen Geschäften. Er war immer bereit, dem Wandel der Zeit [384] zu folgen. Praktiker und Gelehrte kamen zu ihm, und er ließ sich dankbar durch sie belehren. Er erlaubte sich bis in sein hohes Alter keine Feierstunde, war immer tätig und schaffensbereit.
Als Greis fast schon hatte er die Regierung Preußens übernommen. Und doch war es ihm noch vergönnt, am Ende seines Lebens auf ein Vierteljahrhundert seines Königtums zurückzublicken. Die Fürsten Europas kamen in seine Hauptstadt, um ihm zu huldigen. Mehr noch wohl beglückte ihn die ständig wachsende Liebe des deutschen Volkes. Überall, wo er im weiten Deutschen Reich erschien, strömte sie ihm zu. Seine Fahrten und Reisen waren unaufhörliche Huldigungen. In ihm ehrte und liebte das Volk das neue Deutschland. In unvergleichlicher Bescheidenheit genoß er die Anhänglichkeit und die ausdrucksvolle Verehrung der Massen, die sich vor seinem Fenster sammelten, um sein Bild mitzutragen. Dann senkte sich doch ein Schatten auf diesen von mildem Licht erfüllten Lebensabend. Unheilbare Krankheit befiel den Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Es war doch nur ein unvollkommener Trost für den alten Kaiser, der in stolzem Glück drei Thronfolger hinter sich hat sehen dürfen, wenn er in seinem Enkel Wilhelm die Fortsetzung seines Werkes gesichert glaubte.
Das deutsche Volk stand trauernd an der Bahre seines ersten Kaisers, in dem es seine Einheit und seine Größe verkörpert sah. Selten hat der Tod eines Fürsten in seinem Volke so viel ehrliche Trauer erweckt als der Tod Wilhelms I. Jedermann sah es: er hatte die Krone, die ihm das Schicksal verliehen, mit dem milden Licht eines edlen Menschentums umgeben und ihren Glanz vielfältig erhöht. Ein großer Mensch und ein großer Fürst war dahingegangen.
 |