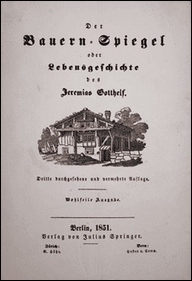|
[Bd. 5 S. 221]

Jeremias Gotthelf oder Albert Bitzius, wie er bürgerlich hieß, ist geboren am 4. Oktober 1797 im Zeichen des Skorpions, der vom Mars regiert wird, in einer Gegend des Tierkreises, aus der eine große Anzahl von Revolutionären, Empörern, Führern und geistigen Entladungen hervorgegangen ist, aber auch von Verbrechern, Wahnsinnigen und Unglücklichen, alles in allem aus einem der widerspruchsvollsten Bezirke der Lebenshintergründe. Sein Vater war Pfarrer in Murten, wo Bitzius auch geboren ist; es ist die Landschaft, in welcher die Eidgenossen die ruhmvolle Schlacht gegen Karl den Kühnen von Burgund geschlagen haben, den ihnen der deutsche König auf den Hals hetzte. Der Platz liegt nahe der deutsch-französischen Sprachgrenze, wo der Geist, bewußt oder nicht, eine wachere Haltung hat als im Hinterlande. Aber noch mehr kämpferischer Anruf liegt in der Landschaft selber, einer bewegten Hochebene zwischen Jura und Alpen, deren weiße Häupter über den blauen See hinweg groß mit den langgezogenen hohen Einsamkeiten der Juraberge reden. In die Zeiten zurück fällt der Blick auf die große Epoche der Berner Geschichte, die eines der schönsten Führer- und Herrenvölker Europas am Werk sah. Noch weiter versinkt er ahnend in die Mysterien und Schicksale des Volkes, das vordem da war, der Kelten, von denen noch Denkmale und lebendige Sagen in allen Tälern und auf allen Höhen anzutreffen sind; denn es ist ein starkes, strenges und treues Volk, das schwer vergißt, das seinen Seelenbesitz mit rauher Leidenschaft zu verteidigen weiß, und so reich und unbefangen, daß es über seinen Abgründen trotzig wölbt und ruhig wohnt, gläubig, diesseitsstark, blutmächtig und unbeugsam von Natur. Von diesem Blut ist Gotthelf eine reine Zeugung in allem Guten und Bösen. Mit einem Vater, der noch ganz im Sinn der alten Selbstherrlichkeit despotisch herrscht, in einer Gegenwart, die nach sechs Jahrhunderten voll machtvollem und manchmal gewalttätigem Leben das Berner Volk zum erstenmal sachte seitwärts in die Gefilde der Demokratie und des Liberalismus lenkt, [222] und mit einer von Anbeginn gewitterhaften Zwiegeteiltheit in Seele und Geist wächst Gotthelf sich heftig und ungebärdig ins Dasein ein. Der Vater ist starr orthodox und hat als kämpferischer Altgläubiger offene Zusammenstöße mit den neuen Behörden, deren Ideal seinerzeit hinter französischen Bajonetten ins Land einzog und sich nicht ohne diese ausländische Gewalt so verhältnismäßig sicher festzusetzen vermocht hätte. Das kann der ehrliche, aufrechte Alte nicht vergessen. Gemessen an der früheren kalvinischen Strenge und Bürgergröße sieht er nur den Sittenverfall der Zeit und die Liederlichkeit einer Politik, die nunmehr im fremden Fahrwasser treibt, anstatt zu führen. Neben der historischen Höhe des Menschen lebt er noch völlig umfangen vom Glauben an die göttlichen Gegebenheiten und an den überirdischen Sinn des Daseins. Von dieser Urkraft zeigt Gotthelf schon früh, was davon von einem jungen Leben in Bewegung zu bringen ist: heiße Leidenschaft und konstitutionelle Aufsässigkeit. Er sagt von sich selber: "Als wilder Junge durchlebte ich dort die wilde Zeit der Revolution und Helvetik, besuchte die dortige Stadtschule, wo man mir gewöhnlich das Zeugnis gab, daß man mit dem Kopfe wohl, mit den Beinen aber, welche ich nie stillehalten konnte, übel zufrieden sei." Je härter und schwerer der Druck des Vaters über ihm liegt, desto unbändiger ist der seitliche Ausschlag, denn gelebt muß sein, und zu spüren muß einen die Welt kriegen, möglichst früh. Einer der großen aufbauenden Charakterzüge ist die unbedenkliche Leidenschaft, mit der sich der junge Mensch auf alles Lebende stürzt und auf das, was man jeweilen tun kann, auf Krebsen, Fischen, Raufen, Obststehlen, Bauernfoppen, aber auch auf das Festefeiern, wie es der Lauf des Kalenders und der Arbeit bringt, Flegel-, Sichel-, Spinnfeste, Erntefeste, Neujahr. Die Berner, wenn sie noch echt und urtümlich sind, sind ein ebenso ernstes wie leidenschaftliches Volk, in Arbeit, Krieg und Freude gleicherweise zum Durchgreifen geneigt. Dazu kommt das Leben auf dem väterlichen Hof. Der Pfarrhof ist ein Bauerngut mit allem, was dazugehört, sogar Knechten und Mägden. Gotthelf hütet das Vieh, wettert durch den Wald, träumt an Weidefeuern, und wenn es ihm erlaubt ist, Tiere zu halten, so pflegt er sie mit eifriger Treue. Er stammt aus einem Schlag Menschen, der immer etwas unter der Hand haben muß, bei dem Besitz und Arbeit altheilige Begriffe sind und zur Lebensherrschaft gehören. Neben dem Gewissensdruck des Vaters hat er die Freiheit in vollen Zügen genossen, und noch unter den Augen des Alten will sie sich fortsetzen als Trotz, Störrigkeit und Widersetzlichkeit. Darin ist er einig mit seinem jüngern Bruder Fritz, der in seinem Leben noch eine große, aber dunkle Rolle spielen wird, in allem ihm ähnlich, gleich unbotmäßig und heftig, aber in der Moral weniger wert. Was bei Albert wilde, aber sonst gerade und saubere Natur ist, das erscheint bei Fritz schon früh mit einem Einschlag von Lumperei, und Albert hat einen Streitpunkt mit dem Vater mehr. Es muß Auftritte von gegenseitiger [223] Maßlosigkeit gegeben haben, zwischen denen die Mutter etwas farblos und ohne eigene Umrisse steht, auch ohne Gemütstiefe, ohne echte Religiosität und daher auch ohne wahre Mutterschaft. Im Gymnasium tut er sich nicht in den humanistischen Fächern hervor, sondern in Mathematik und Physik, daneben reizen ihn Philosophie und Geschichte, und ganz selbstverständlich ist es, daß ihn die Kampfstellung gegen den altgläubigen Haustyrannen ins Lager der Aufklärung treibt. Bei allem klagt er über sich, daß ihm die Gaben fehlen, um sich über die Mittelmäßigkeit zu erheben. "Nur mit der größten Anstrengung kann ich mich zur Gründlichkeit gewöhnen, ohne welche alle Studien vergebens sind." Das Frühelend des Weltjammers und des Verlorenheitgefühls macht er gründlich durch, entsprechend der heißen Leidenschaftlichkeit,die nun einmal sein Wesen bestimmt, und der rücksichtslosen Ehrlichkeit, aber ebenso gründlich sind seine Ausschläge in die Tanzsäle, ist seine Radaumacherei und sein Leben eines lachenden Mitmachers, wenn nicht Anführers. Daneben erscheint zum erstenmal eine Quelle vielen Verdrusses, die noch oft Bitterkeit in sein Leben tragen wird: sein unersättliches Bedürfnis, sich hervorzutun, bringt ihm beim Theaterspielen eine Niederlage ein, weil ihn sein Berner Dialekt auf der Bühne unmöglich macht, sogar auf Berner Boden. Die Eigenheit entspringt einem Mangel an Wandlungsfähigkeit, der aus zwei Zügen zusammenfließt: aus granithafter, unveränderlicher Echtheit und aus beinahe wilder Selbstverliebtheit trotz oder gerade wegen seiner fast zerstörerischen Einsicht in seine Mängel. Als theologischer Kandidat wirft er sich aufs Lehramt mit angeborener Leidenschaft und geht sofort zum Angriff gegen Orthodoxie und den gerade aufkommenden mystischen Pietismus vor. Mit ungeduldigem Verdruß wohnt er den Übertritten zum Katholizismus und dem Treiben einer mystischen deutschen Baronin als das Sonnenweib aus der Offenbarung auf Schweizer Boden bei. Der Zeitkrankheit setzt er einen zornigen und tumulthaften Liberalismus entgegen, der das Familienleben im Vaterhaus und seine Stellung darin nicht erleichtert haben wird. Den ersten festen Anhalt im Leben findet er im Schulunterricht, durch den er dem "verfluchten Schlamm der Theologen" zu entkommen hofft. "Mir gefällt es unter meinen Buben recht wohl", schreibt er an den Freund Fetscherin. "Sie sind mir lieb und recht wackere Kameraden... Ich halte dafür, daß in diesem Alter das Lernen nicht das Höchste sei, sondern Entwicklung des Charakters und Bildung desselben, daher muntere ich sie zum Lärmen auf, mache selbst mit, was das Zeug halten mag. Während der Stunden aber handhabe ich die strengste Ordnung... Mit was ich mir die Buben vorzüglich gewann, war das Erzählen, wozu ich Gegenstände aus der alten Geschichte, besonders der vaterländischen, nahm, und jede derselben schloß ich, wie ehemals Cato: sie sollen nur sehen, daß das Höchste die Freiheit, das Recht, daß für diese alles aufgeopfert werden müsse, daß den Mutigen immer Ehre, den Feigen immer Schande [224] treffe." In diesen Sätzen offenbart sich erstmalig der Grundplan seiner Natur. Es erscheint eine völlig unumwundene Männlichkeit und eine vornehme, entschiedene Bedenkenlosigkeit im Darlegen des sittlichen Gehalts mit seinem hohen Dreiklang: Freiheit, Recht, Ehre. Auch der Begriff der Kameradschaft erscheint bereits darin in einer Zeit, in welcher der Schulbüttel und die mechanische Lernerei in der Schule alles war. Die Kameradschaft pflegt er auch im burschenschaftlichen Leben, wo er leidenschaftlich und begeistert mittut. Die ganze studierende Jugend ist in Aufruhr. Hier auf der Erde will man seinen Himmel haben. Auflehnung gegen alle veralteten Gewalten ist die Losung. Er bekommt einen Rüffel als Rädelsführer beim Protest gegen einen obrigkeitlichen Wahlentscheid. Aus der ganzen Bewegung kristallisiert sich der Anspruch auf Mündigkeit und Selbständigkeit der studierenden Jugend heraus durch die Gründung der "Zofingia", eines nationalen Studentenvereins im Städtchen Zofingen. Die Zofingia wurde bald berüchtigt durch "rohe Kordialität". Auf den Gelagen der Sektionen ahmte man handfeste deutsche Studentenbräuche nach. Andrerseits ging aus dieser Generation eine ganze Reihe grundsätzlich richtunggebender eidgenössischer Erscheinungen hervor, denn es wird da nicht nur gekneipt und randaliert, sondern es werden auch die wichtigen Fragen des Vaterlandes und des Daseins überhaupt verhandelt. Das Wesen schlägt sich auch bereits in Manuskripten nieder, die hoch geladen sind mit Philosophie und kühn gespannten Gedanken, bedeutend weniger geordnet als eruptiv wie ein Vulkan in einer mächtig erwachenden Frühlingslandschaft. Immer steht die Rauchfahne seines Zornes über den blühenden Tälern und über klingenden Geisblattlauben; in diesen sitzt er selber mitsingend, so rauh es tönt, prahlend, tändelnd, den Geistreichen spielend und sozusagen unterirdisch erschüttert von der Gegenwart des andern Geschlechtes, das er mit allen aufgerissenen Sinnen in sich hineintrinkt, ohne je satt zu werden, zumal er davon nie mehr einfängt als den Klang, den holden Schein und den Duft. Das genügt aber, um ihn in einer dauernden schweren Erregung zu erhalten. Dabei hört er nicht auf, sich selbst zu mißtrauen. Er hält sich immer für den Gefoppten, argwöhnt, daß er ausgelacht wird, und ganz wohl ist ihm nur, wenn er eine der Schönen füttern kann: wenn es ihm gelingt, das Wesen in ein Tun umzusetzen und ins Urverhältnis hineinzugelangen. Was er tun kann, dessen ist er sicher, und nur dessen. Er ist der Bär unter der spielenden Meute, der noch nicht flügge Adler im Hühnerhof. Im Sommer 1820 besteht er sein theologisches Examen mit Erfolg. Eine Weile wirft er sich wieder auf die Schule. Im nächsten Jahr geht er mit einem Stipendium nach Deutschland, um die Welt kennenzulernen und in größeren Verhältnissen vollends frei zu werden. Das Studium spielt dabei keine große Rolle mehr. Er läßt sich Schnurrbart und Backenbart wachsen, bei ihm äußerst ernstgenommene Ereignisse, spielt Karten, raucht und hält sich im wesentlichen [225] an seine Landsleute. Wie er endlich doch in die Gesellschaft kommt, erweist er sich als ein solcher Hinterwäldler, daß er dort aus seiner Ecke, die er gleich bezieht, nur Spuk und Verlogenheit beobachtet. Er hält sich über die "Ölgötzen-Figuren" der deutschen Kommilitonen und die Zimperlichkeit der Damen auf. Da er gleich seinem Landsmann Gottfried Keller sich nicht mittenhinein wagen darf, erlebt er nur ein ärgerliches Kasperlspiel. Dabei hat er immer eifrig gegen den Vater und die Heimat seinen Aufenthalt in Deutschland zu verteidigen. Er prahlt mächtig und trägt dick auf. "Die Gefälligkeiten aller Art, Höflichkeit und Achtung, die man mir erwies – wem konnte ich Fremder sie zuschreiben als meinem Verdienst und Vorzügen! Wenn du einmal vielleicht meine Reisebeschreibung zu lesen kriegst, die ich vielleicht schreibe, so wirst du staunen, wie ich gefeiert wurde."
Der wahrhaft große Eindruck dieser Reise wird für ihn der Prior eines freien Seminars für Geistliche in Hannover. "In hohem Stuhl sitzend", erzählt er von ihm, "glich er einem alten Seher, der, die Zukunft erschauend, seinen Schülern das Kommende verkündet und das Gegenwärtige erklärt." Die Zeit der Fürsten sei vorbei, in Napoleon habe sich ihre Schuld und ihr Untergang symbolisch verkörpert. Nun versuche man überall die Völker mit halben Maßregeln zu beschwichtigen, die Nationen kämpften noch vereinzelt und darum erfolglos um ihre Zukunft. Aber eine ungeheure Veränderung werde sichtbar: die Massen wüchsen zu immer größeren Dimensionen, seien immer schwerer zu unterhalten und von den Thronen abzuwehren. In einer solchen Zeit müsse auch der Theologe den Wahn abwerfen, daß das Gute durch bloßes Predigen zu erreichen sei. – Die Begegnung muß ihm einen mächtigen und nachhaltigen Eindruck gemacht haben, zumal die letzten Worte seine eigene Richtung ausdrücken: Zugreifen, etwas tun, einrichten, bauen, handeln. Als Vikar geht er mit der ihm eigenen Freiheit von jedem Umschweif an die Verwirklichung. Er wirft sich vor allem wieder aufs Schulwesen, bringt die [226] Bauern dazu, ein neues Schulhaus zu bauen, greift in die Armenpflege ein, stiftet Versöhnungen, alles aus der entschlossenen Überzeugtheit, daß der Mensch seine Erfüllung hierseits suchen müsse und nicht jenseits. "Wo ist wohl ein besseres Wohnen als hier?" sagt er in der Aufrichte-Predigt. "Laß, o Gott, auch uns Menschen gut und schön werden wie das Land... daß... der Menschen Ruhm sich verbreite." Weltlicher kann ein Pfarrer nicht mehr beten. Aber der Rückschlag tritt ein. Sein Gesuch um Überlassung dieser Pfarre, die er nun schon so gut kennt, wird trocken und kurz abgeschlagen als nicht gesetzlich. Ein früherer Zimmergenosse erhält sie, und sofort bricht eine erbitterte Feindschaft zwischen beiden aus, die bis ans Ende vorhält. Die Niederlage kann auch sie nicht leichter machen. "Der Tod meines Vaters zerstäubte die Ideale!" schreibt er vollends in der Autobiographie. Gleich steht er auch gegenüber seiner Vergangenheit und seiner Haltung darin richtend und urteilend. In der Abschiedspredigt bezieht er Stellung neben seinem Vater. Unter den zerstäubten Idealen meint er die liberalistischen, denen er nun absagt. Er erkennt in der Haltung seines Vaters, sobald er von dessen Druck entlastet ist, die höhere Größe und die eindrucksvollere Geschlossenheit. Die erlittene Bitternis von seiten des neuen Systems beschleunigt nur den Anbruch der Selbstbesinnung, gekommen wäre sie so oder so, denn er ist seiner ganzen Anlage nach ein echter bernischer Aristokrat und Autokrat. In Herzogenbuchsee treibt er es wie vorher. Er klagt, daß er zwei Jahre lang schlecht angesehen war und vieles leiden mußte wegen seines Zerwürfnisses mit dem Freund um des Vaters Nachfolge, das im ganzen Land Gerede machte. Da ihm die mächtige Genugtuung versagt geblieben ist, in des Alten Fußstapfen zu treten, wirft er sich in ein wahres Schlachtfeld von Tätigkeit, das die Kraft eines einzelnen Mannes eigentlich weit überfordert. Vornean steht immer wieder die Schule. Er entwirft Eingaben an die Regierung. Er kämpft für andere. Er führt für die Gottesdienste einen Kinderchor ein. Dabei spricht er von sich als von einem halbverwilderten Jäger, der sich kaum ein sitzendes Leben angewöhnen kann. Er streift zu Pferd im ganzen Land herum. Er jagt in Moor und Wald. Auf den Höhen des Jura sehen ihn einsame Wanderer toben. Er hat einen so wilden Überschuß an Kraft, daß er nicht damit fertig werden kann. Zugleich weiß er genau Bescheid in jedem Haus. Er scherzt mit den Mädchen, plaudert ernsthaft mit den Frauen, sitzt im Wirtshaus mit den Mannen beisammen. Seine Predigten entwirft er auf weiten Gängen. In der Nacht steigt er auf der Leiter aus dem verschlossenen Pfarrhaus, um mit Freunden die Nacht hindurch zu toben und im Morgengrauen auf dem gleichen Weg zurückzukehren. Auch verkleidet als Fuhrmann will man ihn gesehen haben. Immer noch sind ihm die Weiber ein "Rätsel". Schließlich gerät er wieder in Streit mit der Behörde wegen einer Schulfrage, bekommt mächtige Feinde und wird abberufen: wieder die grundsätzliche Niederlage in einem tiefen menschlichen Recht. [227] Das ist die Linie, die durch sein ganzes Leben geht. Die Julirevolution begrüßt er begeistert. Sie kostet ihn die Stellung in der Schulkommission, weil seine pädagogischen Grundsätze von seinen Kollegen abgelehnt werden. Das ist in der Stadt Bern, wo nach den Jahrhunderten großer
Leicht ist es ihm nicht gefallen. Seine Geburtsstunde wird nun einmal vom Mars regiert, und die Gewitterhaftigkeit ist die Stimmung seines Lebens. Den Abschluß der lange dauernden Frühzeit bildet auch äußerlich die Verheiratung mit einer Pfarrersenkelin, Henriette Elisabeth Zeender, bei achtundzwanzig Jahren nicht mehr überjung und ihrer farblosen, unausgeprägten Art nach bestimmt nicht eine Erfüllung irgendwelcher stürmischen Ideale. Man könnte sagen, daß seine ganze Gemütskraft und Liebesfähigkeit mit seiner Phantasie auf die Reise gegangen ist und jetzt schon zu weit voraus, als daß er sie noch zurückrufen könnte. Zeugnisse besonderer Liebe oder Zärtlichkeit besitzen wir von den beiden nicht einmal aus den ersten Jahren. Sie hat ihm ordentlich Haus gehalten, war seinen Kindern eine zulängliche Mutter und ihm später eine von ihm geschätzte erste Kritik für seine Dichtungen. Später leidet sie viel an Kopfschmerzen. Die Briefe handeln nur von ganz alltäglichen Dingen. Neben seiner Ehe treibt er ungestört sein Männerwesen weiter, sein Freundesleben ist ungleich stärker und reicher entwickelt als sein Liebesleben. Sein großes Erlebnis im Emmental soll ihm von ganz anderer Seite kommen, und bezeichnenderweise erwächst es seinem Tatendrang. Er betreibt die Gründung eines Erziehungsheims und bringt es trotz dem Geiz seiner Bauern dazu, daß er das erste Haus im Jahr 1834 mit fünfzehn Jungen eröffnen kann. Dies Heim wird ihm zur eigentlichen Familie, und er wird im wahrsten Sinn zum Vater seiner Pflegebefohlenen. Er marschiert zu ihnen hinüber, so oft er irgend kann, kennt sie alle mit Namen, nach ihrer Herkunft und ihren Begabungen, tafelt mit ihnen unter dem großen Birnbaum, sorgt nachher für sie und hält sie auch nach dem Austritt aus der Anstalt zusammen, und immer weiß er genau, wieviel [228] Kühe, Schweine, Hühner und so weiter auf dem Hof sind. Trotz allem fürchten sie ihn ein wenig wegen seiner Gewitterhaftigkeit.
In dem ergreifenden Brief an seinen Vetter Carl Bitzius beschreibt er noch einmal, wie er in seinem ganzen Leben darniedergehalten wurde, wie man ihn zurücksetzte, ihn als schlechten Prediger verschrie, ihn von Ämtern verdrängte, ihm unbescheidene Zudringlichkeit vorwarf, wie er in der Gemeinde nur durch "verfluchtes Zuwarten" Boden gewinnen konnte, Mißtrauen zu ertragen hatte, von allen Seiten gelähmt, und wie sein unterdrücktes Leben endlich durchbrach. "Es tat es in Schrift. Und daß es nun ein förmlich Losbrechen einer lange verhaltenen Kraft, ich möchte sagen, der Ausbruch eines Bergsees ist, das bedenkt man natürlich nicht... So ist mein Schreiben gewesen ein Bahnbrechen, ein wildes Umsichschlagen nach allen Seiten hin, woher der Druck gekommen, um freien Platz zu erhalten." Das Feindeslager tobte so laut, daß er für das zweite Buch, die Leiden und Freuden eines Dorfschulmeisters, das Pseudonym wechselte. Diese Dichtung hat noch einmal ungefähr den Lebensverlauf und die Problemstellung des ersten, aber an Stelle der Armenpflege tritt nun das Schulwesen als soziale Umwelt in Erscheinung. Man muß historisch denken, um zu ermessen, was für ungeheuerliche Neuerungen diese Stoffgebiete waren und wie sie den damaligen Ameisenhaufen der öffentlichen Meinung politisch und literarisch aufwühlten. Bis Tolstoi kam nichts mehr von gleicher Wucht, Kenntnis, Größe und auch Brutalität. Gotthelf [229] ist größer und tiefer als Zola, doch Zola ist ihm literarisch überlegen. Keiner von beiden übertrifft ihn an unheimlicher Kenntnis seiner Menschen und Zustände. Auch als großdeutscher Dichter und Aufdecker hätte er Anfeindungen auszustehen gehabt, aber in einem größern Raum wäre er ihnen nicht so rettungslos ausgeliefert gewesen. "Du dürftest gezeigt haben", schreibt ihm sein Vetter Carl, "daß man wenigstens Feinde aus der Erde stampfen kann. Aber ohne Not, ohne Pflichtgebot sich allmählich ein Heer von Feinden auf den Hals laden, Feinde in der Regierung, Feinde unter den Armen, Feinde in der Vaterstadt – das hieße sein eigenes Glück und die Zukunft seiner Familie vielleicht ebenso mutwillig untergraben, wie es Dursli (die Untergangsfigur in der Erzählung 'Dursli der Branntweinsäufer') tat." Er fühlt das Wahre in diesem Vorhalt, und mit dem Roman Uli der Knecht tritt er in die große Zeit seiner Dichtung, in seine eigene Klassik. Nunmehr wird es ewig um ihn, weit, urtümlich. Aus der eingesammelten Saat seiner Erfahrungen und dem gestapelten Reichtum seines Besitzes an Menschlichem wächst die heilige Zeitlosigkeit des Daseins empor und erblüht erschütternd das gültig Schicksalhafte, hinter dem es keine weitere Offenbarung mehr gibt. Politische Gegner schreiben ihm Drohbriefe. Er sieht geballte Fäuste wütender Bauern vor seinem Gesicht fuchteln. Aus einem Haus seiner Gemeinde ertönt höhnisches Gelächter, sobald er daran vorbeigeht. Aber unter seiner gesegneten [230] Hand entstehen nun die Wunderwerke seiner dichterischen Eingebung, die beiden Bände von Uli der Knecht und Der Pächter, Anne Bäbi Jowäger, Käthi die Großmutter, Die Käserei in der Vehfreude, Zeitgeist und Bernergeist und daneben eine lange Reihe von Erzählungen vorzeitlichen, historischen und gegenwärtigen Charakters, nicht zu reden von den Schriften politischer und religiöser Art, die immer noch von seinem Schreibtisch ausgehen, denn zum Predigen, Lehren und Kämpfen für das Rechte und Gute drängt ihn nach wie vor seine ganze Natur. Daneben tritt immer mehr die priesterliche Seite seines Wesens hervor. Die aber hat Wurzeln, die tief in das Vorzeithafte des Volksdaseins hinabreichen.
Unter jeder politischen Decke und unter dem klugen Gespinst zeitweiliger Systeme dauert unerschütterlich das heimliche Volk weiter mit seinem machtvollen Wissen um Zuvorgewesenes und Ewighaftes. Dieser protestantische Pfarrer des neunzehnten Jahrhunderts hat eine fast grauenhafte Nachbarschaft zu den mystischen Gestalten und Erscheinungen der Vorwelt. Seine Erinnerung ist noch voll von Druiden und Fabeltieren, die einmal übermächtiges Urerleben waren, bevor sie in den Traum des Volkes eingingen. Einen reichen, gefährlichen Abgrund von wildgroßem Frühleben spiegelt er in seinen Erzählungen, das unter seiner schöpferischen Hand wieder unheimlich lebendig wird. Er versteht noch die Beschwörung des Erzpriesters und beherrscht die gehüteten Worte des großen Zaubers. Er lebt tief und mit der Selbstverständlichkeit dessen, der dazugehört, im Blutinstinkt seiner Sippe und seines Stammes. Seine vermeintliche Naivität ist fürstliche Überlegenheit, und Mühen hat er nur durch die Not der Mitteilung an das späte, großer Worte und Haltungen entwöhnte Geschlecht, das seine Sprache nicht mehr spricht. Denn was er mitzuteilen hat, ist ja das Übermenschliche, das Unerforschliche, das Urwesen, das Raunen und Spinnen der grauen Ältermütter und der wuchtige Gang der Vorväter, die den Heutigen die Fundamente ihres Daseins bauten aus riesigen Quadern zur unaufhörlichen Dauer. Die Saga des Bernervolkes hat er geschrieben hintergründig, bluttief, abgrundehrlich und gott-zu-gewandt. Seinem gemütsfruchtbaren Stamm hat er das gegeben, was man den Mythus eines Volkes nennt, den Daseinssinn, das Urbild, die ewige Richtung, und etwas Größeres kann keiner geben. Seine Erzählungen sind das gestaltenreiche Weiterweben aus dem Grundgeheimnis, das schöpferisch schlummert und träumend schafft zwischen den Bergen und Wäldern jeder Heimat, sie sind lebendig gewordene Landschaft, und die Landschaft ist das bewegte Kleid ihrer Menschen, Wiege, Werkstatt, Schlachtfeld, Festplatz und das Grab als Tor zur Ewigkeit. Das unendliche Gebären und das unendliche Zerstören, das hat er erlebt und begriffen bis tief hinab in die Gräber und Wurzelbereiche, was dasselbe ist. Daher begleitet ihn auch durch das ganze Leben diese gotterfüllte, ungeheure Erregung. Er hat sich nie "gewöhnt", er ist nicht zur "Beruhigung" gekommen. Was tun wir mit Gewohnheit und Beruhigung in dem ewigen Wallen und Weben? [231] "Ruhig" ist die niedergesunkene Asche. Unruhig ist das fruchtende und treibende Sein. "Ungewöhnt" ist der unaufhörliche Prozeß der Neubildung, das Spiel der Entfaltung, der ungeheure Gang der Abwicklung, Umwälzung, Neuanpassung, gotthafter Willensantrieb, das heilige Müssen, hinter dem es keine weitere Erklärung gibt. Darum ist Gotthelf auf das Absolute eingestellt. Fertig und abgeschlossen ist bei ihm nichts, so wenig wie bei einem andern wirklich fruchtbaren Geist. Er spielt nicht seine Figuren und Geschehnisse in ein zierliches Ornament aus. Er schafft kein stilistisches System. Sein Humor ist ungeheuerlich und riesenmäßig. Er ist kein Stadtbürger. Eine politische Ordnung kann man auf ihn nicht gründen. Seine vollerblühte Lebensrose schleudert Düfte von Urgewalt aus und gleicht eher einem Vulkan als einer zierlichen Ziselierarbeit. Mit einer unbedenklichen Naturgewalt, wie sie bloß der hat, der von sich zuletzt doch nicht weiß, bricht seine Vitalität in eine Zeit ein, die sich endlich "beruhigen" und "einrichten" will, die nach Systemen und Ornamenten ausschaut, die sich vom beunruhigenden Urwesen abkehrt, weil sie nicht mehr die Kraft dafür hat.
Hinter seiner Leiche ging ein ganzes Volk. Alle Insassen seiner Erziehungsanstalt und viele, die er in die Welt hinaus entlassen hatte, begleiteten ihn zum Grab. Acht erwachsene Söhne aus seiner weitverbreiteten Fürsorgefamilie trugen seinen Sarg. Das gesamte Land horchte auf bei der Nachricht von seinem Ende, die nun vieler Verfolgung und Meinungsverwirrung ein Ende machte. Sein Herz hat der leidenschaftlichen Entfaltung dieses Lebens nicht länger als siebenundfünfzig Jahre standgehalten. Jetzt steht er da als der mächtigste und edelste Zeuge seines Volkes. Wer ihn erfahren hat, der stellt nicht mehr die Frage nach dem Eigenleben seiner Nation.
 |