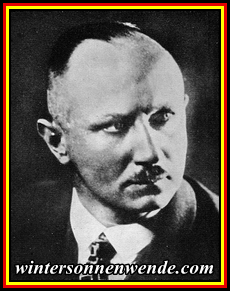|
[Bd. 6 S. 225=Tabelle] [226] 10. Kapitel: Der Sturz der demokratischen Diktatur. Im Vorsommer 1932 erhoben sich innenpolitisch drei elementare Gewalten zu einer gefährlichen Bedrohung für die Brüning-Diktatur: Die Arbeitslosigkeit und die Unfähigkeit, sie mit den Mitteln der herrschenden Anschauung zu bekämpfen, die fortschreitende Zerrüttung der Finanzen und die Unfähigkeit, sie mit der herrschenden Methode immer neuer Steuerbelastungen, die das ausgepumpte Volk nicht mehr zu tragen imstande war, zu bannen, und das immer machtvollere Anwachsen des Nationalsozialismus, das durch kein Gesetz und keine Gewalttat verhindert werden konnte. Und schließlich erschütterten die Angriffsvorbereitungen Polens gegen das östliche Deutschland aufs schwerste die Stellung der Brüningschen Regierung. Nach den großen deutschen Landeswahlen begann daher der Machtzerfall der demokratischen Diktatur offen einzusetzen und schließlich bis zum Sturze der Regierung Brüning fortzuschreiten. – Der schwersten Krankheit des deutschen Volkslebens, der Arbeitslosigkeit, stand Brüning machtlos gegenüber. Trotzdem der Kanzler schon verschiedentlich durch Notverordnungen tiefe Eingriffe in das Leben der Privatwirtschaft getan hatte, scheute er dennoch davor zurück, auf diesem wichtigsten aller Gebiete, der Arbeitsregulierung, sich entschlossen von den alten, als unbrauchbar erwiesenen Wirtschaftsprinzipien abzuwenden. Brüning glaubte immer noch, daß die Arbeitslosigkeit in sich selbst bekämpft werden könnte, durch Neuordnung der sozialen Fürsorge, durch freiwilligen Arbeitsdienst, durch Ausbau des Siedlungswesens. Die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen durch unmittelbare und umfassende Neuorganisation des gesamten Arbeitsgebietes der Volkswirtschaft, davor scheute der Kanzler immer wieder zurück, denn er fürchtete den Widerstand der liberalistisch denkenden Unternehmer. Allerdings war ein großer Mut nötig, um eine entschlossene Heilung der wirtschaftlichen Wunden herbeizuführen. Vor [227] allem bedurfte der verantwortliche Staatsführer einer klaren und ruhigen Erkenntnis der gewaltigsten wirtschaftlichen Katastrophe, die je den Erdball, seit es eine Weltgeschichte gibt, befallen hat. Es war ja der Erfolg des Weltkrieges gewesen, daß die wirtschaftliche Vorherrschaft Europas in der Welt zerbrochen wurde, ja, daß die beherrschende Stellung der weißen Rasse bis in ihre Grundfesten erschüttert wurde! In China und Indien haben die weißen Kapitalisten ihren Einfluß beträchtlich eingebüßt. Im bolschewistischen Rußland war der Kapitalismus in extremen Marxismus umgeschlagen, das mächtige Kolonialreich Englands hatte sich in die wirtschaftlich selbständigen Gebiete der Dominions aufgelöst. Eine Wirtschaftskatastrophe, wie sie die Weltgeschichte noch nicht erlebt hatte, war über das kapitalistische Europa hereingebrochen: der Teil unseres Erdballes, der sich 1918 dem wirtschaftlichen Imperialismus Europas entzogen hatte, betrug 62 Millionen Quadratkilometer oder 45 Prozent der gesamten Landoberfläche unserer Erde, und 950 Millionen Menschen oder die Hälfte der gesamten Erdbevölkerung!
Anderseits hatten 1913 von den 40 Milliarden Goldbestand der Welt die Vereinigten Staaten 7,9 (19,75 Prozent) und Frankreich 5,9 (14,75 Prozent) Milliarden, während 1932 von den 52 Milliarden in den Vereinigten Staaten 18,4 (35,4 Prozent) und in Frankreich 12,6 (24,2 Prozent) Milliarden lagerten! Die beiden Staaten, die also vor dem Kriege etwas mehr als ein Drittel des Goldes besaßen, verfügten 1932 über drei Fünftel davon, hatten ihren Anteil fast verdoppelt! Die Folge davon war, daß fünf Sechstel der Menschheit nicht mehr genügend Gold als Währungsgrundlage hatten. Diese Entwicklung lag ganz in der Linie des alten Wirtschafts- und Weltwirtschaftssystems, das die Erzeugung nur zum Zwecke des kapitalistischen Profites betrieb. Es war das Tragische in Deutschland, daß sowohl die führenden Wirtschaftskreise wie auch die Staatsmänner die Krisis der kranken liberalistischen Wirtschaft durch veraltete, aus diesem System selbst heraus geborene Mittel zu heilen versuchten. Den verminderten Absatzmöglichkeiten suchten sie zu steuern durch Verminderung der Menschenkräfte, durch Einschränkung der im Produktionsprozeß beschäftigten Menschen. Als sie seit der Sommerkrisis von 1931 das Verhängnisvolle dieser Methoden erkannten, waren die deutschen Staatsmänner bereit, durch marxistische Mittel, insbesondere durch Verkürzung der Arbeitszeit, eine Linderung der großen Arbeitslosennot herbeizuführen. Sie fanden nicht den Mut, das Problem von der andern Seite anzufassen: statt Abbau der Menschenkräfte den Abbau der Maschinenkräfte zu diktieren, um infolge der verminderten Absatzmöglichkeiten durch Rückkehr zu handwerklicher Arbeit den Menschen wieder Erwerbsmöglichkeiten zu geben. – Die deutsche Volkswirtschaft befand sich in einem hoffnungslosen Zustande. Im Januar und Februar 1932 stellten 18 Aktiengesellschaften die Zahlungen ein. Bei den Siemenswerken waren die Aufträge um drei Fünftel zurückgegangen, die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft arbeitete mit großen Verlusten. Die Borsigwerke schlossen, weil sie insolvent waren, die Junkerswerke in Dessau, die größte deutsche Flugzeugfirma, [229] stand vor dem Konkurs und hoffte vergeblich auf Reichshilfe, der Solingen-Siegener Aktienverein ging in Konkurs. So häuften sich Tag um Tag die Schreckensnachrichten vom großen Wirtschaftssterben, die Flut der Arbeitslosigkeit stieg, im März wurde die sechste Million überschritten: ein Drittel bis zwei Fünftel des ganzen Deutschen Volkes war von der Wirtschaft, von der Arbeit ausgeschlossen, litt großen Hunger und große Not. Immer drohender erhob sich vor dem deutschen Volke, die Frage: wer soll die stetig zunehmende Zahl der Erwerbslosen am Leben erhalten? Im Januar 1932 gab es 900 000 erwerbslose Jugendliche, im März kamen 130 000 Schulentlassene dazu. Was sollte denn aus ihnen werden? Noch ehe sie ins Leben hinaustraten, fielen sie der Allgemeinheit zur Last. Die Zahl der Wohlfahrtsempfänger, die von den Gemeinden und Gemeindeverbänden unterhalten werden mußten, nahm ständig zu. Die Steuern dagegen, welche die sterbende Wirtschaft aufzubringen hatte, gingen rapide zurück. In zahlreichen Industriestädten deckten die gesamten Steuereinnahmen nur noch die Hälfte der Wohlfahrtslasten! Die Mehrzahl der deutschen Städte stand vor dem Bankrott, wie ja als erste preußische Stadt das 1300 Einwohner zählende Köben an der Oder mit einer Schuldenlast von 600 000 Mark Ende März 1932 in Konkurs geriet. Die Reichsregierung hatte 1931 versucht, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, wie gesagt: mit halben Mitteln. Den gewerkschaftlichen Plan, durch Arbeitszeitverkürzung Platz für Neueinstellungen zu schaffen, ließ man fallen, weil die Unternehmer dagegen waren und Stegerwald selbst erklärte ihn für vollendeten Unsinn. Die Arbeitsdienstpflicht wagte man nicht einzuführen, denn dies könnte gegen die demokratischen Grundsätze verstoßen, vor allem aber, es könnte für die liberalistische Privatwirtschaft daraus eine unangenehme Konkurrenz erwachsen. Also beschränkte sich Brüning darauf, in seiner Juninotverordnung den freiwilligen Arbeitsdienst zu empfehlen.
Viel wichtiger war der Versuch, die zur Siedlung geeigneten Erwerbslosen bodenständig zu machen. Im Frühjahr 1932 begannen die Städte mit dem Ausbau der durch die Oktobernotverordnung vorgesehenen Randsiedlungen. Es durfte möglichst wenig kosten, und die Arbeit wurde von den Erwerbslosen selbst geleistet. Neue Kolonien kleiner Häuser mit Gartenland bis zu je einem Viertelhektar erstanden vor den Städten. Aber auch diese Siedlungspolitik konnte doch nur einen verschwindend kleinen Teil der Arbeitslosen erfassen. Besonders die arbeitslosen Akademiker, etwa 60 000, interessierten sich für die Siedlungstätigkeit. An den Universitäten Leipzig und Berlin bildeten sich akademische Selbsthilfevereinigungen, die es sich zum Ziele setzten, die brotlosen Akademiker einer umfassenden nationalen Volkssiedlungsbewegung zuzuführen. Immerhin, vom freiwilligen Arbeitsdienst und von der Siedlungspolitik war ein maßgeblicher Einfluß auf die Verringerung der Arbeitslosigkeit nicht zu erwarten. Dennoch arbeitete Stegerwald im März 1932 eine Kabinettsvorlage aus, wonach der freiwillige Arbeitsdienst weiter ausgebaut werden sollte. So sollte der Arbeitsdienst jedem Jugendlichen bis zu [231] 25 Jahren offenstehen, auch sollten Freiwillige, die Eignung und Neigung zum Siedlerberuf besitzen, bei Arbeiten, die für die künftige Siedlertätigkeit eine geeignete Vorbildung vermitteln, bis zu einem Jahre zugelassen werden statt wie bisher höchstens 20 Wochen. Außerdem sollte die Zahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeitsdienstwilligen nach und nach auf 100 000 gesteigert werden. Eine gewisse Erschwerung des ganzen Problems trat ein, als Minister Groener die nationalsozialistischen Sturmabteilungen und Schutzstaffeln auflöste. Von dieser Maßnahme wurden etwa 400 000 Leute betroffen, von denen drei Viertel arbeitslos waren. Die nationalsozialistische Partei hatte ihnen Verpflegung und Obdach gewährt, das fiel nun fort, und das Reich und die Länder mußten nun auch die Sorge für diese Leute übernehmen. Reichsarbeitsminister Stegerwald wollte aber versuchen, gerade diesen Leuten von den aufgelösten S.A. und S.S. die Möglichkeit zu geben, infolge gewisser Erleichterungen, z. B. durch die Bestimmung, daß auch Empfänger von Wohlfahrtsunterstützung zugelassen werden sollten, sich im Rahmen des freiwilligen Arbeitsdienstes zu betätigen.
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit war also das Problem, mit dem sich der "Krisenkongreß" beschäftigte. Der Vorsitzende Leipart bezeichnete als die entscheidende deutsche Frage der nächsten Zukunft Beschaffung von Arbeit für die Arbeitslosen. [232] "Der Kongreß erhebt entschieden Protest gegen die widersinnige Politik, die zur völligen Vernichtung der deutschen Wirtschaft führen muß." Der stellvertretende Vorsitzende Eggert entwickelte dann ein Arbeitsbeschaffungsprogramm: Straßenbauten, Kleinwohnungsbau, Hochwasserabwehr, Hausreparaturen, Bahn- und Postarbeiten, Siedlung, landwirtschaftliche Bodenverbesserung. Hierin könnten eine Million Arbeiter beschäftigt werden, ein Jahr lang. Die Kosten von 2 Milliarden könnten durch eine Arbeitsbeschaffungsanleihe aufgebracht werden. Weiter müsse die allgemeine 40stündige Arbeitswoche gesetzlich eingeführt werden. Für den freiwilligen Arbeitsdienst sei in diesem Programm kein Raum mehr. – Im Grunde genommen waren es genau dieselben Vorschläge, welche die Gewerkschaften schon im Frühjahr 1931 gemacht hatten. Auch Reichsarbeitsminister Stegerwald hielt eine Rede. Er rechnete mit einer weiteren Zunahme der Arbeitslosigkeit. Weitere Lohnsenkungen kämen nicht in Frage. Im Gegensatz zu Eggert und Leipart aber trat er für Erweiterung des freiwilligen Arbeitsdienstes ein. Notwendig sei vor allem Förderung der ländlichen Siedlung und der städtischen Vorraumsiedlung. Gerade dies sei nötig, um der Bevölkerung eine sichere Grundlage zu geben. Denn die Reichsregierung meine, daß im nächsten Jahrzehnt die Rentenversicherung nicht so ausgebaut werden könne, daß die alternde Bevölkerung damit ihren Lebensabend fristen könne. Sollte aber eine geplante Besprechung zwischen den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine Einigung bringen, dann bleibe nichts weiter übrig, als die Arbeitszeit auf dem Wege der Notverordnung zu verkürzen. In der Aussprache äußerte auch der preußische Ministerpräsident Braun seine Ansicht. Er forderte eine Auslandsanleihe und in der Arbeitszeitfrage eine "noch radikalere Lösung" als die Vierzigstundenwoche, nämlich eine noch stärkere Kürzung der Arbeitszeit. Der "Krisenkongreß" nahm eine Entschließung an, die ganz von marxistischem Geiste erfüllt war. Die Wirtschaftsführung des privatkapitalistischen Systems habe das Vertrauen des Vol- [233] kes verloren. Der Einfluß des Staates, seine Aufsicht und Mitwirkung in der Wirtschaft müßten schleunigst ausgebaut und verstärkt werden. Der Gesamteindruck des Kongresses war der, daß in allen gewerkschaftlichen Kreisen der Widerstand gegen die bisherige Wirtschafts- und Arbeitslosenpolitik der Reichsregierung gewachsen ist, daß aber anderseits bisher keinerlei befriedigende Lösung für die wichtigste Frage gefunden worden ist: wie die erstrebte und unbedingt notwendige Arbeitsbeschaffung für die Arbeitslosen finanziert werden soll. Besonders gegen Stegerwalds Pläne verschärfte sich der gewerkschaftliche Widerstand nach seiner Rede auf dem Kongreß. Die Gewerkschaft der Berliner Metallarbeiter faßte eine scharfe Entschließung gegen Stegerwald: die Gewerkschaft habe kein Vertrauen zu den neuen Versprechungen des Ministers, der zu oft seine Meinung über die Art und Form der Arbeitsankurbelung gewechselt habe. Aufgabe der Regierung wäre in erster Linie gewesen, Riesenbetriebe wie Borsig und andere im Interesse der Arbeiterschaft zu erhalten und zu sozialisieren.
Auch dieser Plan Luthers stellte keine endgültige Lösung des Problems dar. Arbeitsdienstpflicht, sagten die Nationalsozialisten, sei an sich noch keine Arbeitsbeschaffung. Darin hatten sie recht, und darauf allein kam es an! Und außerdem barg der Plan eine Gefahr in sich. Sollte diese Hilfswirtschaft ein Dauerzustand werden, so konnte sich aus ihr leicht eine besondere Wirtschaftsform auf einer Art kommunistischer Anschauungen innerhalb des privatkapitalistischen Wirtschaftskörpers entwickeln. Das war eben die Gefahr bei der Anwendung derartiger Palliativmittel.
Die Stegerwaldschen Pläne begegneten außerordentlichen Schwierigkeiten, selbst innerhalb der Reichsregierung. Wochenlang wartete das deutsche Volk auf eine neue Notverordnung, die das Ergebnis der Beratungen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bringen sollten. Die Notverordnung kam nicht. Die Absicht Stegerwalds, Arbeitszeitverkürzung mit freiwilligem Arbeitsdienst zu verbinden, war eine typische liberalistisch-marxistische Koalitionsidee. Die Zeit für solche Machenschaften war aber vorüber. Die Kabinettsberatungen, in deren Mittel- [235] punkt vor allem auch das umfangreiche Arbeitsbeschaffungsprogramm und die Prämienanleihe standen, kamen nicht vom Fleck. Im Gegenteil: die Arbeiten, die dazu dienten, aufs neue Wirtschaft und Politik im liberalistisch-marxistischen Sinne zu verquicken, scheiterten, und der Reichswirtschaftsminister Warmbold erklärte am 3. Mai seinen Rücktritt. Die Stegerwaldsche Arbeitszeitverkürzung glaubte er nicht verantworten zu können. Er wandte sich in einer ausführlichen Denkschrift, darin er aufs schärfste mit dem herrschenden System ins Gericht ging, an den Reichspräsidenten, doch dieser gelangte nicht einmal in den Besitz dieses Schriftstückes. Die ganze Politik Stegerwalds war ein Trümmerhaufen. Was wollte es besagen, daß in einigen Teilen Deutschlands, in Ostpreußen, Grenzmark, Mecklenburg-Strelitz, Niedersachsen, Vorbereitungen zur Erweiterung des freiwilligen Arbeitsdienstes getroffen wurden? Was wollte es besagen, daß der Reichsrat einem Kreditermächtigungsgesetz für den Reichsfinanzminister Dietrich zustimmte, wonach dieser "im Wege der Ausgabe von Schuldverschreibungen" Mittel für Arbeitsbeschaffung, Siedlung, Bodenverbesserung, Beschäftigung Jugendlicher flüssig machen durfte? Was wollte es besagen, daß der Reichsrat der Prämienanleihe zustimmte und die sozialistische Preußenregierung ausdrücklich betonte, daß es unbedingt notwendig sei, die Arbeitsbeschaffung mit einer energischen Arbeitszeitverkürzung zu verbinden? Stegerwald selbst erkannte, daß es sich bei allem nur um taube Blüten handelte, und den Gewerkschaften, die ihn hart bedrängten, ließ er keinen Zweifel mehr, daß der Zusammenbruch der Arbeitslosenfürsorge unmittelbar nahe bevorstände. Ja, die Fürsorge stand vor der Katastrophe, aber trotz aller verzweifelten Versuche und Pläne waren neue Wege nicht gebahnt. – Inzwischen aber stieg die Flut der Arbeitslosigkeit weiter. So sah sich die Reichsbahn gezwungen, Mitte Mai etwa 10 000 Angestellte und Arbeiter zu kündigen und zu entlassen. –
All dies war außerordentlich beschämend für Deutschland. In England entrüstete man sich über die deutsche Schwäche: Deutschlands Schwäche sei seine Hoffnung auf Genf und den Völkerbund. Den deutschfreundlichen Ausländern war es unfaßbar, wie passiv Deutschland sich den drohenden Gefahren gegenüber verhielt. Das war aber gar nicht weiter zu verwundern. Der Zentrumskanzler Brüning war durch die Vergangenheit des Zentrums zur Untätigkeit verurteilt, war doch das Zentrum vor 1914 die stärkste Triebkraft des polnischen Separatismus im preußischen Osten. Und der Demokrat Groener hielt es für notwendiger, innenpolitische Eifersüchteleien zu treiben als die sich darbietenden nationalen Kräfte zur Abwendung großer Gefahren zu benutzen. Weil man einen S.A.-Befehl gefunden hatte, wonach beim Anmarsch polnischer Truppen die S.A. dem Führer Hitler zur Verfügung gehalten werden sollte, glaubte Groener seine Macht bedroht und witterte in den kommenden Dingen die Gefahr, daß ein polnischer Einfall der deutschen Demokratie den Todesstoß versetzen könne. Daraus konstruierte der Minister seine Behauptung vom Hoch- und Landesverrat der S.A. und S.S.! [237] Gegen diese kleinlichen Parteipolitiker wandten sich die Generale von Schleicher und von Hammerstein. Sie sahen in dem Demokraten Groener geradezu eine Gefahr für die deutsche Wehrmacht. So wurden die Spannungen zwischen der Reichswehr und ihrem Minister immer stärker. Als Reichswirtschaftsminister Warmbold zurücktrat, schrieben die englischen Zeitungen, eine Kamarilla, geführt von den Generalen von Schleicher und von Hammerstein, arbeite am Sturze der Regierung Brüning. Diese Behauptung war aber plump. Von einer Kamarilla konnte man bei derart für das ganze Volk wichtigen Vorgängen nicht reden. In diesen Tagen, Anfang Mai 1932, griff auch die Bayrische Volkspartei die beiden Generale heftig an, weil sie eifrig den Sturz Groeners betreiben sollten und, unter Hinweis auf den Ausgang der Wahlen, eine radikale Umbildung der Reichsregierung verlangten. Das sei aber eine vollkommene Verfälschung des politischen Sinnes und Zweckes der ganzen Hindenburgwahl. Groener mußte ja nun erkennen, wie seine Stellung gefährdet war, denn außer Zentrum, Bayrischer Volkspartei und ein paar Demokraten hatte er niemanden hinter sich, nicht einmal die Reichswehr. Die Lage Deutschlands Anfang Mai 1932 hatte eine sehr große Ähnlichkeit mit der Lage in dem Deutschland unmittelbar vor dem Kapp-Putsch. Aber für die Reichsregierung war die Lage von 1932 wesentlich gefährlicher als die von 1920! Denn im Gegensatz zu 1920 war 12 Jahre später die nationale Bewegung Deutschlands zu einer gewaltigen Macht konzentriert und besonnener, daher stärker. Der Minister aber ließ sich nicht beirren. Hindenburg hatte es Groener sehr nahegelegt unter Hinweis auf die Gerechtigkeit und das überdies vorliegende schwer belastende Material, die Frage zu prüfen, ob nicht auch das Reichsbanner verboten werden müsse. Doch Höltermann, der Reichsbannergeneral, ging bei Groener ein und aus und redete honigsüße Worte. Und dann kamen die Vertreter der verschiedenen Parteien und erteilten dem Minister ihre Ratschläge. Nur die Nationalsozialisten, die Deutschnationalen und die Kommunisten hielten sich dem demokratischen Minister fern. So geschah es denn, daß [238] Groener die ganze Reichsbannerangelegenheit verschleppte und schließlich – Höltermann hatte inzwischen immer wieder beteuert, daß die Schutzformationen des Reichsbanners und die Eiserne Front längst aufgelöst seien – einen spitzfindigen Ausweg fand, welcher dem S.A.-Verbot den offensichtlichen Charakter einseitiger Ungerechtigkeit nehmen und den Schein der Gerechtigkeit wiederherstellen sollte. Groener ließ den Reichspräsidenten am 3. Mai 1932 eine Notverordnung über Militärverbände unterzeichnen, die das Verbot über S.A. und S.S. aufrecht erhielt, dagegen den Minister des Zwanges überhob, das Reichsbanner zu verbieten. Der erste Paragraph dieser Notverordnung besagte:
"Politische Verbände, die militärähnlich organisiert sind oder sich so betätigen, und ihre Unterverbände sind verpflichtet, dem Reichsminister des Innern auf Verlangen ihre Satzungen zur Prüfung vorzulegen. Sie haben ferner dem Reichsminister des Innern jede beabsichtigte Satzungsänderung, soweit sie ihre Organisation oder ihre Tätigkeit betrifft, unverzüglich anzuzeigen. Die... genannten Verbände sind verpflichtet, unverzüglich jede Satzungsbestimmung zu ändern oder zu streichen und jede Bestimmung in die Satzung neu aufzunehmen, soweit dies der Reichsminister des Innern zur Sicherung der Staatsautorität für erforderlich hält; dies gilt insbesondere für Bestimmungen über die Organisation und Tätigkeit der Verbände." Nach dem dritten Paragraphen hatte der Reichsinnenminister außerdem das Recht, zu bestimmen, welche Verbände als militärähnliche politische Verbände im Sinne der Verordnung anzusehen sind. Diese Verordnung war ein Meisterwerk jesuitischer Wortspalterei, und es war leicht zu erkennen, daß ihr geistiger Vater weniger Groener, als vielmehr Höltermann war. Es war noch einmal ein Sieg marxistischen Geistes in der Innenpolitik des Reiches. –
Zunächst verbreitete sich der Reichsfinanzminister Dietrich über die hoffnungslose Finanzlage des Reiches, die ein Defizit von fast 2 Milliarden aufwies, und sprach für eine Kreditermächtigung in Höhe von 2½ Milliarden. Die Nationalsozialisten erwiderten ihm durch ihren Sprecher Reinhardt, sie dächten nicht daran, dem Kreditermächtigungsgesetzentwurf zuzustimmen, sie behielten sich vielmehr vor, gegen die Reichsregierung Anklage zu erheben vor dem Deutschen Staatsgerichtshof wegen bewußter Verfassungsverletzung.
Nun suchte sich Groener zu verteidigen. Das Verbot gründe sich auf die Gefahr für die Staatsautorität. Der Minister verlas Stellen aus Hitlers Reden und S.A.-Befehlen und erklärte, er sei mit seinen Mitarbeitern und Ratgebern völlig einig. Das Reichsbanner sei in keiner Weise gegen den Staat eingestellt, wie es bei der S.A. der Fall gewesen sei. Die Aufgabe des Reichsbanners werde in der Bundessatzung auf den Schutz der Reichsverfassung abgestellt. Das Ergebnis der Nachprüfung des Reichsbannermaterials habe die Vorwürfe nicht bestätigt. Zu den Vorwürfen der Bürgerkriegshetze beim Reichsbanner sei festzustellen, daß tatsächlich einzelne rednerische Ent- [240] gleisungen erfolgt seien, aber eine Umsturz- oder Bürgerkriegsvorbereitung seitens des Reichsbanners könne daraus nicht abgeleitet werden. Nach dieser Rede beantragte Strasser, Groeners Ausführungen im Rundfunk zu verbreiten. Ferner solle man die Beratungen unterbrechen, damit das Reichskabinett überlegen könne, ob Groener noch weiter Minister bleiben könne, – "ob dieser Mann weiterhin die öffentliche Sicherheit gewährleisten und die Armee in Deutschland führen soll." Ein ungeheurer Tumult erhob sich, so daß die Sitzung unterbrochen werden mußte. Am dritten Tage der Verhandlungen legte Brüning wieder einmal sein Regierungsprogramm dar, das bei der Opposition wenig freundliche Aufnahme fand. Er konnte nicht umhin, mit einer seiner üblichen agitatorischen, durch keine Tatsachen bewiesenen Redewendungen die Nationalsozialisten anzugreifen:
"Wenn Sie daran denken, in so kritischer Zeit die Macht zu erobern, so rate ich Ihnen dringend, in Ausdrücken, in Formeln und im Inhalt der Agitation sich rechtzeitige Beschränkung aufzuerlegen, denn die Hoffnungen, die Sie geweckt haben, können Sie nie erfüllen. Ich würde den größten politischen Fehler begehen", schloß er, "wenn ich bei den letzten hundert Metern die Ruhe verlöre!" Der letzte Tag der Reichstagssitzung brachte die Explosion. Man saß im Plenum und gab sich der Beschäftigung der Abstimmungen hin. Man wußte ja schon vorher, daß die Regierung Brüning wieder eine knappe Mehrheit von 30 Stimmen erhalten würde, da die Wirtschaftspartei durch ihren Abgeordneten Hermann erklärt hatte, sie würde in der jetzigen Zeit der schwersten außenpolitischen Entscheidungen dem Kanzler nicht in den Rücken fallen und daher das Mißtrauensvotum gegen die Regierung ablehnen. So geschah es denn, daß das Kreditermächtigungsgesetz zunächst mit 287 gegen 260 Stimmen angenommen wurde, und daß sodann die Mißtrauensanträge der Nationalsozialisten, Deutschnationalen und Kommunisten, für die auch Deutsche Volkspartei und Landvolk eintraten, mit 287 gegen 257 Stimmen abgelehnt wurden. Während dieser Sitzung wurde bekannt, daß im Reichstagsrestaurant der Reichsbannerjournalist Dr. Klotz nach heftigen [241] Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten Strasser, Krauß, Heines, Stegmann, Weitzel von einigen dieser Abgeordneten und von Nichtabgeordneten überfallen und geohrfeigt wurde. Der Tumult setzte sich in den Wandelgängen fort. Der sozialistische Reichstagspräsident Löbe vertagte hierauf die Sitzung um eine Stunde und teilte mit, daß er die Kriminalpolizei angewiesen habe, die Täter festzunehmen, ganz gleich, ob sie dem Parlamente angehören oder nicht. Ein wilder Tumult brach aus. Von den Tribünen des Publikums ertönten immer wieder Rufe: "Heil Hitler! Heil Hitler!" Polizei drang ein und räumte die Tribüne. Dann betrat ein Polizeioffizier mit 20 Beamten in Uniform den Sitzungssaal. Die Beamten sprangen über die Ministerbänke hinweg in die Reihen der nationalsozialistischen Fraktion. Ungeheurer Lärm erhob sich. Der sozialistische Polizeivizepräsident von Berlin, Weiß, mitten unter den Beamten, wurde in Zurufen als "Verräter" bezeichnet. Die Beamten verhafteten Strasser, Heines, Stegmann und Weitzel und verließen den Saal. Die Handlungsweise Löbes erregte Abscheu und Entsetzen bei allen anständig denkenden Menschen. Das Ausland war voller Empörung über diesen Marxisten, man zog Vergleiche mit der kaiserlichen Regierung und fand, daß diese viel zu vornehm gewesen sei, um je die Immunität in dieser brutalen Weise zu verletzen. – Das Verfahren gegen die Nationalsozialisten kam vor den Schnellrichter. Strasser wurde freigesprochen, die drei andern erhielten je drei Monate Gefängnis.
Mit Genugtuung nahmen die Nationalsozialisten von Groeners Rücktritt Kenntnis. Der Mann, der die S.A. verboten hatte, erschien ihnen als der Prototyp des Novembersystems. Groeners Rücktritt, schrieb der Völkische Beobachter, bedeute zum mindesten für die Wehrmacht die endgültige Liquidierung des Novemberkurses. Dieser Erfolg bedeute die Garantie, daß die restlose Überwindung des gesamten Systems nur eine Frage der Zeit sein werde:
"Ferner erwarten wir, daß der Reichspräsident nunmehr eingehend unterrichtet wird, was nichts anderes bedeuten kann als den Rücktritt des Kabinetts, Berufung eines neuen Kanzlers, Auflösung des Reichstages nebst sofort folgenden Neuwahlen." Die deutsche Koalitionspresse wetterte über die Intrigen der "Generalskamarilla", und das Ausland sprach von einem Siege der Nationalsozialisten. Brüning stand aber vor dem schwierigen Problem, sein stark leck gewordenes Regierungsschiff wieder auszubessern. Er hatte ja nun erkannt, wie mächtig der Einfluß der Nationalsozialisten nach den letzten Wahlen geworden war, und hatte sich mit den Gedanken abgefunden, auch Angehörige dieser Partei in sein Kabinett vielleicht aufzunehmen. Es gab aber schier unüberwindliche Hindernisse: die Nationalsozialisten wollten nicht mit dem Reichskanzler Brüning zusammenarbeiten und forderten außerdem Reichstagsneuwahlen. Außerdem lag in dem preußischen Schwebezustande eine derartige Gewitterspannung, daß Brüning gar nicht daran denken konnte, eine endgültige Lösung zu finden. Alle seine Bemühungen, das Ministerium der Wirtschaft und der Reichswehr neu zu besetzen, scheiterten daran, daß infolge des gewaltigen nationalsozialistischen Gegendruckes niemand mehr Vertrauen zu Brünings Regierungssystem hatte. Der ehemalige Preiskommissar Dr. Goerdeler, der als Reichswirtschaftsminister in Aussicht genommen war, konnte sich nicht zur Annahme entschließen. General Schleicher verzichtete auf das Reichswehrministerium in einem Kabinett Brü- [243] ning. Und Groener drohte: falls Schleicher Reichswehrminister würde, würde er auch als Reichsinnenminister zurücktreten. Doch Brüning wollte Groener nicht verlieren, weil ihm sonst mit diesem die Sozialdemokratie als parlamentarische Unterstützungstruppe verloren ging und dadurch der endgültige Sturz der Regierung besiegelt gewesen wäre. Zudem waren der Ernährungsminister Schiele, der Reichsfinanzminister Dietrich und der Ostminister Schlange-Schöningen nun auch regierungsmüde, nachdem bereits Curtius, Wirth, Warmbold, Groener ihre Ministerien unter Brünings Kanzlerschaft aufgegeben hatten. Die Lage innerhalb der Regierung wurde immer unerfreulicher und gespannter, und es kam hinter verschlossenen Türen zu scharfen Auseinandersetzungen, über die man nach außen hin undurchdringliches Schweigen beobachtete. Die letzte Hoffnung Brünings war ein Machtwort Hindenburgs. Die Kölnische Zeitung forderte unter Hinweis darauf, daß die vier wichtigsten Ministerien unbesetzt seien, die Vorbereitung einer gründlichen Umbildung des Reichskabinetts in eine nationale Konzentrationsregierung. "Wir appellieren nochmals an den Reichspräsidenten, der zur Zeit als einziger imstande ist, zur Bildung der Einheitsfront aufzurufen."
Es war eigentümlich, wie Hindenburg, der Retter Ostpreußens im Jahre 1914, durch seinen ostpreußischen Aufenthalt zu einem völligen Umschwung seiner Ansichten in bezug auf [244] Brüning kam. Dem deutschen General und Heerführer, der einst die östliche Provinz von den Russen befreit hatte, erschien in Anbetracht der polnischen Bedrohung Ostpreußens der Zentrumskanzler und der demokratische Innenminister nicht mehr als zuverlässig und der Verteidigung der Ostgrenze gewachsen. Es war dies die allgemeine Ansicht in der abgeschnürten und der Demokratie feindseligen Ostprovinz, und sie war so überzeugend, daß Hindenburg sich ihr nicht entziehen konnte. Und noch etwas anderes kam hinzu. Brüning hatte in seiner geplanten Notverordnung ein Siedlungsprogramm für Ostpreußen entwickelt, dessen Ziel es war, die abgewirtschafteten und überschuldeten Großgüter von Staatswegen aufzukaufen und in bäuerliche Siedlungen aufzuteilen. Auf diese Weise sollte eine bäuerliche Wiederbesiedelung des deutschen Ostens im großen Stile durchgeführt werden. Das war natürlich Theorie, wie so vieles, was Brüning plante. Und über die praktische Durchführung war die Regierung selbst noch nicht einig. Immerhin legte der ostpreußische Adel entschiedenen Protest bei Hindenburg gegen diese Pläne ein, der Freiherr von Gayl entwickelte in einer Denkschrift, die dem Präsidenten zugeleitet wurde, daß die Zwangsenteignung des Großgrundbesitzes dem Reiche unerschwingliche Ausgaben auferlegen würde. Hindenburg ließ diese Gründe vollkommen auf sich wirken und geriet dadurch in immer tieferen Gegensatz zur Politik Brünings. So wurden die Neudecker Gespräche, die sich vor dem Hintergrunde der großen Ereignisse abspielten, ein wesentlicher Grund für den Sturz der Brüning-Diktatur. – Der sich immer mehr auf den Sturz der demokratischen Diktatur zuspitzende Gang der Ereignisse erhielt seinen Hintergrund durch die Vorgänge in den deutschen Ländern, vor allem in Preußen. Verhältnismäßig einfach war die Entwicklung in Anhalt. Hier bekamen die Nationalsozialisten nach Pfingsten das Landtagspräsidium und das Amt des Ministerpräsidenten, das dem Regierungsrat Freyberg aus Quedlinburg übertragen wurde. So wurde zum ersten Male in einem deutschen Lande ein Nationalsozialist Ministerpräsident. Der zweite Minister, Dr. Knorr, war ein Deutschnationaler. In Württem- [245] berg jedoch kam es zu Schwierigkeiten, da die Nationalsozialisten die Ämter des Staatspräsidenten und Innenministers beanspruchten, wogegen aber Zentrum und Demokraten protestierten. Die Wahl des Staatspräsidenten am 24. Mai verlief erfolglos, worauf der bisherige Staatspräsident Dr. Bolz, dem Zentrum angehörig, und die Minister die Geschäfte weiterführten.
Am hoffnungslosesten war die Lage der Sozialdemokratie. Sie mußte erkennen, daß es mit ihrer Herrschaft vorbei war. Dennoch durfte sie nichts unterlassen, sich Freunde zu suchen. Sie verhandelte also mit den Kommunisten, von denen sie wußte, daß sie nie einer nationalsozialistischen Regierung zur Macht verhelfen würden; und die Kommunisten anderseits sahen in der Sozialdemokratie das kleinere Übel gegenüber dem Nationalsozialismus. Es war ein Gebot der Selbsterhaltung, daß sich die Kommunisten mit allen Kräften einer Machtergreifung durch die Nationalsozialisten widersetzen würden. Von dieser Seite war, trotz aller Gegnerschaft gegen Braun und Severing, keine Änderung der neuen Geschäftsordnung zu befürchten. In der Opposition gegen rechts waren sich also die Marxisten beider Richtungen einig. Es war ein regelrechter Kuhhandel gewesen: die Kommunisten verpflichteten sich, im Landtag gegen jede nationale Regierung zu stimmen, Braun und Severing versicherten dafür die Kommunisten ihrer Gnade und Nachsicht bei ihrer meuchelmörderischen Bürgerkriegstätigkeit. Anderseits versuchte die Sozialdemokratie auch Fühlung mit dem Zentrum zu behalten, wie sich ja das schwarz-rote Bündnis in der bisherigen Regierungskoalition vorzüglich bewährt hatte. Die Sozialdemokraten rechneten damit, daß das Zentrum ein Zusammenarbeiten mit Rechts im Preußenkabinett ablehnen werde, wenn dafür der Sturz Brünings als Preis gefordert werde. [246] Diese sozialistische Koalitionspolitik, gerichtet auf ein starkes Zusammenfassen der Linken und der Mitte, hatte große Ähnlichkeit mit den Ereignissen, die dem Umsturz vom November 1918 vorausgingen. Dennoch aber war die Lage grundverschieden: 1918 befand sich die Sozialdemokratie in einem Zustand der Stärke und des Angriffs, 1932 aber in einem Zustand der Schwäche und Abwehr. 1918 gab es keine nennenswerte Rechte mehr, 1932 machte die unbedingte nationale Opposition fast die Hälfte des ganzen Parlamentes aus! Der Ministerpräsident Braun hatte sehr wohl diesen verhängnisvollen Wechsel erkannt. Ihm zu begegnen war der Sinn der Geschäftsordnungsänderung. Was aber war damit erreicht? Welchem Minister, der sich so verzweifelt an seinen Sessel klammerte, würde es auf die Dauer rein menschlich möglich sein, gegen eine mächtige Opposition zu regieren? Neue Pläne tauchten auf: Braun war zum Verzicht bereit, wenn von der Reichsregierung Brüning ein Reichskommissar für Preußen ernannt würde. Der alte sozialistische Plan der Reichsreform sollte auf diesem Umwege verwirklicht werden. Dieser Reichskommissar würde aufs neue die feste, unlösliche Verbindung zwischen Sozialdemokratie und Zentrum hergestellt haben, daran aber hatte das Zentrum nach den veränderten Verhältnissen kein Interesse mehr. Übrigens erhob sich die Bayerische Volkspartei mit ihrem separatistischen Herzen dagegen: eine solche Verzichterklärung des preußischen Staates würde die schwerste Erschütterung für das gesamte innere Reichsgefüge bedeuten; eine gesamtdeutsche Frage würde aufgerollt, bei der alles, was zum Deutschen Reiche gehöre, mitzureden und mitzuentscheiden habe.
Es gab also Strömungen in der Preußenregierung, die das System möglichst lange durch ihre Geschäftsführung stützen wollten, um den erhofften Widerstand des Zentrums gegen die Nationalsozialisten zu stärken und so eine befürchtete Regierungskoalition zwischen beiden Parteien zu verhindern. Nur schwer konnte sich die alte Koalition von der Macht trennen. Deshalb auch verzögerte sie so lange wie möglich die Auflösung des alten und die Einberufung des neuen Landtages.
Allerdings wurden offizielle Verhandlungen zwischen Nationalsozialisten und Zentrum nicht gepflogen. Dennoch konnte Kube, der Führer der Nationalsozialisten in Preußen, schon am Ende der ersten Maiwoche erklären, der Traum einer Verständigung zwischen Zentrum und Nationalsozialisten in Preußen sei ausgeträumt.
Wochenlang waren die Dinge in Preußen in der Schwebe. Wenige Tage vor dem Zusammentritt des neuen Landtages, am 19. Mai, hielt die Preußenfraktion der Nationalsozialisten ihre erste Sitzung ab. Adolf Hitler sprach. Die nationalsozialistische Bewegung habe nicht 13 Jahre gekämpft, um die Politik des heutigen Deutschland in irgendwelchen Koalitionen fortzusetzen. Aber es gebe in Preußen keine Regierung, welche die Nationalsozialisten nicht wollten. "Wir können warten!" Das war der Sinn der Hitlerschen Erklärung. Kube ergänzte die Ausführungen: im Vordergrunde stehe nicht die Regelung der preußischen Finanzen, sondern die Regelung des deutschen Rechts in Preußen und die Säuberung der Verwaltung und der Polizei sowie der Schule von ungeeigneten Elementen. Zusammenfassend meinte Kube:
"Unsere Vorbereitungen für die sachliche Arbeit wie für den weiteren Kampf um den Staat [249] sind getroffen. Das Zentrum befindet sich in der Lage des Senats von Karthago, wir in der jenes Römers, der in seiner Toga den Krieg und den Frieden birgt: Nun wählen Sie, meine Herren vom Zentrum: Uns kann beides recht sein!" Aus diesen Äußerungen entnahm das Zentrumsblatt Germania, daß die Nationalsozialisten offenbar nicht gewillt seien, in irgendeine Regierungskoalition einzutreten. Nun gut, dann müßten sie eben allein die Verantwortung für ihre Schlußfolgerung aus dem 24. April übernehmen. Das Zentrum könne getrost weiter abwarten. Die preußische Zentrumsfraktion trat ihrerseits am 20. Mai zusammen. Sie sei bereit, mit allen Kräften, die verfassungsmäßige Ordnung und aufbauende Politik wollten, sachlich zusammenzuarbeiten. Aber bei dem starken Zusammenhang zwischen dem Reich und Preußen sei es selbstverständlich, daß die preußische Zentrumsfraktion ihre Politik im engsten Zusammenhang und in engster Zusammenarbeit mit der Reichstagsfraktion und dem Reichskanzler Dr. Brüning zu führen haben werde. Neubindungen und politische Änderungen in Preußen könnten nur im Einvernehmen mit der Reichsparteileitung und dem Reichskanzler vorgenommen werden. Also auch hier war man nicht geneigt zu irgendwelchen Zugeständnissen. Es stand ganz offensichtlich als Hindernis zwischen den beiden Machtgruppen der Nationalsozialisten und des Zentrums die Persönlichkeit des Reichskanzlers Brüning. Am 24. Mai trat der neue Landtag zusammen. Der Ministerpräsident Braun hatte ein Schreiben an den Präsidenten des alten Landtages gerichtet, worin er den Rücktritt des Gesamtkabinetts mitteilte. Er berührte mit keinem Worte, daß die Regierung die Geschäfte weiterführen werde. Das war ja aber nach Lage der Dinge ganz selbstverständlich.
"Die Amtsführung durch den bisherigen Ministerpräsidenten und durch die bisherigen Minister, gleichgültig auf welcher formellen Rechtsgrundlage sie erfolgen sollte, entbehrt des Vertrauens des Landtages." Zugleich wurde von den Deutschnationalen die Wiederherstellung der alten Geschäftsordnung beantragt.
"Die Sozialdemokraten sind es, die hervorragende Mitglieder dieses Hauses bereits als Mörder beschimpfen. Die preußische Staatsanwaltschaft ist zu 90 Prozent wert, wegen Rechtsbeugung in Anklagezustand versetzt zu werden." Darauf erhielt der Kommunist Pieck das Wort. Er schrie zu den Nationalsozialisten: "In Ihren Reihen sitzen eine ungeheure Zahl von Mördern!" Die Nationalsozialisten drängten nun nach vorn, während die Kommunisten auf die Rednertribüne stürzten, ihren Redner schützten und wilde Drohungen ausstießen. Die Nationalsozialisten drängten die Treppe zur Rednertribüne empor. Als der Nationalsozialist Hinkel die oberste Stufe erreicht hatte, erhielt er von einem Kommunisten einen Schlag ins Gesicht. Jetzt gingen die [251] Gegner mit Fäusten aufeinander los. Die in den hinteren Reihen stehenden Kommunisten schleuderten Tintenfässer und Wassergläser. Im Nu waren 200 Abgeordnete in wüstem Kampf verknäult. Mit Tischkästen, Aktenbündeln, Stühlen, Lampen schlugen sie aufeinander ein. Es war ein beispielloser Lärm, der noch durch das Toben auf den Tribünen vermehrt wurde. Aber schon nach wenigen Minuten mußten die Kommunisten, verfolgt von den Nationalsozialisten, die Flucht ergreifen. Die Nationalsozialisten besetzten jetzt dichtgedrängt die Estraden neben dem Rednerpult und stimmten das Horst-Wessel-Lied an. Die übrigen Abgeordneten verließen zum größten Teil die trostlose Trümmerstätte. Auf Seiten der Sozialdemokraten und Kommunisten hatte es 16 Verwundete gegeben. Der Sachschaden dieses Sturmes wurde auf 9000 Mark geschätzt. –
Die Vorfälle im Reichstag und Preußischen Landtag bewiesen, in welcher schweren geistigen Krise das deutsche Volk sich befand. Jetzt war der Augenblick gekommen, wo die tödlichen Gegensätze Nationalsozialismus und Marxismus mit voller Gewalt aufeinanderprallten, nicht mehr durch den Puffer der Mittelparteien getrennt. Jetzt war es soweit, daß Macht gegen Macht stand, und daß es sich unbedingt erweisen mußte, auf welcher Seite die größere Macht war. Dies erwies sich auch ganz klar: sie war auf der Seite des Nationalsozialismus. Seine unermüdlichen Stöße, immer schwerer, immer wuchtiger werdend, hatten ein Hindernis nach dem andern niedergeschmettert. Jetzt standen sie vor der letzten Festung: der Regierung selbst. Das Volk hatte in der ganz unerhörten Krise der Zermürbung, in der es sich befand, den einzigen Ausweg der Rettung im Nationalsozialismus erkannt. Das zeigte sich wieder bei den Landtagswahlen, die am 29. Mai in Oldenburg stattfanden, nachdem der dort erst 1931 gewählte Landtag kraft Volksentscheid wieder aufgelöst worden war. Von 272 000 Stimmen erhielten die Nationalsozialisten 132 000 (1931: 98 000), und von 46 Sitzen des Parlamentes fielen ihnen 24 zu, die absolute Mehrheit! (1931: 19.) Das zeigte sich auch wieder bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Schwerin am 5. Juni 1932, wo die Nationalsozialisten [252] von 360 000 Stimmen etwa 180 000 erhielten (am 23. Juni 1929 nur 12 721). Von den 59 Parlamentssitzen kamen jetzt 30 in ihre Hand, während sie 1929 von 51 Sitzen nur 2 erhielten! Also auch in diesem Lande stand die absolute Mehrheit der Nationalsozialisten fest. Und das zeigte sich schließlich bei den Landtagswahlen in Hessen am 19. Juni, wo die Nationalsozialisten von 70 Mandaten 32 eroberten, noch 5 mehr erhielten als bei den Wahlen Mitte November 1931. Nationalsozialismus gegen liberalistische Demokratie, das war jetzt keine theoretische Prinzipienfrage mehr, das war ein politisches Problem von unübersehbarer Tragweite geworden! Die stärkere Macht stand gegen die schwächere Macht, und dieser Umschwung war derart elementar, daß für Brüning keine Möglichkeit des Widerstandes mehr existierte. Brüning, der Träger eines zur Diktatur entarteten liberalistischen Minderheitsregierungssystems, wurde auf den letzten 100 Metern seiner vermeintlichen Siegerlaufbahn von dem Zyklon erfaßt und zu Boden geworfen!
Gegen Ende Mai nahmen die Steuernotverordnungspläne festere Gestalt an. 620 Millionen neue Steuern sollten geschaffen werden: die neue Beschäftigungssteuer sollte 325 bringen, davon allein 120 von der Beamtenschaft, die nochmalige Erhebung der Bürgersteuer sollte noch einmal 250 Millionen Mark eintragen, von der Verlängerung der Krisensteuer um ein Jahr erhoffte man 45 Millionen. Außerdem wollte die Regierung nun ernstlich ihr Arbeitsbeschaffungsprogramm durchführen. 600 Millionen waren dazu nötig, die zunächst durch einen Zwischenkredit beschafft, dann durch eine aufzulegende Prämienanleihe aufgebracht werden sollten. Am Ende der letzten Maiwoche legte Brüning seine neue Notverordnung dem Reichspräsidenten vor. Der aber war nicht sogleich zur Unterschrift bereit. Er wünschte Änderungen, z. B. daß die Kriegsrenten nicht gekürzt würden. Zum ersten Male zeigte Hindenburg, daß er nicht willens war, bedingungslos seinem Kanzler zu folgen. Brüning aber hegte noch immer Hoffnungen. Er war fest entschlossen, den Kampf mit seinen Gegnern aufzunehmen, ja, er wollte den Reichspräsidenten um diktatorische Vollmachten für eine grundsätzliche Umbildung seines Kabinetts bitten. Während es also Brüning immer noch versuchte, mit verzweifelten Kräften sein Regiment zu halten, grollten draußen im Lande die zermürbten und verzweifelten Volksmassen. Der tückische Kleinkrieg der Kommunisten gegen die Nationalsozialisten war eine tägliche Erscheinung, die schon geradezu zur Gewohnheit geworden war. Aber die Kommunisten rührten sich wieder mehr, sie versuchten aus dem allgemeinen Wirrwarr ihren Vorteil zu schlagen, Severing drückte ja beide Augen zu. Schon bei den Feiern am 1. Mai kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, so in Bremen, wo sieben Beamte verletzt wurden. Vor allem aber suchten die Kommunisten, wie stets in Krisenzeiten, die Erwerbslosen aufzuputschen. Und so kam es, daß sich im Mai die Plün- [254] derungen in den Großstädten, die Angriffe auf Arbeitsämter häuften. So kam es wiederholt zu Plünderungen in Leipzig, auch in Essen; in Hamburg versuchten die Kommunisten am 23. Mai ins Arbeitsamt einzudringen und verwundeten Polizeibeamte, einige Tage später veranstaltete eine Demonstration kommunistischer Erwerbsloser Straßenkrawalle auf dem Jungfernstieg, wo die Schaufenster eingeworfen wurden und die Polizei mit Revolver und Gummiknüppel vorgehen mußte. 15 Menschen wurden dabei verletzt. Am gleichen Tage, den 26. Mai, kam es in Berlin zu acht Zusammenstößen, in Wuppertal drangen 300 Menschen in das Barmer Rathaus ein, andre zerschlugen Schaufenster, plünderten Lebensmittel. In Düsseldorf kam es zu Ausschreitungen. In Köln, Gladbach-Rheydt, Stettin, Beuthen erhob sich eine drohende Woge des Aufruhrs. Die Großstädte wollten sich nicht wieder beruhigen. In den letzten Tagen des Mai kam es wieder in Hamburg und Wuppertal zu regulären Feuergefechten. In Altona wurde geplündert. In Duisburg und Remscheid floß Blut. Selbst in der kleinen Stadt Waltershausen, die wie alle Orte des Thüringer Waldes sehr unter der Arbeitslosigkeit zu leiden hatten, kam es zu einem regelrechten Kampf, in dem Tote und Verletzte blieben. Die Lage Deutschlands hatte große Ähnlichkeit mit der vom Herbst 1923. Es war überhaupt das Merkwürdige, daß in diesem entscheidenden Wendepunkte der deutschen Geschichte noch einmal das ganze traurige Los des deutschen Volkes innerhalb der letzten 15 Jahre wie in einem Spiegel abrollte. Noch einmal drängten die Tendenzen der Novembertage 1918, der Märztage von 1920 und der Oktobertage von 1923 zu einem gemeinsamen Höhepunkte zusammen, um mit gewaltiger Explosion aufeinanderzuprallen, wenn sie nicht gebändigt wurden. Das war das hippokratische Gesicht des demokratischen Novembersystems. Deutschland kreißte in den Wehen einer neuen Zeit, und über Brüning schlugen die Wogen zusammen. –
"von Brüning zum Volke und vom Volke zu ihm trotz aller modernen Verkehrs- und Mitteilungsmöglichkeiten kaum mehr Fäden hinüberreichen als zu einem Mönch in seiner einsamen Zelle, und er selbst seinen Mitarbeitern im Kabinett fremd und rätselhaft geblieben sei". (Saale-Zeitung, 17. Mai 1932, Nr. 113.) Brüning hatte sich nicht als der bewegliche Meister des politischen Lebens bewährt, er war der starre Fanatiker eines politischen Dogmas geblieben. Hindenburg mußte erkennen, wie schon Millionen Deutscher es erkannt hatten, daß die Zukunft Deutschlands unter Brünings Regiment in hoffnungsloses Dunkel gehüllt war. Besonders schmerzte ihn das Empfinden, daß seine politischen Empfänge in Neudeck durch einen Vertrauensmann Brünings überwacht wurden. Täglich appellierten Parteien und Organisationen an den Reichspräsidenten, baten dringend um Abhilfe. Wie es in dem Appell der deutschnationalen Reichstagsfraktion geschah, wo die Unmöglichkeit dargelegt wird, daß Brüning weiterhin gegen Volk und Reichstag regieren könne.
"Wir machen nun in aller Ehrerbietung darauf aufmerksam, daß, Brünings Pläne in die Tat umgesetzt, in breiter Volksmasse die schon vorhandene Erregung in einem Maße steigen müsse, daß sie sich unter Umständen in Formen Luft macht, die kein vaterlands- [256] liebender Deutscher bei der höchst gespannten Lage wünschen kann." Das war ein Vorstoß von starker Wucht. Dann aber erhielt Brüning einen noch viel schwereren Schlag. Am 28. Mai entschied der Oberreichsanwalt in Leipzig, daß Severings Landesverratsklage gegen die nationalsozialistischen Sturmabteilungen zurückgewiesen werden müsse. Der Verdacht des Landesverrates gegen irgendeine Stelle der nationalsozialistischen Partei sei nicht stichhaltig und lasse sich aus keinem der vorgelegten Schriftstücke herleiten. Diese Entscheidung traf nicht allein den preußischen Innenminister Severing, sondern auch den Reichsinnenminister Groener, der ja in seiner Reichstagsrede ausdrücklich sein S.A.-Verbot mit dem Vorwurf des Landesverrates begründete. Und nun wurde von nationalsozialistischer Seite erklärt, es stehe somit gerichtsnotorisch fest, daß der Reichspräsident über eine der wesentlichsten Voraussetzungen des S.A.-Verbotes unzutreffend unterrichtet worden sei. Daraus folge, daß die Minister die einzig mögliche Konsequenz ziehen und sofort zurücktreten müßten.
[257] Es war eine kurze Aussprache unter vier Augen, die schließlich abgebrochen wurde. Sie hatte offenbart, daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen Reichspräsident und Reichskanzler jetzt unüberbrückbar geworden waren. Aber Brüning, der bis zum letzten Augenblick voller Hoffnung war, erkannte auf einmal, daß er am Ende war. Er war nicht gewillt, dem Reichspräsidenten nachzugeben, Groener zu opfern und sich den Nationalsozialisten zuzuwenden. Am Vormittag des 30. Mai, einem Montag, hielt der Kanzler eine halbstündige Kabinettssitzung ab. Man wurde einig, dem Reichspräsidenten nicht nachzugeben, sondern den Rücktritt zu erklären. Der Empfang Brünings bei Hindenburg war ganz kurz. Nach dem Berichte des Kanzlers nahm der Präsident den Rücktritt der Regierung ohne jede weitere Aussprache an. Die Regierung war entlassen, und Hindenburgs besondere Ungnade traf Groener. – Der sozialdemokratische Abend schrieb nicht ganz unrichtig: "Ausgelöst worden ist die Krise durch Einflüsse aus der Reichswehr und aus ostpreußischen Großgrundbesitzerkreisen." Die Sozialdemokratie vergaß hierbei, daß diese Einflüsse erst wirksam werden konnten durch die große, unangreifbare Macht der Nationalsozialisten, die hinter ihnen stand und der sich Brüning sinnlos widersetzte! –
Heinrich Brüning lebte streng in der religiösen Disziplin seiner Kirche. Er hatte, wie man sich erzählte, das Gelübde der Keuschheit abgelegt. Er war durch die Schule des preußischen Heeres gegangen und im Kriege Offizier geworden. [258] Aber dies blieb für ihn nur Episode, weil in ihm die religiöse Disziplin stärker war als die preußische Disziplin. Und daher kam es auch, daß Brüning das Bündnis mit der Reichswehr suchte, um einer rein äußerlichen Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit willen, "weil es dem militärischen Strom der Zeit entgegenkam", wie das Berliner Tageblatt am 4. Juni 1932 schrieb. Im Grunde hatte Brüning die preußische Disziplin durch Groener verraten, nicht aber hatten ihn, den Reichskanzler, die Generäle verraten! Diese religiöse Disziplin hatte etwas Mönchisches, Unfruchtbares, Mittelalterliches, von Zeit und Raum Gelöstes. Diese religiöse Disziplin ging in ihrer logischen Konsequenz so weit, daß sie gelegentlich bereit und imstande war, das zu leugnen, um dessentwillen Brüning eigentlich da war: das Volk. Brüning ist eine jener zeitlosen, typischen Erscheinungen der römischen Kirche, die ebensogut im zwölften wie im zwanzigsten Jahrhundert möglich sind, unberührt vom Ablauf der Zeiten, vom Wechsel der Tendenzen und Schicksale. Er war ein eigentümlicher Mann, in dem sich die Starrheit des Niedersachsen aufs engste mit der Starrheit der katholischen Kirche verband. Aus all dem ergab sich ein gewisses Maß auffälliger Überheblichkeit, eine Art unfehlbaren Alleswissens, eine absolute Leugnung jeden menschlichen Irrtums in den eignen Taten, so etwas wie ein Abglanz päpstlicher Unfehlbarkeit, der ein besonderes Merkmal des Zentrums und seiner Politiker darstellt. Ähnlich wie Erzberger kannte, wußte und verstand Brüning alles, er irrte sich nicht, er allein besaß das richtige Maß von Vaterlandsliebe und Nationalbewußtsein, er hatte eine ganz besondere Stufe des Vertrautseins mit Gott erreicht und durfte alle andern, jeden Gegner als Idioten betrachten, für den er nur ein mitleidiges Lächeln haben konnte. Diese Selbstüberhebung ging sogar soweit, daß Brüning gewissermaßen auch Einfluß auf den Reichspräsidenten beanspruchte und von außerordentlichem Zorn erfüllt war, als Hindenburg sich von ihm trennte. Brünings Stolz vor den Menschen hatte etwas Pharisäerhaftes. Er allein war der berufene Staatslenker. [259] Brüning war gescheitert, weil er gegen zwei Fronten gekämpft hatte. Er war der berufene Vertreter jener hierarchischen Demokratie, wie wir sie aus den geistlichen Hoheitsgebieten des Mittelalters kennen, jener hierarchischen Demokratie, die oben zwar die monarchische Nachfolge als ein Prinzip der Stetigkeit ablehnte, nach unten aber diktatorisch regierte; denn das Beständige, Zwingende in ihr war das Religiöse. In seinem Kampfe gegen den Reichstag wie gegen die Rechte griff Brüning auf dieses Diktatorische der hierarchischen Demokratie zurück. Dies wurde ihm leicht aus zwei Gründen: einmal, weil er ganz in der Disziplin seiner Kirche stand, die absolut diktatorisch von oben herab ist, zweitens aber, weil der Gedanke der Diktatur bereits immer breitere Volksmassen ergriff: Nationalsozialisten, Kommunisten und, seit Hugenberg an ihrer Spitze stand, die Deutschnationalen waren auf die Diktatur gerichtet. Aus diesen beiden zusammenfließenden Strömungen, der klerikalen Diktatur des allein herrschenden Zentrums und dem Zusammenströmen von politischen Energien aus den diktatorischen Parteien erhob sich die demokratische Diktatur Brünings. Es hat von 1919 bis 1930 keinen deutschen Kanzler gegeben, der ein schwierigeres Parlament hatte als Brüning. Es hat aber auch in der Zeit keinen Kanzler gegeben, der selbstherrlicher mit dem Parlament umgesprungen wäre als Brüning. Er hat sich in seinen Entschließungen niemals vom Parlament bestimmen lassen. Er verstand es aber, das Parlament bei den seltenen Gelegenheiten, in denen er es zusammenrief, stets seinem Willen gefügig zu machen. Brüning fragte nie nach Ansicht und Willen der Mehrheit, aber er schaffte sich trotzdem jede Mehrheit, die er brauchte. Gewiß, es bereitete ihm sichtlich Mühe, jedesmal die Parteien der bürgerlichen Mitte in seinem Fahrwasser zu halten; er verhandelte immer noch mit der deutschen Volkspartei oder der Wirtschaftspartei, wenn sich der Reichstag bereits versammelt hatte, und die Übereinstimmung ward gewöhnlich in den allerletzten Augenblicken vor der Bestätigung des parlamentarischen Vertrauens erzielt. Aber der Reichstag hatte nur noch die Bedeutung eines Schönheitsfehlers an der neuen Erscheinung der demokratischen Diktatur. [260] Zwei Voraussetzungen waren allerdings nötig, daß Brüning so souverän handeln konnte: die Rechte war noch zu schwach, und die Sozialdemokratie, krank und schwach bis in die Knochen, abgewirtschaftet und keiner eignen Aktion mehr fähig, mußte Brüning tolerieren, um ein befürchtetes Hinschwenken nach rechts zu verhindern. Brüning spielte mit der Sozialdemokratie, sie war kein Gegner für ihn, denn sie war dabei, in ihrem eigenen Materialismus zu verfaulen. Um so mehr wandte sich Brüning gegen den Nationalsozialismus, dem sich die Deutschnationale Volkspartei anschloß. Die Abgeordneten beider Parteien hatten den Reichstag verlassen, nachdem sie dies unwürdige Spiel des Kanzlers mit dem Parlament erkannt hatten. Und seit dem Februar 1931 tobte zwischen Brüning und dem Nationalsozialismus jener Kampf auf Tod und Leben, dem Brüning 15 Monate später erlag. Der Nationalsozialismus brach mit Brüning, weil er das hoffnungslos Todgeweihte der Kanzlerpolitik erkannte. Es war nicht nur das störrische Stemmen dagegen, daß der Nationalsozialismus Einfluß auf die Regierung gewann, es war vor allem auch der Umstand, daß Brüning rückständig war in seinen Anschauungen, alle seine staatspolitischen Maßnahmen aus Angst und Not geboren wurden, wodurch auch etwas Unaufrichtiges in sein Wirken kam. Brüning nahm das Alte, Gegebene, Sterbende als etwas unantastbares hin, woran man nicht rütteln durfte. Das zerrüttete kapitalistische Wirtschaftssystem suchte er zu stützen und auszubessern, weil er glaubte, damit den Bolschewismus abzuwehren. Alles, was Brüning innenpolitisch tat, sowohl auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens wie der rechten und linken Opposition gegenüber, war Abwehr. Brüning trieb Defensivpolitik, weil ihm der Mut zum Neuen fehlte. Dann aber und vor allem war Brüning gefesselt durch den stillschweigenden höheren Auftrag der Katholischen Aktion, jener Staatsmann, der dem uralten Kampf zwischen priesterlicher und weltlicher Staatsherrschaft neuen Antrieb zu geben hatte. Brüning konnte nicht mit der Rechten regieren, jedes Zugeständnis an sie hätte eine Kapitulation priesterlicher Herrschaftsbestrebungen gegenüber dem weltlichen Staat bedeutet. Darum unversöhnlicher Kampf auf Tod und Leben gegen den [261] Nationalsozialismus. Brüning durfte die Rechte nur nachahmen, um die nationalen Katholiken für das Zentrum zu gewinnen! Brüning wollte nationale Politik machen und beanspruchte, daß dies anerkannt wurde, aber dabei wollte er den Todesstoß führen gegen den Nationalsozialismus durch das Verbot von dessen Organisationen. Das unheilvolle Zwitterwesen Brünings ist nur aus der Katholischen Aktion und ihren politischen Zielen zu erklären. Man machte dem Kanzler oft im In- und Auslande den Vorwurf, er habe kein Programm, entwickle nur Pläne. Und dennoch hatte Brüning ein Programm, allerdings kein so geräuschvolles wie das der Eisernen Front, aber ein um so zwingenderes. Es war eben das Programm der Katholischen Aktion, deren erster Kanzler er war, das Programm, das nur in zwei Worten bestand: "Deutschlands Rettung". Befreiung des deutschen Volkes von dem Anwachsen heidnischer Mächte, die für die katholische Kirche sowohl im Marxismus wie im Nationalismus sich regten, die Hinführung des deutschen Volkes unter ein christliches, d. h. kirchliches Regiment. Dies Ziel konnte nur erreicht werden über die Demokratie, und sei es die diktatorische Demokratie, deren Anfänge bis in hierarchische Zeiten zurückgehen. Der Vorsitzende der Katholischen Aktion, der Ministerialdirektor Klausener, saß im Preußischen Innenministerium und wirkte hier als Schatten Brünings, als das Lebensband, das die Reichsregierung mit der Preußenregierung aufs innigste verknüpfte. Allerdings hatte Brüning, bis er an die Verwirklichung des eigentlichen Programmes ging, eine Menge vorbereitender Arbeiten in dem verwüsteten Deutschland zu erledigen. Und die Bewältigung dieser vorbereitenden Aufgaben überstieg seine Kräfte, – "hundert Meter vor dem Ziel". Und so ist Brüning gestrauchelt. Er war nicht in der Lage, die Finanznot zu beseitigen. Er war nicht in der Lage, die Arbeitslosigkeit zu bannen, im Gegenteil, sie wuchs ihm über den Kopf. Er war nicht in der Lage, den Nationalsozialismus auszuschalten. Im Gegenteil, als er das durch das Verbot der Sturmabteilungen und Schutzstaffeln versuchte, besiegelte er damit seinen eigenen Sturz. Die Ausschaltung des Reichstages [262] seit September 1930, der Übergang zur Diktatur hat an seinem Schicksal nichts ändern können. Brüning wurde verschlungen von den mit Erbitterung gegeneinander ringenden Gewalten. Er war nicht mehr fähig, sich zu behaupten, weil ihm, der kirchlich gebunden war, der Mut zum entscheidenden politischen Bekenntnis fehlte. Er mußte weichen, weil ihn die zu höchster Sammlung gelangte, alle Zersplitterung überwindende nationale Kraft erdrückte. Nach ihm mußte eine Direktorialregierung kommen. Brüning war das notwendige Bindeglied, der Übergang von der auf schrankenlosem Parlamentarismus schwimmenden Regierung des Sozialdemokraten Hermann Müller zu der auf nationale Konzentration hinstrebenden Regierung des Kanzlers von Papen. Noch nie hat das Zentrum seit den Tagen des Kulturkampfes einen so schweren Schlag erlitten wie mit dem Rücktritt Brünings! Das Zentrum tobte. Der erste Kanzler der Katholischen Aktion war gefallen, noch ehe er seine eigentliche Aufgabe, alle deutschen Katholiken im Zentrum zu vereinigen, um mit dieser dann mächtigen Partei Deutschland diktatorisch zu beherrschen, begonnen hatte. Was hatte es genützt, daß die Bischöfe den Nationalsozialismus ablehnten und verboten, um das Zentrum zu schützen? Was hatte es genutzt, daß die Priester von den Kanzeln wetterten, wie im Kreis Gelsenkirchen am 14. September 1930: "Wer nicht Zentrum wählt, der ist verflucht!" Was hatte es genützt, daß Brüning den Schwerpunkt seiner Politik immer nach außen verlegte, daß er immer betonte, erst müßten außenpolitische Erfolge errungen werden, dann komme von selbst die innenpolitische Entspannung? Auf diese außenpolitischen Erfolge hoffte Brüning mit Zuversicht, denn mit ihnen würde er alle deutschen Katholiken im Zentrum vereinigen! Nichts von alledem geschah! Denn auch die außenpolitischen Voraussetzungen waren falsch. Brüning buhlte um Frankreichs Freundschaft, aber Frankreich wurde ärger denn je gegen Deutschland! Der Kanzler der Katholischen Aktion brach zusammen, weil er in seinem Kampf gegen den Nationalsozialismus in seiner Schwäche sogar Unaufrichtigkeit und Verschleierung anwenden mußte. Hitler und Brüning – weltliche und hierarchische [263] Staatsgewalt im Kampfe gegeneinander! Brüning unterlag; die vielen Millionen nationalsozialistischer Katholiken konnte er nicht zum Zentrum hinüberziehen. Nicht das Zentrum wurde die 14-Millionen-Partei, wie es die Katholische Aktion verlangte, sondern der Nationalsozialismus. Darin liegt die eigentliche Katastrophe Brünings, darin liegt auch die Katastrophe der Zentrumspartei: Die Katholische Aktion hatte versagt, die weltliche Gewalt triumphierte über den geistlichen Staat. Das Zentrum wußte, warum es aufs tiefste empört war: der 30. Mai 1932 war der schwärzeste Tag seiner Geschichte. Die Entwicklung, die unter Erzberger am 19. Juli 1917 so hoffnungsvoll begann, endete mit der Katastrophe Brünings am 30. Mai 1932! So wurde Brüning zum Totengräber der Novemberdemokratie. Die Ironie der Weltgeschichte aber wollte es, daß sein Sturz gerade bei den Bannerträgern des Liberalismus, den Demokraten, tiefe Trauer erweckte. Sie gerade priesen Brüning als den größten deutschen Staatsmann seit Bismarck und erkannten nicht, daß er nur der Liquidator der Erzbergerpolitik war.
Hundert Meter vor seinem vermeintlichen Ziel scheiterte Brüning, ward seine Scheingröße als innere Sterilität enthüllt, denn er scheiterte, weil ihm der Mut fehlte, sich zu lösen von dem alten, sterbenden Geiste einer versinkenden
Epoche. – |