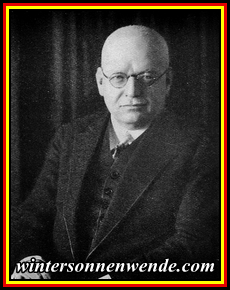|
[Bd. 4 S. 84] 3. Kapitel: Wiederherstellung der Reichseinheit im Westen, Innere Krisen, Neue Wahlen, Das deutsche Parteileben.
Unverzüglich trat am 2. September die durch das Londoner Protokoll berufene Konferenz in Koblenz zusammen, die aus Bevollmächtigten der deutschen Regierung und der Interalliierten Rheinlandkommission bestand, und begann, alle wirtschaftlichen und politischen Fragen der Räumung zu verhandeln. Am gleichen Tage traf der Sechserausschuß mit der Micum ein Abkommen, wonach sich der Ruhrbergbau zur Fortsetzung der Lieferung von Kohle und Nebenprodukten verpflichtete, allerdings im Rahmen des vom Wiederherstellungsausschuß festgesetzten Programms. Dieses Abkommen war notwendig, denn es leitete die Micum-Vertrage, die bisher einen speziell belgisch-französischen Charakter trugen, hinüber in die allgemeinen Reparationsverpflichtungen Deutschlands, soweit sie auf Grund der Neuregelung Sachlieferungen betrafen. Das Abkommen hatte nur eine kurze Lebensdauer von vier Wochen, denn am 1. Oktober stellte die Micum ihre Tätigkeit ein. Trotzdem wurden die Kohlenlieferungen noch vier Wochen lang fortgesetzt. Am 28. Oktober 1924 nachts 12 Uhr wurden die Micum-Lieferungen auf der ganzen Linie eingestellt. Am 4. September war bereits der Oberpräsident der Rheinprovinz, Dr. Fuchs, nach Koblenz zurückgekehrt. [85] Die Interalliierte Rheinlandkommission hatte eine gewaltige Arbeit zu leisten, um dem deutschen Rhein- und Ruhrgebiet all seine wirtschaftlichen und politischen Rechte wiederzugeben, die ihm seit dem 11. Januar 1923 geraubt worden waren. Zunächst wurde die Erhebung des Zolles an der Ostgrenze des besetzten Gebietes beseitigt, die unnatürliche widerrechtliche und willkürliche Zollgrenze zwischen dem besetzten und unbesetzten Deutschland, jene schwere, auf das deutsche Wirtschaftsleben fast tödlich wirkende feindselige Maßnahme verschwand. Auch dem bisher behinderten Personenverkehr zwischen den okkupierten und den übrigen Teilen des Reiches wurde seine Freiheit wiedergegeben. Automobile durften wieder verkehren. Dann kam eine Amnestie-Verordnung (16. September), welche etwa den Wortlaut des Artikels 7 im Londoner Abkommen hatte. Allen Personen, welche politische Straftaten verübt hatten, wurde Straffreiheit gewährt. Dies galt für diejenigen, welche gegen die Anordnungen der Reichsregierung französische und belgische Dienste genommen hatten – und deren gab es genug – oder gar als Separatisten gegen die Einheit des Reiches aufgetreten waren, aber auch für die, welche den französischen Behörden und Militärstellen Widerstand entgegengesetzt hatten und dafür bestraft oder ausgewiesen waren. Am 20. Oktober hob die Kommission 35 Sonderverordnungen auf. Die beschlagnahmten Einkünfte aus Zoll und Forsten wurden freigegeben, die Kohlensteuer fiel, das Recht der Besatzungsmächte, Gelder, Material, Waren, Bergwerke, Güter aller Art mit Beschlag zu belegen, wurde zurückgezogen, die Zollgrenze im Osten wurde offiziell aufgehoben durch Beseitigung der entsprechenden Sonderverordnung. In der Nacht vom 15. zum 16. November 12 Uhr hatte die französisch-belgische Eisenbahnregie ihr Ende erreicht und die Eisenbahnen des besetzten Gebietes wurden der Deutschen Reichsbahngesellschaft übergeben. Am 4. Dezember gab die Rheinlandkommission einen Erlaß heraus, welche den Einwohnern Erleichterung bringen und das Willkürregiment der belgisch-französischen Besatzungstruppen einschränken sollte. Es wurde hierin versprochen, daß deutsche Gesetze und Vorschriften in Zukunft [86] in fast allen Fällen gleichzeitig in den besetzten Gebieten wie auch im übrigen Deutschland in Kraft treten sollten. Auch sollten in Zukunft Personen, gegen welche Ausweisungsbefehle vorliegen, von dem Grund der Maßregel unterrichtet und angehört werden. Das Einspruchsrecht der Kommission aus Gründen der Sicherheit der verbündeten Heere gegen Anstellung deutscher Beamter werde nur dann ausgeübt, wenn die betreffenden Beamten über die Gründe des Einspruchs unterrichtet worden seien und Gelegenheit sich zu verteidigen hätten. Dasselbe Recht werde bei Entlassungen zugestanden. Urteilssprüche auf Gefängnisstrafen würden in Zukunft außerhalb Deutschlands nur dann gefällt und verhängt, wenn eine besondere Botschaft der Interalliierten Kommission vorliege. Schließlich sollten in möglichst entgegenkommender Weise berücksichtigt werden Eingaben, worin Genehmigung für das Aushängen von Fahnen, besonders bei Veranstaltungen religiöser und nationaler Vereine, bei sportlichen und anderen Festlichkeiten nachgesucht wurde. Am 18. Januar 1925 endlich wurde die Verordnung aufgehoben, wonach auch nichtpolitische Versammlungen anmeldepflichtig waren. Den Verordnungen der Interalliierten Rheinlandkommission in Koblenz entsprachen die Maßnahmen der Franzosen. Bereits Mitte September schlugen sie gegen 1100 schwebende Verfahren nieder und setzten 330 Straf- und Untersuchungsgefangene in Freiheit. Den General Degoutte in Düsseldorf, den Oberkommandierenden des Ruhrgebietes, plagte das böse Gewissen. Er schaffte am 5. September die Gebühren für Waffenscheine ab und setzte seinen Erlaß außer Kraft, wonach es den deutschen Behörden untersagt war, ohne vorherige Genehmigung der Besatzungsbehörden eine Strafverfolgung gegen Personen einzuleiten, welche politischer Verbrechen beschuldigt wurden. Der General konnte nicht mehr, das war das Ergebnis von London, den deutschen Gerichten in den Arm fallen. Einige Tage später beseitigte er, rückwirkend vom 1. September, die Einziehung der Kohlensteuer und den Tarif für die Kohlenunterprodukte. Dann verfügte er auf Grund des Amnestieartikels im Londoner Abkommen die Einstellung aller politischen Ge- [87] richtsverfahren, welche die Besatzungstruppen gegen Deutsche anhängig gemacht hatten. Bereits Verurteilten wurde die Strafe erlassen, jedoch vor dem 30. August 1924 bezahlte Geldstrafen wurden nicht zurückerstattet. Die deutsche Gerichtsbarkeit wurde durch Degoutte voll wiederhergestellt. Auch die besonderen Dienststellen zur Verwaltung der Forsten, Zölle und des Alkoholmonopols wurden aufgelöst, nur die Eisenbahnregie durfte nach Degouttes Anordnungen weiterhin ihre Tarife anwenden.
Auf Grund der Verhandlungen auf der Technischen Konferenz in Düsseldorf wurden vom 1. Oktober ab die Rheinschiffahrt, die Häfen und Umschlagplätze freigegeben. Auch die Micum schloß an diesem Tage ihre Büros in Düsseldorf. Ende des Monats erhielt die Gelsenkirchener Bergwerksaktiengesellschaft ihre von der Regie betriebenen Kohlenzechen zurück. Die Eisenbahnwerkstätte Darmstadt wurde Mitte November der Reichsbahn zurückgegeben. So wurden Schritt für Schritt der Bevölkerung ihre staatlichen, wirtschaftlichen und persönlichen Rechte wiederge- [88] geben, die durch Rechtsbruch und schrankenlose Willkür fast zwei Jahre lang beseitigt waren. Die Ordnung kehrte wieder zurück; wenn natürlich auch die Rheinlandkommission "zum Schutze der Besatzungstruppen" manches Recht weiterhin für sich beanspruchte, das von den Einwohnern drückend empfunden wurde, so trat dennoch ein Zustand ein, der gegenüber den verflossenen sechs Jahren einen Willen zur Annäherung und zum Frieden erkennen ließ. Zwar verstanden es die Franzosen nach wie vor, durch Gewalttaten, Schikanen und Grausamkeiten jene Deutschen zu peinigen, deren sie habhaft wurden. Aber gegen alle einzelnen Auswirkungen dieser vom Haß vergifteten Gemüter konnten die höheren Stellen der alliierten Kommission nicht erfolgreich vorgehen.
Bereits am 18. August 1924 räumten die französischen Soldaten Offenburg und Appenweier. Am 12. September zogen sie sich aus den Landkreisen Bochum und Gelsenkirchen zurück; vier Tage später gaben sie Oberhausen und den Limburger Flaschenhals frei. Am 20. September verließen sie Flammersfeld, Neustadt a. d. Wied, Püderbach und Münderbach. Vier Wochen später wurden Mannheim, Limburg, Eschhofen, der Rheinhafen in Karlsruhe von den Franzosen, Wesel und Emmerich von den Belgiern aufgegeben. Die deutschen Zollbeamten nahmen wieder ihren Dienst auf. Am folgenden Tage (22. Oktober) sahen die Einwohner von Dortmund, Vohwinkel und Remscheid die Franzosen abziehen. Am 6. November wurden Werden und Wülfrath, am 17. [89] Honnef und Königswinter frei. Nach einer Unterbrechung von fast einem Vierteljahr wurde am 27. Januar 1925 die belgische Besatzung von Dorsten auf Gladbeck zurückgenommen. Der in Mannheim und Karlsruhe noch stehende Kontrollposten der Interalliierten Schiffahrtskommission wurde am 9. Mai auf das westliche Rheinufer nach Ludwigshafen und Maximiliansau zurückgezogen. Am 20. Juli schließlich war das gesamte Besetzungsgebiet der Belgier und Franzosen in der Provinz Westfalen frei, und bis zum 31. Juli räumten die Franzosen den Rest des seit dem 11. Januar 1923 besetzten Ruhrgebiets. Am 25. August wurde die letzte Etappe von der Besetzung befreit: die Franzosen verließen Düsseldorf und Duisburg, die Belgier Hamborn.
So endete das furchtbare und blutige Abenteuer Poincarés, das vor der Geschichte den Stempel des Wahnsinns und des Herostratentums trägt. Napoleon hielt sechs Jahre lang Preußen bis an die Memel unter seiner eisernen Faust, Poincaré, der es ihm gleichtun wollte, war nicht imstande, auch nur drei Jahre das Ruhrgebiet zu halten. Er gab vor, Reparationspfänder zu beschlagnahmen, in Wahrheit wollte er der Diktator von Deutschlands Zerstörung werden! Napoleon ging heroisch zugrunde, Poincaré scheiterte kläglich. Der Gesamtwert der französischen Beute während der Ruhrbesetzung betrug vom 11. Januar 1923 bis zum 31. August 1924: 972 Millionen Mark, von denen 184 Millionen durch die Besetzungsaktion selbst verschlungen worden waren. Beschlagnahmungen, Geldstrafen und Requirierungen erbrachten 45,5 Millionen, Naturalleistungen 436, bare Einnahmen 490 Millionen (Kohlensteuer 129, Zölle 163, Lizenzbewilligungen 101, Forsten 27, Eisenbahnen 67 und Paßgelder 3 Millionen). Ein Jubel der Begeisterung ging durch das Volk an der Ruhr, als der letzte Franzose das Gebiet verlassen hatte. Die Luft der Freiheit wehte wieder, und die Drangsal hatte ein Ende. Es war ein Kampf geführt worden, 30 Monate hindurch, ein stiller Kampf, aber ein um so schwererer gegen Feinde und Verräter, da er mit ungleichen Waffen ausgefochten wurde. Die beste Kriegsausrüstung stand den Eindring- [90] lingen zur Verfügung, aber sie war wesenlos und unzureichend, denn die bedrängten Deutschen panzerten sich mit einem harten Gemüt. Jetzt war der Kampf vorüber, und das deutsche Volk hatte gesiegt. Am 18. September 1925 fand in Essen eine große vaterländische Kundgebung statt, zu der Tausende und aber Tausende strömten. Der preußische Innenminister Severing hielt eine Rede, dann trat der greise Reichspräsident Hindenburg ans Rednerpult. Seine schlichten, warmen, vaterländischen Worte über die Not und Befreiung der Ruhr riefen einen Rausch der Begeisterung hervor. Noch am gleichen Abend besuchte der Reichspräsident Duisburg und Düsseldorf. In der harten Zeit monatelanger Leiden war der Glaube an Deutschland besonders stark und fest geworden.
"Die Botschafterkonferenz stellt mit Einstimmigkeit der verbündeten Regierungen fest, daß die Kölner [91] Zone am 10. Januar nicht geräumt wird, und hat das Vorgehen festgesetzt, wodurch dieser Beschluß zu Deutschlands Kenntnis gebracht werden soll." Wie immer in solchen Fällen, war es ganz zwecklos, daß die deutsche Regierung protestierte und zu beweisen versuchte, sie habe sämtliche Abrüstungsverpflichtungen erfüllt. Durch das Rheinland aber wogte eine Welle des Unmutes und Zornes: das also seien die Verträge, das sei Treu und Glauben, die skrupellos von den Gegnern verletzt werden dürften; wenn aber Deutschland einmal bei bestem Willen nicht imstande sei, seinen Verpflichtungen nachzukommen, dann griffe man sofort zu Sanktionen. Ohne Unterschied der Partei und des Standes wurde das Vorgehen der Alliierten scharf und laut verurteilt. Große Körperschaften, Gewerkschaften, Handelskammern, Landwirtschaftskammer und die Stadtverordneten von Köln erhoben Einspruch. Die für den 10. Januar geplanten großen Protestkundgebungen und Einspruchserklärungen der öffentlich-rechtlichen Körperschaften des gesamten besetzten Gebietes mußten unterbleiben, weil sie von der Rheinlandkommission verboten wurden. Der Kölner Oberbürgermeister Adenauer beklagte sich, daß das deutsche Volk im unbesetzten Deutschland viel zu sehr seine eigenen Interessen und den Parteihader im Auge habe, statt dem besetzten Gebiete die Aufmerksamkeit zu schenken, die ihm gebühre. – Unberührt von diesem Unwillen, blieben die Engländer noch ein ganzes Jahr in Köln. Noch eine andere Angelegenheit erregte die Gemüter. Im Dezember 1924 war ein Gerücht laut geworden, wonach Herriot geäußert haben sollte, er verzichte auf das Saargebiet, wenn ihm die Stadt Saarlouis und sieben Gemeinden abgetreten wurden. Große Erregung bemächtigte sich der Saarbevölkerung. Sie war empört über das Schachergeschäft, das man angeblich mit ihr vorhatte. Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember, schrieben die Stadtverordneten von Saarlouis drei Briefe, einen an den Deutschen Reichskanzler Marx, einen zweiten an den Völkerbund und einen dritten an Herriot. Beim Reichskanzler erhob die treudeutsche Bevölkerung schärfsten Einspruch gegen den beabsichtigten Tauschhandel.
[92] "Was wir in schwerer Stunde trotz des Druckes der Militärdiktatur unserm Vaterlande freimütig gelobt haben – Treue bis zum Tode –, ist heute so wahr wie damals. Wir waren gute Deutsche, wir sind gute Deutsche und wir wollen gute Deutsche bleiben." Beim Völkerbunde ersuchte man darum, er möchte dafür sorgen, daß das Selbstbestimmungsrecht geachtet würde. Saarlouis könne nur dann an Frankreich abgetreten werden, wenn eine ordnungsmäßig durchgeführte Volksabstimmung sich dafür entscheide. Dem französischen Ministerpräsidenten schließlich wurde erklärt, daß die Einwohner der deutschen Grenzstadt Saarlouis nicht daran dächten, französisch zu werden. Dies würde für sie das größte seelische und wirtschaftliche Unglück sein.
"Als gute Deutsche bekämpfen wir jedes Bestreben, uns von Deutschland loszureißen, weil wir unlösbar verknüpft sind mit unserer deutschen Heimat, und weil eine Lostrennung wie ein Dolchstich, wie eine Erdrosselung auf das Wirtschaftsleben wirken müßte. Jeden Versuch der Trennung müßten wir als eine in unser deutsches Haus geworfene Brandfackel betrachten, die Mann, Weib und Kind mit ihrem Herzblut ersticken würden." Herriots Antwort traf umgehend ein. In einem Brief an den Präsidenten des Saargebiets, Rault, ersuchte er diesen, unverzüglich und ganz kategorisch zu erklären, daß Frankreich keineswegs das Angebot gemacht habe, auf seine Anrechte an das Saargebiet zu verzichten, wenn ihm die Stadt Saarlouis und sieben andere Gemeinden abgetreten würden. Rault möchte der Stadtverordnetenversammlung von Saarlouis sein Erstaunen darüber ausdrücken, daß Männer, die sich Friedensfreunde und Anhänger einer Aussöhnungspolitik nennen, so leichtfertig eine Nachricht hätten aufnehmen können, die ebenso falsch wie trügerisch sei. Das geschah denn auch, und die Gemüter in Saarlouis waren wieder beruhigt, wenigstens äußerlich, während sie im stillen argwöhnisch und wachsam waren, daß sich nicht die Franzosen zu Herren ihrer Seelen machten. –
Weniger leidenschaftlich, wenn auch unangenehm enttäuscht, nahmen die Gegner der Deutschnationalen, vor allem die zweite stärkste Partei, die Sozialdemokraten, das Abstimmungsergebnis auf. Mit höhnischen Schmähworten geißelten diese einerseits die Inkonsequenz, den Wankelmut der nationalen Opposition, andererseits konnten sie ihre Sorge nicht verhehlen, daß die Deutschnationalen nun, nachdem sie die Regierung bei der Durchführung ihres Programmes unterstützt hatten, jetzt auch ihren Anteil an der Regierung des Reiches verlangten. Und in der Tat, jetzt nahte das Ereignis, welches man so lange in Deutschland erhofft, gefürchtet und erwartet hatte: Der Kampf um die Macht in der Regierung zwischen den beiden stärksten Parteien begann, der Kampf zwischen Deutschnationalen und Sozialdemokraten, welcher zugleich ein Kampf geistiger, sittlicher und weltanschaulicher Prinzipien werden mußte. Auch die Völker unterliegen ewigen Naturgesetzen. Im rhythmischen Kreisen der Ereignisse ballen sich Energien zusammen, welche sich gegenseitig wie die Pole eines Magneten anziehen und abstoßen. Kein Land Europas hat vielleicht in dem Maße wie Deutschland nach 1918 unter dem unmittelbaren Einfluß polar entgegengesetzter Weltanschauungen gestanden. Geschichtsphilosophisch betrachtet, hat das latente Gleichgewicht zwischen rechts und links verhindert, daß Deutschland in den Jahren 1918 bis 1923 aus der Bahn seiner Entwicklung geworfen wurde. Dies Gleichgewicht ließ sich zwar anfänglich nicht rein mathematisch mit Zahlen messen, denn der größeren Masse links stand die stärkere Wucht des Geistes auf der rechten Seite gegenüber, die noch durch eine Kette ungünstiger Ereignisse vom Waffenstillstand 1918 bis zur Inflation und zum Separatistenaufstand [96] 1923 erhöht wurde. Jetzt aber, im Mai 1924, war mit Naturnotwendigkeit auch rein mathematisch das Gleichgewicht zwischen den beiden feindseligen Tendenzen erreicht worden: die Deutschnationale Volkspartei hatte fast 6 Millionen Anhänger hinter sich, während die Sozialdemokraten genau 6 Millionen zu verzeichnen hatten. Wie anders war es doch 1919 gewesen! Damals stand den kaum 3 Millionen Deutschnationalen eine fast vierfache sozialdemokratische Front gegenüber. Mit dem 4. Mai 1924 beginnt die Vorgeschichte jener Ereignisse, welche nach dem 30. August zur Gestaltung drängten. Die Deutschnationalen verwiesen mit Recht auf die große Gefolgschaft im Lande, die hinter ihnen stand. Durch Zusammenschluß mit dem Landbund war die Zahl der deutsch-nationalen Abgeordneten im neuen Reichstag auf 106 gestiegen, so wurde diese Fraktion die stärkste. Der sozialdemokratische Reichspräsident Ebert aber beauftragte nicht, wie es üblich war, die stärkste Reichstagsfraktion, also die Deutschnationalen, mit der Regierungsbildung, da er aus persönlichen Gründen und aus parteipolitischen Erwägungen nicht glaubte, mit einem Kabinett zusammenarbeiten zu können, das aus der nationalen Opposition hervorgegangen war. Allerdings war Ebert vorsichtig genug, auch keinen Sozialdemokraten mit der schwierigen Aufgabe zu betrauen. Ein solcher Schritt wäre ihm in seiner Stellung als Reichspräsident nicht nur von den Deutschnationalen, sondern auch von allen anderen Parteien sehr übelgenommen worden. Er fand einen Ausweg, indem er die neue Regierung durch den bisherigen Reichskanzler Marx bilden ließ. Marx verhandelte zwar zum Scheine mit den Deutschnationalen über den Eintritt in die Regierung, brach aber bald die Besprechungen als ergebnislos ab. Die Deutschnationalen fühlten sich durch dieses Vorgehen stark brüskiert und hatten keineswegs die Absicht, sich den auf Grund ihrer Macht zustehenden Anteil an der Regierung entziehen zu lassen. Jedoch erneute Verhandlungen im Juli führten auch zu keinem Ergebnis. Die Londoner Konferenz tagte, und die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Dawes-Planes rückte immer [97] näher. Die Deutschnationalen mußten nach ihrer ganzen Auffassung den Dawes-Plan grundsätzlich ablehnen. Die Schuldlüge, die Ungewißheit der Ruhrräumung, die staatliche Versklavung Deutschlands, das Fehlen der Festsetzung einer endgültigen Reparationssumme, die untragbaren wirtschaftlichen Lasten – all dies waren Gründe, die nach ehrlicher Überzeugung die Annahme des Planes unmöglich machten. Andererseits sagten sich die Deutschnationalen, daß das Londoner Abkommen mit oder ohne Zustimmung des Reichstags unterzeichnet werden würde, wozu der Reichspräsident nach Artikel 45 der Reichsverfassung das Recht habe. Brachten die Deutschnationalen durch eine geschlossene Ablehnung die Dawes-Gesetze zu Fall, dann wurde der Reichstag aufgelöst. Eine leichtfertige Reichstagsauflösung hätte aber für eine große Partei ein unzweifelhaftes Risiko bedeutet, zumal in jenen Tagen. Hatte doch der Reichspräsident für den Fall der Ablehnung die Auflösung in Aussicht gestellt, womit die Sozialdemokraten unter den obwaltenden Umständen große Hoffnungen verknüpften. Auch die immer noch drohende separatistische Gefahr im Rheinlande, die neu aufgeflammt wäre, wenn mit der demagogischen Behauptung hätte gearbeitet werden können, daß die deutschnationale Opposition die Befreiung des Ruhrgebietes verhindert hätte, und die 1925 fällige Reichspräsidentenwahl ließen den Deutschnationalen eine Reichstagsauflösung ungelegen kommen und die Mitwirkung in der Reichsregierung sehr notwendig erscheinen. So also entschloß sich die große Rechtspartei, sich außenpolitisch in das Unabänderliche zu fügen, gleichzeitig innenpolitisch ihr Recht an der Macht unbedingt geltend zu machen. "Die deutschnationalen Ja-Stimmen geben der Partei ein Anrecht darauf, bei der Durchführung des Londoner Abkommens und den daran anschließenden weiteren Verhandlungen einen entscheidenden Einfluß auszuüben. Erst wenn die in der Sache ablehnenden Deutschnationalen bei der Ausführung der Londoner Beschlüsse in Zukunft mitwirken, erfährt die deutsche Regierung eine Stärke den feindlichen Mächten gegenüber." Daß man auf der Londoner Konferenz so wenig erreicht habe, sei lediglich auf den Widerstand der [98] Mittel- und Linksparteien zurückzuführen, die im Mai und Juli den Eintritt der Deutschnationalen in die Regierung sabotiert hätten. Die Deutschnationalen trieben, nach ihren eigenen Worten, "Politik auf weite Sicht". Sie verhandelten mit den beiden Regierungsparteien, der Deutschen Volkspartei und dem Zentrum, welche beide den Eintritt der Deutschnationalen in die Regierung wünschten. Die Volkspartei schrieb:
"Wir haben seit den Reichstagswahlen danach gestrebt, die wertvollen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Kräfte der Deutschnationalen Volkspartei zur verantwortlichen Mitarbeit an den Reichsgeschäften heranzuziehen. Wir erklären heute (28. August), daß wir diese Mitarbeit bei der Durchführung des Londoner Paktes und des innerpolitischen Wiederaufbaues für notwendig halten. Übernimmt die Deutschnationale Volkspartei die Verantwortung am Zustandekommen des Londoner Paktes mit, so wird die Reichstagsfraktion der Deutschen Volkspartei mit allen Mitteln auf einer ihrer Bedeutung entsprechenden Teilnahme der Deutschnationalen an der Reichsregierung bestehen." Der Zentrumsführer Guérard schrieb am 28. August:
"Die Vertreter des Zentrums beschränkten sich bei einer Besprechung zwischen Vertretern der Deutschnationalen und der Zentrumsreichstagsfraktion auf folgende zwei Feststellungen bezüglich des Standpunktes ihrer Fraktion: [99] Mit solchen Rückversicherungen wohl versehen, begaben sich die deutschnationalen Reichstagsabgeordneten zur Abstimmung über die Dawes-Gesetze. Sie verlief in der bereits geschilderten Form. Den Deutschnationalen war es gelungen, gewissermaßen als eine seelische Entlastung für sich selbst, die Reichsregierung zu bewegen, gleichzeitig mit den Dawes-Gesetzen einen amtlichen Widerruf der Kriegsschuldlüge zu veröffentlichen. Die ganze Angelegenheit hatte sich in der vorher genau festgelegten Weise abgewickelt. Marx hatte bereits vorher die Regierungsumbildung für den Oktober angekündigt, und da in allen Verhandlungen lediglich eine Regierungserweiterung nach rechts besprochen worden war, rechneten die Deutschnationalen damit, im Kabinett vier Sitze und Stimmen zu erhalten. Auf dieser Grundlage beschlossen die Deutschnationale Reichstagsfraktion und Vertretertagung am 29. und 30. September, in die Verhandlungen mit der Regierung einzutreten.
Nichtsdestoweniger waren die Deutschnationalen bereit, auch auf der neuen Grundlage weiterzuverhandeln. Nun freilich, wo man erkannte, daß der Reichskanzler beabsichtigte, zwei wie Feuer und Wasser entgegengesetzte Prinzipien in der Regierung zu vereinigen, stellten die Deutschnationalen gewisse Bedingungen. Sie verlangten, daß alle Parteien sich zu folgenden Zielen bekennen sollten: christliche Jugend- [101] erziehung und christliche Kultur als Grundlage des Staatslebens, unter Ablehnung des die Volksgemeinschaft verneinenden Klassenkampfes und unter Sicherung der Koalitionsfreiheit, die Bekämpfung jedes den Arbeitsfrieden bedrohenden Terrors und die Förderung der Arbeitsgemeinschaft bei voller Wahrung der sozialen und politischen Gleichberechtigung der Arbeitnehmer, und schließlich Anerkennung und weitere amtliche Verfolgung der Verhandlungen über die Kriegsschuld an der Hand der Regierungserklärung vom 29. August über die Nichtschuld Deutschlands am Kriege. Der Reichskanzler hatte seinerseits am 7. Oktober Richtlinien für die Politik der neuen Regierung bekanntgegeben. Hierin hieß es:
"Die Richtung der Außenpolitik wird in erster Linie durch die Londoner Abmachungen bestimmt. Die auf Grund derselben erlassenen Reichstagsgesetze sind loyal auszuführen, ebenso wie wir die loyale Durchführung des Abkommens von unseren Vertragsgegnern erwarten. Die Regierung wird es sich angelegen sein lassen, die Auswirkung der übernommenen Verpflichtungen aufs sorgfältigste zu überwachen und die sich als notwendig erweisenden Abänderungen zu erreichen. Die Aufnahme in den Völkerbund (siehe später) soll entsprechend der im deutschen Memorandum niedergelegten Auffassung erstrebt werden." Die Deutschnationalen nahmen diese Richtlinien nicht ohne jeden Vorbehalt an, denn sie bedeuteten in der Auslegung des Reichskanzlers nur die unveränderte Fortsetzung der bisherigen auswärtigen Politik, an der ja die Deutschnationalen gerade äußerst scharfe Kritik geübt hatten. Aber sie erkannten sie als geeignete Grundlage zu weiteren Verhandlungen an. In einer Besprechung am 10. Oktober mit dem Reichskanzler machten die deutschnationalen Vertreter geltend, daß jetzt nicht mehr die Aufstellung der Richtlinien, sondern eine Einigung über den Inhalt der Regierungserklärung erforderlich sei. Sie sprachen den Wunsch aus, daß ein Teil ihrer Bedingungen vom 8. Oktober berücksichtigt werden sollte. Ferner erklärten sie, die übrigen Punkte der Richtlinien seien zwar in ihrer Fassung für sie keineswegs befriedigend, man werde aber darüber hinwegkommen können und [102] keinen Anstoß daran nehmen. Am Schlusse dieser Besprechung, an der außer dem Reichskanzler auch der Außenminister Stresemann teilnahm, wurde dann im Kompromißwege folgendes Ergebnis festgestellt, das durch die amtliche Wolff-Korrespondenz veröffentlicht wurde: "Die deutschnationalen Vertreter teilten ihre Auffassung zu den einzelnen Punkten der ihnen am Dienstag vorgelegten Richtlinien mit und erkannten sie als geeignete Grundlage für die weiteren Verhandlungen über die Regierungsbildung an." Die Deutschnationalen waren durch ihre Energie tatsächlich einen bedeutenden Schritt vorwärtsgekommen, und die Minister erkannten an, daß das Verhandlungsergebnis ausreiche, um mit Aussicht auf Erfolg über die Regierungserweiterung nach rechts verhandeln zu können. Es hatte den Anschein, als sollten die Bemühungen des Grafen Westarp, jenes impulsiven, entschlossenen und tatkräftigen Mannes, der von deutschnationaler Seite die Verhandlungen führte, von Erfolg gekrönt sein. Schritt für Schritt drang dieser Mann vorwärts, kämpfend für das Recht und die Macht seiner Partei.
"Nachdem die Beibehaltung der gegenwärtigen Regierung, die das Zentrum einmütig gewünscht hatte, abgelehnt worden ist, erklärt die Zentrumsfraktion ihre Bereitschaft, einer Regierungserweiterung nach rechts auf dem Boden der vom Reichskanzler aufgestellten Richtlinien zuzustimmen, falls die Demokraten auch in der Regierung bleiben." Die Demokraten lehnten dies aber am 15. Oktober ab. Tags darauf stellte demnach die Zentrumsfraktion fest, daß der Versuch, die Regierung in tragfähiger Form nach rechts zu erweitern, gescheitert sei. Der Reichskanzler wurde ersucht, "kein Mittel unversucht zu [103] lassen und im äußersten Notfall an das politische Urteil des Volkes zu appellieren, um eine tragfähige Regierung zu schaffen"; man spielte also wieder, wie zwei Monate vorher, mit dem Lieblingsgedanken der Reichstagsauflösung. Nun teilte Marx den Führern der Regierungsparteien mit, daß auf Grund des Beschlusses der Zentrumsfraktion weitere Verhandlungen in der Frage der Regierungserweiterung aussichtslos seien, und er diese daher abgebrochen habe. Dennoch nahm er sie am 17. Oktober inoffiziell im Namen und Auftrag des Kabinetts ohne unmittelbare Hinzuziehung der Fraktionen mit scheinbarer Bereitwilligkeit wieder auf, unter der Bedingung, daß die Demokraten in der Regierung verbleiben sollten. Er eröffnete dem Grafen Westarp, daß die Erweiterung der Regierung nach rechts unter allen Umständen von der Vorfrage abhängig gemacht werden müsse, ob die Demokratische Fraktion das Verbleiben des Reichswehrministers Geßler im Kabinett billigen und wohlwollende Neutralität beobachten werde. Es war der letzte, aber entscheidende Trumpf, den Marx gegen die Deutschnationalen ausspielte, indem er gleichzeitig mit ihnen über die Verteilung der Ministersitze verhandelte. Der Kanzler machte den Vorschlag, den Posten des Vizekanzlers und Innenministers nicht zu trennen, dafür aber den Deutschnationalen vier Sitze einschließlich des Ernährungsministeriums zur Verfügung zu stellen, wobei er den Wunsch aussprach, daß Graf Kanitz das Ernährungsministerium behielte. Marx rechnete also den Grafen Kanitz der Deutschnationalen Partei an, trotzdem dieser ihr nicht angehörte. Den Deutschnationalen wurde eingeräumt: Vizekanzler und Innenminister verbunden, Wirtschafts-, Verkehrs- und Ernährungsminister. Die Fraktion beschloß, vier Kandidaten vorzuschlagen, unter denen sich Graf Kanitz nicht befand. Am folgenden Tage antwortete der Reichskanzler, das Kabinett und der Reichspräsident bestünden darauf, daß Graf Kanitz Ernährungsminister bliebe, die Deutschnationalen könnten also nun nur drei Sitze erhalten. Am 20. Oktober beschlossen diese dann, gegen den Grafen Kanitz nicht Einspruch zu erheben, aber auf vier Sitzen zu bestehen, indem, [104] wie ursprünglich vorgeschlagen worden war, Vizekanzler und Innenminister getrennt wurden. Inzwischen waren die Deutschnationalen und Demokraten vom Reichskanzler in ultimativer Form aufgefordert worden, sich bis zum 20. Oktober nachmittags 5 Uhr zu äußern, ob sie zu gemeinsamer Teilnahme an der Reichsregierung gewillt seien. Die Deutschnationalen enthielten sich jeder positiven Antwort. Dagegen lief von der Demokratischen Fraktion eine Antwort ein, die mit 16 gegen 6 Stimmen beschlossen war und folgendermaßen lautete:
"Die Demokratische Fraktion hat wiederholt erklärt, daß nicht der geringste Grund für die Herbeiführung einer Regierungskrisis vorgelegen hat. Wenn der Herr Reichskanzler sich entschlösse, unbekümmert um die schwankende Haltung einzelner Fraktionen mit dem jetzigen Kabinett vor den Reichstag zu treten, so würde dieses Kabinett vor dem Reichstage ein glattes Vertrauensvotum erhalten. Die schwere außenpolitische Gefahr, die mit der Einbeziehung der Deutschnationalen in das Kabinett bei ihrer unsicheren außenpolitischen Haltung verbunden ist, hat die Demokratische Fraktion wiederholt zu dem Beschluß veranlaßt, eine einseitige Verbreiterung des Kabinetts nach rechts nicht mit ihrer Verantwortung zu decken. Die geplante Zusammensetzung des neuen Kabinetts, in das auch Deutschnationale berufen werden sollen, die sich dem Dawes-Gutachten gegenüber ablehnend verhalten haben, kann die Demokratische Fraktion in ihrer Haltung nur bestärken. Daß die Fraktion, die dafür eintritt, das jetzige Kabinett in seiner Gesamtheit zu erhalten, ihre Zustimmung dazu gäbe, ein Mitglied ihrer Fraktion in einem ohne sie neugebildeten Kabinett zu belassen, und daß sie durch einen derartigen halben Beschluß unklare Verantwortlichkeiten schaffe, ist ein Verlangen, dem die Fraktion nicht entsprechen kann."
Nichtsdestoweniger war das Verhalten des Reichskanzlers im höchsten Grade unaufrichtig, ja perfide, da es jeder zwingenden politischen Berechtigung entbehrte. Das mußte die Deutschnationalen aufs tiefste empören. Ihrer hatte sich Marx bedient, um möglichst ohne Schwierigkeiten die Annahme des Dawes-Planes zu erreichen, und nun bediente er sich zweifelhafter Mittel, um sich ihrer zu entledigen, da sie ihm lästig waren. Die Folge dieses Verhaltens war, daß auch die Deutsche Volkspartei von Marx abrückte und sich den Deutschnationalen zuwandte. Die Reichstagsauflösung mußte kommen. Sie war nur verzögert worden. Nichts aber wünschten die Links- und Mittelparteien sehnlicher, als durch eine Neuwahl die gefährlich angewachsene Deutschnationale Volkspartei zu zerschmettern. Ihre Hoffnungen in dieser Hinsicht hielten sie für sehr begründet, da sie dem infolge der geteilten Abstimmungen über die Dawes-Gesetze innerhalb der Partei ausgebrochenen Zwist größere Bedeutung beilegten, als ihm in Wahrheit zukam. –
"Nach der glücklichen Ozeanfahrt begrüße ich mit dem ganzen deutschen Volke und der Regierung Sie und die tapfere Besatzung des Luftschiffes auf das herzlichste. Die Tat wird als Großtat in der Geschichte fortleben. Möge Z. R. 3 auch auf seinen weiteren Fahrten ein Künder deutschen Könnens sein, und möge er seinem Berufe, freiem, friedlichem Wett- [107] bewerb aller Völker zu dienen, mit bestem Erfolge dienen." Zum ersten Male in der Geschichte der Technik war es gelungen, den Ozean auf dem Luftwege zu überqueren. Allerdings wurde die Freude durch das bittere Bewußtsein getrübt, daß das Luftschiff nicht wieder zurückkehrte, sondern abgeliefert werden mußte als ein Tribut, den Deutschland aus dem verlorenen Kriege zu erstatten hatte. –
Zuerst erschienen die Demokraten auf dem Plane. In ihrer Botschaft vom 21. Oktober richteten sie sich vornehmlich gegen die Deutschnationalen. Sie seien bei der Behandlung der Dawes-Gesetze unwahrhaftig und zweideutig gewesen. Aus innen- und außenpolitischen Gründen dürften sie augenblicklich nicht an die Regierung kommen. Geschehe dies dennoch, so sei es eine schwere Gefahr für Deutschlands Befreiung. Auch die Volkspartei habe die Politik der Mitte verlassen, indem sie für die Deutschnationalen eingetreten sei. Das Zentrum habe durch die nachgiebige Haltung seines demokratischen Flügels die jetzige Krisis verschuldet. Von der Sozialdemokratie trenne sich die Demokratische Partei durch einen starken inneren Gegensatz. Es müsse mit allen Mitteln erreicht werden, daß die beiden extremen Parteien der Deutschvölkischen und Kommunisten nicht wieder in der gleichen Stärke wie am 4. Mai im Reichstag einzögen. Ihr Verhalten mache die Volksvertretung arbeitsunfähig. Aber die Deutsche Demokratische Partei kämpfe für die nationale Politik der Mitte, für die Erhaltung der Republik, für die Ausschaltung des Rassenhasses. – Gerade in diesen Tagen machte die Demokratische Partei ihre Krisis durch, die im Zusammenhange mit der gescheiterten Regierungsbildung [108] stand. Der Deutsche Bauernbund, mit dem sie bisher zusammengearbeitet hatte, zog sich von ihr zurück, vor allem aber schieden verschiedene angesehene Persönlichkeiten, so C. F. von Siemens und der ehemalige Minister Schiffer aus und gründeten eine neue "politische Gruppe", die sie "Liberale Vereinigung" nannten. Diese erblickten nämlich in der Haltung der Demokratischen Partei während der Verhandlungen über den Regierungseintritt der Deutschnationalen ein Hinüberschwenken nach links, wodurch die Partei ihren Charakter als Mittelpartei verloren habe.
Am folgenden Tage erschien eine lange Kundgebung der Sozialdemokratie, die in maßloser Heftigkeit gegen die bürgerlichen Parteien wetterte. Gereizt durch das monatelange energische Drängen der Deutschnationalen zur Regierungsteilnahme peitschte die Sozialdemokratie unverhohlen Klassenhaß und Proletarierinstinkte auf. Sie schmähte den "Besitzbürgerblock", der gegen Republik, Verfassung und Demokratie gerichtet sei. Die ganze seit 1921 betriebene demokratische und sozialistische Umstellung der deutschen Verwaltungsmaschine erscheine gefährdet, wenn die Deutschnationalen in die Regierung einzögen. Die Sozialdemokratie hatte Jahre hindurch in ihrer Politik Niederlage auf Niederlage erlitten, so daß sie ihre letzte Errungenschaft, die Demokratisierung des Reiches, nicht auch noch opfern wollte. Deshalb fanatisierte sie die Gemüter. Die Folgen der Rechtsherrschaft seien Verteuerung der Lebensmittel, Lohndruck, vermehrte Arbeitslosigkeit, verlängerte Arbeitszeit. Die Sozialdemokratie dagegen trete ein für Mieterschutz, für Ausbau und Durchführung der sozialen Gesetze, für bessere Lebensbedingungen der Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen. "Der Feind steht rechts! Nieder mit dem Bürgerblock! Es lebe die Sozialdemokratie!" Tags darauf ließen sich die Kommunisten vernehmen. Sie gaben einen Wahlaufruf heraus, der allein schon den Umfang einer kleinen Rede hatte. Die Sozialdemokratie kämpfe um [109] Ministersessel. Alle bürgerlichen Parteien von den Deutschnationalen und der Volkspartei bis zu den Völkischen und Sozialdemokraten hätten sich verbündet gegen die Arbeiterklasse und gegen die einzige Partei der arbeitenden Massen, gegen die Kommunistische Partei. Wenn die Bürgerlichen und Sozialdemokraten von "gerechter Lastenverteilung" sprächen, dann meinten sie Abwälzung aller Lasten auf die Besitzlosen. Unerbittlicher Kampf gegen das Dawes-Gutachten müsse die Losung sein, nur ein Bündnis mit Sowjetrußland könne das deutsche Proletariat retten. Am 28. Oktober traten die Deutschnationalen an die Öffentlichkeit. Die Partei hatte in der Tat eine Krisis zu überwinden, die durch die gespaltene Abstimmung am 29. August hervorgerufen war. Die Kluft zwischen den Jasagern und den Neinsagern war noch nicht überbrückt. Die Neinsager, zu denen auch der Parteivorsitzende Hergt gehörte, beharrten noch auf ihrem Standpunkte starrer, unbedingter Opposition, während die Jasager für positive Mitarbeit in der Regierung eintraten und bis zu einem gewissen Grade auch Zugeständnisse an die Regierungsparteien einzuräumen bereit waren. Hergt hatte bereits am 21. Oktober einen Aufruf erlassen, der zum Schluß in folgenden Worten gipfelte:
"Unsere Ziele bleiben, wie sie waren: monarchistisch, christlich und sozial. Unsere Ziele bleiben wie unsere Namen: deutsch und national. Unsere ruhmreichen Farben bleiben Schwarz-Weiß-Rot und unser Wille so wie je: Deutschland zu schaffen frei von Judenherrschaft und Franzosenherrschaft, frei von politischer Klüngelei und demokratischer Kapitalistenherrschaft: ein Deutschland, in dem wir und unsere Kinder wieder aufrecht und stolz unsere Pflicht tun wollen." Dies Manifest atmete ganz den leidenschaftlichen Geist der vergangenen sechs Jahre, man bezweifelte aber stark, ob es geeignet sei, der Partei zu ihrem Ziele zu verhelfen, nämlich an die Macht zu gelangen. Es hätte vielmehr der Sozialdemokratie Vorspanndienste geleistet und die Entwicklung der Partei um Jahre zurückgeworfen. Das aber durfte nicht mehr geschehen, nachdem sich die Partei an den Dawes-Plan gebunden hatte. [110] Nach zwei Tagen hatten die Realpolitiker in der Partei die Oberhand gewonnen. Hergt legte am 23. Oktober sein Amt als Vorsitzender der Partei nieder. Ihm folgte in Stellvertretung der frühere Landrat Winckler, eine schlichte, gläubige, in sich gefestigte Persönlichkeit. Am 28. Oktober erließ die Partei einen zweiten Aufruf – der erste war sofort nach Erscheinen wieder zurückgezogen und kaum ins Volk gelangt –, der weniger schroff und wesentlich milder wirkte. Die Volksgemeinschaft sei das Ziel jeder Politik. Die Dawes-Gesetze seien bindendes Recht, aber der Mittelstand und die geistige Arbeit müßten vor der unchristlichen, internationalen, zerstörenden Sozialdemokratie geschützt werden. Vor allem dürfe im nationalen Lager keine Zersplitterung herrschen.
"Rechts: Christentum, Vaterland, gesunde Wirtschaft, links Unglaube, revolutionäre Wirrnis und wirtschaftlicher Ruin. Links Schwarz-Rot-Gold, rechts Schwarz-Weiß-Rot. Wählt deutschnational, das ist Schwarz-Weiß-Rot." Das klare Herausarbeiten der beiden Pole in Weltanschauung und Politik war bei der im Herbst 1924 bestehenden Lage das diplomatisch Richtige und Wirksame, es zeugte von einer erheblichen Erweiterung des Horizonts. Ein Hinauswachsen über den engen Parteistandpunkt ließ sich deutlich bemerken. Die Deutschnationale Volkspartei fühlte sich im Vollbewußtsein ihrer Kraft und als die Hüterin aller positiven Werte, und als solche wollte sie zur Macht kommen. Das Zentrum betrachtete sich als unentwegte Verfassungspartei. Die Bismarckische Verfassung war ihm unsympathisch, da in ihr das Wort "Gott" fehle, sowie jedes Wort über das Verhältnis der Staaten zu den christlichen Kirchen. Die Weimarer Verfassung dagegen erkenne die Freiheit der Kirchen ausdrücklich an. Der demokratische Flügel herrschte in dieser Partei vor, so stellte sie sich ihren Wählern am 29. Oktober vor als föderalistische, christliche Partei, welche auf dem Wege zum Reichskonkordat die Bekenntnisschule fordere. Annäherungsversuche des Zentrums an die Bayerische Volkspartei wurden jedoch von dieser zurückgewiesen. Der Aufruf schloß mit Windthorsts ewig junger Losung: "Für Wahrheit, Recht und Freiheit!" [111] Schließlich mußte sich noch die Deutsche Volkspartei erklären. Sie tat es mit einem sehr geschickten Manifest vom 14. November, indem sie weder rechts noch links besondere Sympathien entgegenbrachte, sich aber doch durch Aufnahme der Losung Schwarz-Weiß-Rot zu den Deutschnationalen hielt. Sie forderte "nationale Realpolitik", eine gerechte Aufwertung und bezeichnete sich als national, liberal und sozial. Zur Schau getragenes Republikanertum sei keine Gewähr für Tüchtigkeit und Charakter. "Der Weg zum Aufstieg führt nicht rechts noch links, er führt geradeaus." Wenn auch die Volkspartei keine zahlenmäßig starke Partei war, so wußte sie doch sehr wohl, daß sie allein die deutsche Politik seit dem Herbst 1923 gemacht hatte. –
Durch dies zum Teil bewußte, zum Teil unbewußte Empfinden der Massen, daß ein Machtkampf zwischen zwei Prinzipien ausgefochten werden sollte, ließ es sich auch erklären, daß die beiden Extreme, die Kommunisten und die Deutschvölkischen, zugunsten der Parteien, welche die starken Träger der nach Macht drängenden Tendenzen waren, der Sozialdemokraten und der Deutschnationalen und der Deutschen Volkspartei, zahlreiche Anhänger verloren. Die Sozialdemokraten gewannen 1 700 000 Stimmen, die Kommunisten verloren 1 100 000. Die Deutschnationalen und die Deutsche Volkspartei gewannen rund ¾ Millionen, während die Deutschvölkischen über 1 Million einbüßten. Das Zentrum erhielt etwa 140 000 Stimmen mehr und überschritt 4 Millionen, die Demokraten konnten einen Zuwachs von ¼ Million verzeichnen, wobei sie noch nicht 2 Millionen Stimmen erreichten. Der neue Reichstag erhielt folgende Sitze, zum Vergleich sind die Ziffern der Wahl vom 4. Mai beigefügt:
In einem parlamentarisch regierten Staatswesen, und Deutschland war ein solches, spielt das Parteileben eine große Rolle. Das aber war der Unterschied des deutschen Parlamentarismus gegenüber dem englischen, amerikanischen und französischen, er stützte sich nicht auf die fundamentalen Parteien der Rechten, der Linken und der Mitte, sondern er bestand [114] gewissermaßen aus einer Stufenleiter dem Wesen und der Zahl nach zentrifugal veranlagter Parteien. Es gab deren fünf, welche das Rückgrat des deutschen Parteilebens spielten, das sind, von rechts nach links genannt: Deutschnationale Volkspartei mit Bayerischer Volkspartei, Deutsche Volkspartei, Deutsch-Demokratische Partei, Zentrumspartei und Sozialdemokratische Partei. Diese Parteien umschlossen insgesamt etwa 30 Millionen Wähler, drei Viertel der gesamten wahlberechtigten deutschen Bevölkerung.
Das Ziel der Demokratie ist die kulturelle, sittliche und wirtschaftliche Hebung der Volksmassen, die freie Selbstbestimmung des Volkes im Verkehr mit anderen Völkern und die freie Selbstverwaltung des eigenen Staatsapparates. Darum lehnen sie den sogenannten kaiserlichen Obrigkeitsstaat ab und treten für den freien, vom Volke verwalteten Staat ein, der [115] nur dem Volke in seiner Gesamtheit oder seiner Vertretung, dem Reichstag, verantwortlich ist. Darum auch verurteilen sie den Krieg, da er eine schwere Störung und Bedrohung der Entwicklung der Völker darstellt, sie verlangen die internationale Verständigung. Dennoch erkennen sie das Recht des Volkes an, sich zu wehren und zu verteidigen, wenn es von anderer Seite angegriffen wird. Den durch den Versailler Frieden herbeigeführten Zustand der Hilflosigkeit betrachten sie als ein Unrecht und eine Ansehensminderung, den sie nicht durch eine deutsche Aufrüstung, sondern durch eine proportionale Abrüstung der andern beseitigt wissen wollen. Sie lieben den Völkerbund, denn er soll die Welt befrieden, dies aber läßt sich nur durch Kompromisse erreichen. Die Wirtschaft der Völker ist eng untereinander verflochten, und aus dieser gegenseitigen internationalen Wirtschaftsverflechtung und ‑verpflichtung ist der Freihandel vor der nationalen Absperrung der Völker durch hohe Schutzzollbarrieren zu bevorzugen. Daher ist auch der Gedanke, Zentral-Europa handelspolitisch eng zusammenzuschließen, sympathisch. Friedrich Naumann, der 1919 viel zu früh aus Gram über Deutschlands Schicksal verstorbene Idealist, propagierte eifrig den Gedanken des mitteleuropäischen Zusammenschlusses, der von anderer Seite bis zur Forderung der Vereinigten Staaten von Europa erweitert wurde. Die paneuropäische Idee gehört zu den Lieblingsgedanken demokratischer Kreise. Auch die soziale Frage und das Arbeitsrecht müssen international behandelt werden. Friede, Freihandel, Völkerverständigung sind die Ziele demokratischer Politik. Unter der Reichskanzlerschaft Wirths erlebte die demokratische Politik ein kurzes Aufleuchten, als Rathenau sich bemühte, die deutsche Außenpolitik nach den wirtschaftlichen Grundsätzen der Demokratie zu formen. Jahrelang war ein Demokrat Reichswehrminister, Dr. Geßler; vielleicht ist diese Tatsache, die weniger einem aggressiven, als vielmehr einem defensiven Willen ihren Ursprung verdankte, das bestimmendste Moment des demokratischen Geistes in Deutschland. Der Reichswehr, die aus der alten kaisertreuen Armee hervorgegangen war, wurde ein Vertreter des neuen Regimes [116] vorgesetzt, der mit Umsicht, Klugheit und Takt zwischen altem und neuem Geiste zu vermitteln verstand und der Republik gegenüber durch seine Gesinnung verbürgte, daß er die gefährliche Waffe nie gegen, sondern stets für die Demokratie verwenden würde. – Das starke Zurückgehen der demokratischen Gefolgschaft auf ein Drittel ihres ehemaligen Bestandes war gewiß das Zeichen einer großen Enttäuschung, dennoch behielt die Demokratische Partei die Entscheidung über die republikanischen Interessen des Reiches in der Hand, und zwar nach der Entscheidung vom 7. Dezember 1924 mehr denn je. Im Reichstag standen rechts von ihr 196 (4. Mai: 176), links von ihr 198 (4. Mai: 165) Abgeordnete. So war es möglich, daß bereits im Oktober die Stellung der 28 demokratischen Abgeordneten entscheiden konnte, ob die Deutschnationalen an der Reichsregierung teilnehmen durften oder ihr fernbleiben mußten. Diese Fähigkeit, den Ausschlag zu geben, behielt die Demokratie auch weiterhin. Sie bewies, daß sie weniger durch Zahlen, als vielmehr durch ihren Geist herrschte. Bei keiner Partei war insofern die Verpflichtung, vor dem Urteil und der Abstimmung sorgfältig zu prüfen und zu wägen, größer und dringender als bei den Demokraten.
Das Zentrum war in jeder deutschen Regierung seit Februar 1919 vertreten. Es stand an der Seite der Sozialdemokratie, weil es jede Erinnerung tilgen wollte an die Vergangenheit, die ihm als eine Zeit der Kulturknechtschaft erschien, und weil es die große, internationale Katholizität der Welt schaffen wollte, in welcher der besondere nationale Gedanke keinen Raum hat. Die unchristliche Sozialdemokratie war dem katholischen Zentrum lediglich Mittel zum Zweck. Versöhnung innen und außen, Volksgemeinschaft und Völkergemeinschaft waren die Prinzipien, nach denen das Zentrum das Reich leitete. Nicht mit Gewalt, sondern durch Überzeugung sollte der Haß draußen und drinnen zerteilt werden. Aus diesem Versöhnungswillen floß die Erfüllungspolitik der Wirth-Ära, aus dieser Versöhnungspolitik heraus war das Zentrum Gegner der sogenannten reaktionären Deutschnationalen, und deshalb wollte Marx die Deutschnationalen nicht an der Regierung teilnehmen lassen.
Die deutsche Republik war ein Kompromiß zwischen Demokratie und Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie, welche auf den Trümmern des von ihr zerstörten Kaiserreiches einen neuen Staat errichten wollte, mußte sich, da sie, durch Rußlands Beispiel gewitzigt, ihren radikalen Gesinnungsfreunden mißtraute, die Verbindung mit der bürgerlichen Demokratie suchen. Bereits im Dezember 1918 vollzog sich diese Hinwendung zum Bürgertum, und die Sozialdemokratie brachte manche ihrer Doktrinen, besonders auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens, der Sozialisierung, zum Opfer und akzeptierte die schwarzrotgelbe Fahne. Sie war die treibende Kraft in Fragen der Erfüllungspolitik, der Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung und blieb dies fünf Jahre hindurch unbestritten. Die Sozialdemokratie hatte durch die sehr stark in ihr vertretenen bürgerlichen Elemente, besonders Beamte, nach außen hin ein bürgerliches Aussehen angenommen, was ihr von den Kommunisten stark verdacht wurde. Dennoch gelang es ihr nicht, den Charakter als Klassenpartei zu verleugnen. Besonders deutlich trat das proletarische Klassenmoment nach der Vereinigung mit den Unabhängigen 1922 hervor. Auf allen Gebieten verstärkte sich der Klasseninstinkt der Besitzlosen bis zu bestimmendem Einfluß, und das ist es, was der Partei vor der Geschichte ihre sittliche Kraft raubte. Die Gesetzgebung auf dem Gebiete des Sozialwesens und der Wirtschaft, der Löhne und Gehälter strebte überall nach Begünstigung des Proletariats über das erlaubte Maß hinaus. Die rücksichtslose Demokratisierung der inneren Verwaltung, die hauptsächlich nach der Ermordung Rathenaus einsetzte, brachte unbillige Härten gegen alte, verdiente Beamte, die durch unkundige, junge Sozialdemokraten ersetzt wurden. Das mammonistische Moment, das Bestreben, sich zu bereichern, trat [119] sehr häufig in den Vordergrund, egoistisch und brutal, da niemand danach fragte, ob die Sucht nach Reichtum einiger weniger Bevorzugten der Arbeiterklasse sich mit dem Wohle der Gesamtheit verträgt, ob nicht die Jagd nach dem Golde den besitzfeindlichen Doktrinen der Sozialdemokratie entgegenlaufe. Das Werkzeug aber, womit die Sozialdemokratie ihre Massen beherrschte, waren die Gewerkschaften, deren Seele in marxistischer Dialektik geschulte Sekretäre waren. Die Sozialdemokratie war durchaus pazifistisch: sie kämpfte um die Erhaltung des Friedens, wobei sie im Unterschied zu den Demokraten auch Verteidigungskriege ablehnte und an ihrer Stelle Schiedsgerichte eingesetzt wissen wollte. Auf diese internationale Versöhnung hofften die Sozialisten mit einem unerschütterlichen, geradezu doktrinären Optimismus. Ihr Versöhnungswille richtete sich besonders auf Frankreich, welches von den Anhängern der nationalen Parteien als Erbfeind, als Todfeind betrachtet wurde. Die wirkliche und letzte Garantie für die Aufrechterhaltung des Friedens sahen sie in der internationalen Überwindung des Kapitalismus und im Sieg des Sozialismus. Denn Kapitalismus bedeute Kriegsgefahr, aber es gebe Tendenzen zu ihrer Vermeidung, eine solche sei der Völkerbund. Die Sozialdemokratie stimmte diesem zu und verlangte Deutschlands Eintritt. Allerdings müßte dieser Völkerbund noch mehr demokratisiert werden, die Vertretungen der Regierungen müßten in wirkliche Vertretungen der Völker umgewandelt werden. "Um die Lage Deutschlands zu verbessern, die Wiederherstellung seiner Gleichberechtigung und seinen Wiederaufstieg anzubahnen", haben die Sozialdemokraten ohne Rücksicht auf die schweren moralischen und wirtschaftlichen Schäden stets die Diktate des Westens angenommen: den Waffenstillstand, den Versailler Vertrag, das Londoner Ultimatum, den Dawes-Plan. Um die Lage der Arbeiterschaft zu verbessern, diese zur maßgebenden Klasse in Deutschland zu machen, haben sie eine katastrophale Lohntarif- und Sozialpolitik getrieben und die erwerbenden Stände mit Steuern bedrückt. Um ihre materialistische Weltanschauung durchzusetzen, verleugneten sie Nation und Vaterland und Gott und verstiegen sich bis zur [120] Gotteslästerung. Rücksichtslosester Opportunismus beseitigte alle sittlichen Hemmungen. Wurde die Sozialdemokratie aus der Regierung in die Opposition gedrängt, wie z. B. unter der Regierung Fehrenbach, dann während der Ära Cuno, stellte sie sich unbedenklich auf die Seite der Feinde Deutschlands, indem sie das französisch-englische Märchen von Deutschlands Kriegsschuld gegen ihr eigenes Vaterland noch unterstützte, so in Genf 1920 und in Hamburg 1923. Als 1925 die Aufwertungsfrage aufgerollt wurde, trat die Sozialdemokratie, nur um den Regierungsparteien des Kabinetts Luther die Arbeit zu erschweren, für eine höhere Aufwertung ein, während sie, solange sie an der Regierung war (Hilferding 1923), jede Aufwertung ablehnte. Alle Größen dieser Partei, die zu Bedeutung und Ansehen gelangten, waren moralisch mehr oder weniger belastet, während viele ehrliche Menschen ihr den Rücken kehrten, da sie das vollkommen Amoralische der Partei, hervorgegangen aus dem Materialismus, nicht ertragen konnten. – Die Linksparteien waren infolge der durch den Krieg hervorgerufenen seelischen Zerstörung des deutschen Volkes zur Macht gelangt. Sie konnten nur gedeihen auf dem Boden der Katastrophenpsyche und des Defätismus, sie konnten nur blühen in der fauligen Luft der Zersetzung und Zerstörung materieller und ethischer Werte des spezifischen Deutschtums. Sozialisten und Zentrum hatten 1919 annähernd 18 Millionen Wähler zusammenbekommen, unter Einschluß der Demokraten verfügte der demokratische Block über 23 Millionen Stimmen. Aber nur ein Fünftel hiervon, 4½ Millionen, konnten die beiden Rechtsparteien (Deutschnationale 3,1 Millionen, Deutsche Volkspartei 1,3 Millionen) in die Waagschale werfen. Auf diese beiden Parteien, in denen sich hauptsächlich die geistig und materiell Besitzenden zusammengefunden hatten, entlud sich der ganze Groll der demokratischen Übermacht. Sie waren die Kriegshetzer und Kriegsverlängerer, die das Volk in der Heimat hungern und im Felde totschießen ließen. Sie wurden verfemt und geächtet als die Feinde des neuen Reiches, und bei allen möglichen Anlässen wurden unter der Bezeichnung Mon- [121] archistenverfolgungen wahre Pogrome veranstaltet. Die Anhänger der Rechtsparteien wurden geradezu amtlich geächtet, indem Wirth in seiner Stellung als Kanzler des Deutschen Reiches den Ausspruch tat: der Feind steht rechts! Putsche und politische Morde legte man den Rechtsparteien zur Last, ohne daß man klare Beweise dafür hatte. Wohl war es richtig, daß die Mörder Erzbergers und Rathenaus den Rechtskreisen entstammten, damit war aber noch nicht bewiesen, daß die Rechtsparteien diese Taten billigten, im Gegenteil! Sie verurteilten sie sogar sehr scharf! –
[122] Die Politik der Deutschen Volkspartei war Realpolitik, aus reinen Nützlichkeitserwägungen heraus. Sie rechnete einerseits dabei mit der Tatsache der Koalitionsregierungen, in denen auch andere Parteien mitzureden hatten, andererseits auch mit der Tatsache der deutschen Ohnmacht, da das Reich den starken Völkern des Westens keine gleich starke Macht entgegenzusetzen hatte. Der Freiherr von Rheinbaben charakterisiert das Leitmotiv der Deutschen Volkspartei mit folgenden Worten:
"Gegenüber dem Irrglauben an Wilson, gegenüber der pazifistischen Hoffnung auf internationales Recht und Gerechtigkeit als herrschendes Prinzip der Sieger, gegenüber all denen, die in Deutschland selbst die jahrhundertelangen Erfahrungen der preußischen und deutschen Geschichte vergessen hatten und wirklich an das Heraufkommen einer mit andern Mitteln arbeitenden neuen Epoche glaubten – zu kämpfen, so gut wie die Deutsche Volkspartei dies tun konnte." Die Außenpolitik mußte von inner- und außenpolitischen, von illusionistischen und internationalen Tendenzen losgelöst werden. Eine gewisse Gemeinsamkeit der Interessen erkannte die Volkspartei zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten, die das größte Interesse an einer Befriedung Europas und den ehrlichen Willen einer allgemeinen Abrüstung besaßen. Ein gewisser gefühlsmäßiger Antrieb brachte sie in einen engeren Kontakt mit England. In den auf Ausgleich der europäischen Gegensätze gerichteten Bestrebungen der englischen Politik seit 1922 erkannte die Volkspartei eine Parallelerscheinung zu ihren eigenen politischen Bemühungen. Ein bis zu einem gewissen Grade egoistisches wirtschaftlich-kommerzielles Interesse führte die Volkspartei an die Seite Englands bei der Bekämpfung französischer Militärpolitik, so daß sich das Hauptaugenmerk der volksparteilichen Außenpolitik mit Zustimmung Großbritanniens auf eine nicht einseitige, sondern gegenseitige Verständigung mit Frankreich richtete, und hieraus erwuchs das Problem, die deutsche Freiheit am Rhein zurückzugewinnen. Es war auch eine rein realpolitische und nüchterne Erwägung, wenn die Volkspartei dem Beitritt zum Völkerbunde zustimmte, trotzdem sie überzeugt war, daß der Völkerbund von all seinen hohen Zielen und Idealen [123] nicht das kleinste Quentchen erfüllt hatte. Aber man erachtete es für nötig, daß auch Deutschland in dieser Versammlung der Völker sein Recht geltend mache. Indem die Deutsche Volkspartei geschlossen das Versailler Diktat ablehnte, befand sie sich in Opposition zur herrschenden Richtung im Reiche. Nachdem aber der Vertrag angenommen war, war für diese Opposition keine Berechtigung mehr: es galt noch so viel zu retten, als unter den gegebenen Tatsachen möglich war. So trat die Deutsche Volkspartei unter Fehrenbach Ende Juni 1920 in die Regierung ein. Ihr großer Wirtschaftsführer Stinnes bemühte sich dann auch, in Spa, soviel als irgend anging, Erleichterungen für Deutschland zu erlangen. Aber dieses Kabinett und mit ihm die Deutsche Volkspartei scheiterten am Londoner Ultimatum Anfang Mai 1921. Die Volkspartei betrachtete es als einen Fehler, daß sie seinerzeit gegen das Ultimatum stimmte. Jetzt verlor sie ihren Einfluß in der Regierung wieder, und Stinnes wurde durch den Demokraten Rathenau ersetzt. Nun, nach dem Ausscheiden der Volkspartei, begann das große Unglück der Inflation für Deutschland. Erst als Wirth am Ende seiner Erfüllungspolitik stand und abtreten mußte, räumte man der Volkspartei wieder Teilnahme an der Regierung ein, indem Cuno, der zwar kein ausgesprochener Parteipolitiker war, aber als verantwortlicher Leiter eines großen überseeischen Handels- und Verkehrsunternehmens der Partei sehr nahestand, die Führung des Reiches übernahm. Aber alle guten Absichten und Vorsätze wurden vereitelt durch die Ruhrbesetzung. Jetzt trat das national-ideale Moment der Volkspartei in den Vordergrund, und der Ruhrkampf als Angelegenheit der Nation ließ alle wirtschaftlichen Notwendigkeiten in den Hintergrund treten. Nachdem man erkannt hatte, daß der Ruhrkampf infolge der deutschen Schwäche und Uneinigkeit scheitern mußte, stellte sich Stresemann wieder auf den Boden der Tatsachen. Er bildete die Regierung der sogenannten "Großen Koalition", in der zum erstenmal auch die Sozialdemokratie vertreten war, welche es bisher abgelehnt hatte, mit der Volkspartei zusammenzuarbeiten. Die Große Koalition war, rein [124] parteitaktisch betrachtet, ein Sieg der Volkspartei und eine Niederlage der Sozialdemokratie, aber sie erwies sich als arbeitsunfähig. Darüber hinaus blieb es ein Verdienst der Deutschen Volkspartei, daß sie in der Zusammenarbeit mit deutschnationalen Kräften, vor allem mit dem hervorragenden Helfferich, dem deutschen Volke die Rentenmark brachte und so der weiteren Zerrüttung des Volkes Einhalt gebot. Die Bestrebungen der Volkspartei während des Jahres 1924, besonders nach den Maiwahlen, gingen dahin, auch die Deutschnationale Volkspartei zur Mitarbeit heranzuziehen. Zwar scheiterten diese Versuche am Widerstand des demokratischen Blocks, aber die Bundesgenossenschaft beider Rechtsparteien während des Herbstwahlkampfes führte dennoch zur Erreichung dieses Zieles im Januar 1925. Seit dem Herbst 1923 erfuhren die deutschen Ereignisse eine Wendung zum Besseren, hervorgerufen durch die Deutsche Volkspartei, der es gelungen war, den bis dahin herrschenden sozialdemokratischen Einfluß, vor allem in der Außenpolitik, zu brechen. –
Es handelte sich bei den Deutschnationalen nicht um eine Klassenpartei etwa der Besitzenden. Sie war eine Weltanschauungspartei, die zur Volksgemeinschaft strebte. Das Moment des ländlichen Besitzes, das in der Deutschkonservativen Partei vorherrschte, wurde sehr stark ergänzt durch städtisches Bürgertum und Arbeiterschaft. Der psychologische Angelpunkt dieser Volksgemeinschaft war nicht irgendein materielles Sonderinteresse, sondern eine ideelle, moralische Spannkraft: die militärische Tradition, welche die ganze Überlieferung einer stolzen Vergangenheit umschloß. Die Blutsbruderschaft aller [125] Volksgenossen ohne Ansehen des Standes und Berufes, die in vorderster Linie für Deutschlands Größe und Freiheit gekämpft hatten, war der bindende Kitt der Partei. So kam es, daß die Militärverbände und der "Stahlhelm" der Partei nahestanden und viele ehemalige Offiziere, oft nicht zum Nutzen der Partei, in führende Stellungen gelangten; das politische Leben läßt sich nicht kommandieren. Jedoch dieser militärische Geist besaß eine große seelische Schwungkraft, und diese war es recht eigentlich, welche die Deutschnationalen bewog, sechs Jahre in unerschütterlicher Opposition zu verharren. Besonders bitter empfanden sie die Schmach der Entwaffnung unter feindlicher Aufsicht. Sie forderten das starke, mächtige Reich zurück, an dessen Spitze ein in der Welt geachteter Kaiser stand; sie setzten sich dabei manchmal mehr als der Sache dienlich war für die Person des geflohenen Kaisers ein. Sie betrachteten alle, die seit November 1918 an der Spitze des Reiches standen, als Usurpatoren, die durch Verrat und Verbrechen an die Macht gelangt waren. Ein freies, einiges Deutschland in den Grenzen von 1914, eine starke Wehrmacht mit einem monarchischen Haupte, Schutz der idealen Güter und der christlichen Kultur, Wiedergewinnung der verlorenen Kolonien, das waren die Ziele der Partei. Internationale Verständigung im Sinne der Sozialdemokratie galt als unmännlich. Der Versailler Traktat wurde nicht als ein Fatum hingenommen, sondern ganz einfach als eine tiefe nationale Schande betrachtet, alles was darauf folgte, war nur eine Kette entehrender Demütigungen.
"Die Freiheit des deutschen Volkes von fremder Zwangsherrschaft ist die Voraussetzung der nationalen Wiedergeburt. Auf freiem Boden ein neu erstarktes Reich, die abgerissenen deutschen Lande ihm wieder vereint, das ist und bleibt das Ziel aller deutschen Politik, darum erstreben wir die Änderung des Versailler Vertrages, die Wiederherstellung der deutschen Einheit und den Wiedererwerb der für unsere wirtschaftliche Entwicklung notwendigen Kolonien." So lautete der erste Satz des Parteiprogramms. Die Schande der deutschen Kriegsschuld muß wieder von Deutschland genommen werden, damit das bedeutende Kulturvolk der Deutschen nicht [126] länger als Paria, als Hunne unter den zivilisierten Nationen dasteht. Das Recht und die sittliche Pflicht der freien, ehrenhaften, untadeligen Persönlichkeit wurde als oberstes Gesetz des Staates und Volkes proklamiert, die Reichsverfassung erschien als eine unzulängliche Nachahmung der Verfassungen westlicher Demokratien, nur darauf berechnet, die unverantwortliche, amoralische Masse über das Individuum zu erheben. Bewußte Pflege des nationalen und militärischen Geistes im Volke und in der Jugend ließ sich die Deutschnationale Volkspartei angelegen sein. Sie säte eine Saat hoher Ideale, die bei jungen, leidenschaftlichen Hitzköpfen leicht zu Kollisionen mit dem bestehenden System führten und häufig der Anlaß ungerechter Verfolgung und Bedrängnis wurden. Helfferich, der große Kämpfer für Wahrheit und Recht, wurde im Reichstag als Mörder Erzbergers bezeichnet, als der ehemalige Reichsminister erschossen worden war. Nach der Ermordung Rathenaus genügte die Zugehörigkeit zur Deutschnationalen Volkspartei, um bewährte Beamte ihres Postens zu entheben. Man warf den Deutschnationalen vor, sie riefen Geheimbünde ins Leben und unterhielten eine Menge verborgener Waffenlager, sie seien daran schuld, daß die Militärkontrolle noch nicht beendet sei. Man verfolgte die große Oppositionspartei mit tödlichem Hasse. Dennoch bekannte sich ein Sechstel aller deutschen Wahlberechtigten 1924 zu ihr. Diese große Anhängerschar drängte mit zwingender Notwendigkeit dahin, daß die Partei aus ihrer Opposition heraustrete. Man verlangte von ihr, daß sie nun selbst an der Regierung teilnehme. Die Zeit war gekommen, da man verlangte, daß den Worten Taten folgen sollten. Das war ein folgenschweres Verlangen, welches manches Opfer kostete, und das ging natürlich nicht ohne Krisis ab; sie begann am 29. August 1924 mit der Abstimmung über die Dawes-Gesetze und endete am 23. Oktober 1924 mit dem Rücktritt Hergts, der sechs Jahre lang die Partei in der Opposition geführt hatte. Der gesunde Organismus der Deutschnationalen Volkspartei überwand die Krisis ohne Gefahr. Nachdem sie ihren Entschluß bewiesen hatte, in die [127] Reichsregierung einzutreten, erhielt sie am 7. Dezember 1924 noch einige hunderttausend Stimmen mehr als am 4. Mai. –
Der kurze Querschnitt durch das deutsche Parteileben mag genügen, um ein Bild von dem politischen Angesichte Deutschlands um die Jahreswende 1924/25 zu vermitteln. |