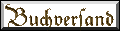|
 Der Frankfurter Friede [Scriptorium merkt an: 1871] So lange die Bourbonen über Frankreich herrschten, war wohl die Hoffnung auf die Revision des Pariser Friedens niemals verstummt, aber weniger an einen neuen Krieg als an unblutige Länderschiebungen gedacht worden. Als jedoch nach der Julirevolution die Trikolore wieder zur Nationalfarbe wurde, erwachte aufs neue die Erinnerung an die unter ihr erfochtenen Siege. Die Pariser Presse warf dem gestürzten Königshause vor, daß es in den Bagagewagen der Fremden nach Frankreich zurückgekehrt sei. Sie zog zwischen diesen Anschauungen und dem neuen Volksgeist einen breiten Strich. Der National äußerte unverblümt die Notwendigkeit eines neuen Krieges. "Frankreich", hieß es dort, "ist nicht glücklich, so lange es noch eine Spur der Verstümmelungen trägt, die ihm demütigende Verträge zugefügt haben, so lange uns der Wachtruf der heiligen Allianz hinter den Pyrenäen und den Alpen, von den Bergen der Schweiz bis zur Mündung des Rheines bedroht." Derart kriegslustig war schon 15 Jahre nach den furchtbarsten Kampfeseindrücken die hauptstädtische Stimmung. König Ludwig Philipp ließ sich allerdings von ihr nicht hinreißen. Als Geschäftsmann scheute er waghalsige Abenteuer. Ebenso wußte er, daß er bei einem unglücklichen Kriege um den Thron spielte. Anderseits belehrten ihn fortgesetzte Unruhen und wiederholte Mordversuche über seine schwankende Lage. Er konnte den ihm unbequemen Volks- und Zeitungsmeinungen die Spitze bieten, so lange er gewisse äußere Erfolge hatte; so hatte er zwar Belgien nicht mit Frankreich wieder vereinigt, immerhin die holländische Schöpfung des Wiener Kongresses zertrümmern und einen neutralen Staat, welcher sich naturgemäß an den französischen Nachbar anlehnte, entstehen lassen helfen. Indessen erlebte die Regierung Ende der dreißiger Jahre eine Niederlage in der orientalischen Frage. Da Thiers mit England keinen Krieg anzetteln konnte, lenkte er die patriotischen Ansprüche auf Preußen und Österreich ab. [89] Das ganze linke Rheinufer wurde wieder der französische Schlachtruf. Mit Mühe beseitigte Ludwig Philipp durch einen Ministerwechsel die Kriegsgefahr. Drückender als den Bourbonen und Orleans erschienen Napoleon III. die Fesseln der Wiener Kongreßbeschlüsse. Anfangs trieb ihn freilich sein Ehrgeiz in eine andere Richtung. Für seinen Oheim war die Hauptstätte seines Ruhmes Italien gewesen; von hier hatte er das Haus Habsburg vertrieben und hier hatte er seinen europäischen Einfluß zuerst begründet. Den Neffen schmerzte es, daß gerade dieses Werk vom Wiener Kongresse vernichtet worden war. Fester als je herrschte seit 1815 Österreich über die ganze Halbinsel, während durch den zweiten Pariser Frieden Frankreich noch die letzten, ihm 1814 verbliebenen Stützpunkte verloren hatte. Eine kräftige italienische Nationalbewegung, welche sich dem fremden österreichischen Regimente widersetzte, kam Napoleon zu Hilfe und trieb ihn andererseits vorwärts. So galt er gleichzeitig als Befreier und als Rächer französischer Einbußen. Denn falls Österreich zurückgedrängt wurde, schien Piemont-Sardinien zu schwach, um das französische Übergewicht zu brechen. Eine wertvolle Grenzberichtigung und eine französische Garnison in Rom unterstützte Napoleons Verlangen nach indirektem maßgebenden Einflusse auf die Italiener. Man darf solche Schritte nicht wie Sybel als Halbheit, als "falsche Nachgiebigkeit gegen die altfranzösischen Traditionen" und als "Verfälschung eigener napoleonischer Gedanken" betrachten. Dem Neffen des Siegers von Marengo erschienen die Kräftigung des italienischen Nationalgeistes und die politische Hegemonie Frankreichs auf der Halbinsel als eng zusammengehörige Ziele. Zug um Zug wünschte er gleichzeitig die Österreicher aus Italien zu vertreiben und die eigene Autorität zu befestigen. Diesem Gedankenkreis war 1859 die Einverleibung Savoyens und Nizzas gegen die Zuwendung der Lombardei an Viktor Emanuel, war 1866 die französische Vermittlung der Abtretung Venetiens entsprungen. Aus denselben Gründen wurde in den sechziger Jahren erwogen, daß, wenn je ohne französisches Einvernehmen Rom zu Italien kommen würde, dafür Piemont westlich der Sesia französisch werden sollte. [90] Dem gegenüber hatte sich Napoleon um die deutschen Dinge wenig bekümmert. Österreich, welches er nach französischem Herkommen als natürlichen Feind seines Volkes betrachtete, besaß nördlich der Alpen keine Stellungen mehr, welche ihm durch die französischen Waffen zu entreißen waren. Die Preußen behandelte Napoleon vor 1866 mit Wohlwollen und förderte sie, um sie an sich zu ketten und gelegentlich auszuspielen. Wichtig war ihm vor allem, daß beide Großmächte nicht zu eng befreundet wurden. Den Ausbruch des Krieges von 1866 sah er nicht ungern. Den Verlauf hatte er sich aber ganz anders vorgestellt. Er hatte Österreich für den stärkeren Teil gehalten und darauf seine Pläne gebaut. Der österreichisch-französische Vertrag vom 12. Juni 1866 verfolgte einen doppelten Zweck. Einmal sollte, auch wenn Österreich Sieger blieb, Venetien italienisch werden. Zweitens wollte Napoleon in diesem Falle das Haus Habsburg nicht in Deutschland zu mächtig werden lassen. Er überließ ihm Schlesien, gestattete ihm aber sonst keinen Gebietszuwachs ohne französisches Einvernehmen, mit anderen Worten, ohne geeignete französische Entschädigungen. Als Gedanke tauchte ein aus der Rheinprovinz gebildeter französischer Vasallenstaat auf. Die österreichischen Unterhändler, welche Napoleons Unterstützung am Vorabend des Krieges anriefen, schlugen derartiges selbst vor. Durch Königgrätz zerrannen diese ganzen Projekte. Nicht nur hatte Napoleon auf die falsche Karte gesetzt, sondern sah nicht einmal seine Erwartung erfüllt, daß die beiden Großmächte sich annähernd die Wage gehalten und sich gegenseitig stark geschwächt hatten. Ein langjähriger Bundesgenosse der französischen Politik, die eigene deutsche Uneinigkeit, drohte zu entschwinden. Bismarck wäre an sich für eine gütliche Verständigung mit Napoleon zu haben gewesen. Nur durfte er kein deutsches Gebiet opfern, ohne das Vertrauen der Nation, welches er sich erst erwerben mußte, zu gefährden. Gegen die Angliederung Belgiens oder Luxemburgs an Frankreich hatte er nichts einzuwenden, aber keinen Anlaß, sie zu fördern. Damit entfiel auch dieser Ausweg. Frankreich mußte also ohne eigenen Gewinn die Erstarkung Preußens und den wesentlichen Fortschritt der deutschen Einheit zu- [91] lassen. Es empfand den Kriegsausgang als eine nationale Niederlage. Hierdurch vollzog sich in den französischen Volksansichten eine folgenschwere Wendung. Seit dem Mittelalter war in Paris das Haus Habsburg als der eigentliche Feind, jeder Gegner desselben als natürlicher Bundesgenosse betrachtet worden. Preußen hatte zwar ebenfalls vielfach mit Frankreich gekämpft; letzteres hatte darin aber mehr eine Reichstreue als einen gegebenen Interessen- und Gefühlsgegensatz erblickt. Wie tief diese Meinung im Volke gewurzelt hatte, das hatte sich in den französischen Revolutionstagen erwiesen. Damals war die Absage an die Politik Ludwigs XV. und das Begräbnis des österreichisch-französischen Bundes von 1756 als Befreiung aus einem unnatürlichen Zwange begrüßt worden. Mit dieser Auffassung war es seit 1866 vorbei. Zwischen Wien und Paris schien die Rechnung beglichen, im Gegenteil Österreich eine zweckmäßige Stütze gegen das drohende Übergewicht Preußens. Die Hohenzollern rückten in die Rolle der Habsburger als Frankreichs natürliche Widersacher ein. Wie vorher der Kaiserhof, galt jetzt das preußische Königshaus als die schlimmste Schranke für Frankreichs Nationalverlangen, in Deutschland das entscheidende Wort zu führen. Der preußisch-französische Krieg war 1866 nur eine Frage kurzer Zeit. Über die französischen Eroberungsziele konnten 1870 die maßgebenden Männer Preußens nicht im Zweifel sein. Als 1840 Thiers unverblümt das linke Rheinufer für Frankreich gefordert hatte, war aus Moltkes Feder ein Aufsatz über die westliche Grenzfrage in der Deutschen Vierteljahrsschrift (1841) erschienen. Dort hatte er den Satz "die Rheingrenze muß eine Wahrheit werden" "das Thema für die Zukunft Frankreichs" genannt und gesagt: "Wenn nun auch zunächst Friede bleibt, so wird doch die jüngere Generation in Frankreich im Glauben erzogen, sie habe ein heiliges Recht auf den Rhein und die Mission, ihn bei der ersten Gelegenheit zur Grenze Frankreichs zu machen." Seine geschichtlichen Betrachtungen hatte er mit den Worten geschlossen: "Wir glauben gezeigt zu haben, daß Frankreich nicht den geringsten rechtlichen Anspruch auf die Rheingrenze hat. Aber wir wissen auch sehr wohl, daß alles, was man [92] den Franzosen darüber sagt, in den Wind geredet ist. Sie wollen nicht hören. Je klarer alle Zeugnisse der Geschichte und Natur und alle Gründe der Vernunft und Moral gegen sie sprechen, um so weniger wollen sie davon hören." Dieselbe Meinung äußerte Prinz Friedrich Karl achtzehn Jahre später in seiner Denkschrift vom 21. Februar 1859: "Wir erachten das linke Rheinufer für gefährdet, sobald Frankreichs Macht noch mehr zunimmt, als es unter dem jetzigen Beherrscher bereits geschehen ist." Gerade die Ansicht Moltkes, des Prinzen Friedrich Karl und anderer, daß Napoleon III. nach seinem Siege über die Österreicher sich gegen die Preußen wenden, daß abermals wie nach der Habsburgischen Niederlage von 1805 ein preußisches Jena folgen könnte, trug 1859 wesentlich zur Auffassung des Berliner Hofes bei, daß er entgegen Bismarcks Vorschlägen Österreich gegen Napoleon nicht im Stiche lassen dürfe. Und als 1863 wegen der polnischen Verhältnisse abermals sich der Himmel trübte, sagte Moltke: "Der Sympathiekrieg gegen Rußland für Wiederherstellung Polens ist einfach ein Krieg gegen Preußen zur Eroberung des Rheins." Er wußte, daß diese "langersehnte Annexion" notwendig auch den Erwerb Belgiens nach sich ziehen mußte. Die französischen Angriffsabsichten, welche seit Jahrzehnten bekannt waren, bestimmten nun auch die preußischen Kriegsziele schon bald nach den ersten Waffenerfolgen. Wie Gneisenau und andere Landsleute schon in den Freiheitskriegen auf den Oberrhein gewiesen, hatte Moltke bereits 1841 es als einen Fehler bezeichnet, Frankreich "den Besitz deutscher Provinzen und einen so wichtigen militärisch-politischen Vorposten wie Straßburg zu belassen". Noch deutlicher offenbarte sich dieser Mangel 1859 beim Herannahen des italienischen Krieges. Während der Große Generalstab die Front der preußischen Rheinlinie wegen der Entfremdung zwischen Frankreich und Belgien für stark hielt, hegte er Besorgnis für die linke Flanke, falls die Franzosen von Südwesten her den Main erreichten. Schon damals enthüllte Moltke seine militärischen Annexionspläne: "Die einzige, dauernd zu behauptende Eroberung in Frankreich würden die alten deutschen Provinzen Lothringen und Elsaß mit einer noch deutschen, [93] wenn auch für jetzt entschieden französisch gesinnten Bevölkerung sein. Frankreich und Deutschland erlangen dadurch ihre wirklich natürliche Grenze, die Vogesen." Er nannte Straßburg und Metz "Plätze, die für eine künftige Sicherung Deutschlands unentbehrlich sind". Metz, das linksrheinische Hessen und die Rheinpfalz sollten preußisch, Elsaß Austauschgebiet für Bayern und Hessen, Straßburg Bundesfestung werden. Moltke beanspruchte diese Gegenden lediglich aus militärischen Gründen. Den nationalen Gesichtspunkt, daß sie von Deutschen bevölkert waren, zog er nur zur besseren Unterstützung seiner Vorschläge heran. Auch Bismarck hat sich wiederholt und zu ganz verschiedenen Zeiten dahin ausgesprochen, daß er Elsaß und Lothringen nicht wegen seiner Einwohner, sondern zur Sicherung Deutschlands gewonnen habe. 1870 scherzte er über diejenigen, welche sich von ideell-nationalen Beweggründen leiten ließen. Der Entschluß, Elsaß und Lothringen zu behalten, stand 1870 schon nach den ersten Siegen fest. Nach Poschingers Tischgesprächen erklärte Bismarck bereits am 13. August seine feste Absicht. In den nächsten Tagen wurden die ersten derartigen Nachrichten in die Presse lanciert. Zu den Motiven, welche Bismarck bestimmten, gehörte bezeichnenderweise auch die Anschauung, daß sich 1866 der Verzicht auf österreichische Gebietsabtretungen nicht gelohnt und die Rachegefühle des Wiener Hofes nicht verhütet hätte. Durchschlagend aber war das Bedürfnis, "dem Drucke, den Frankreich seit zwei Jahrhunderten auf Süddeutschland übt, ein Ende zu machen, zumal dieser Druck zur Zerrüttung der deutschen Verhältnisse überhaupt in dieser Zeit ganz wesentlich beigetragen hat. Baden, Württemberg und die anderen südwestlichen Landstriche dürfen künftig nicht wieder von Straßburg aus bedroht sein. Auch von Bayern gilt dies". Die Schonung von 1814 und 1815 hätte nichts geholfen und würde abermals nichts helfen. Bei solchen Anschauungen konnte nur der Umfang der Annexionen, nicht der Grundsatz zweifelhaft sein. Zwei Grenzlinien kamen in Frage: die Vogesen oder eine Linie, welche sich vom Lomont über die Faucilles und die Argonnen erstreckte und annähernd der mittelalterlichen Reichsgrenze entsprochen hätte; die dazwischen liegende Mosel zur Grenze zu [94] machen verbot sich wegen des höheren westlichen Ufers. Für die Vogesen sprach, daß wesentlich nur eine deutsch sprechende Bevölkerung einverleibt wurde. Die westliche Linie hätte für einen künftigen deutschen Angriffskrieg gegen Frankreich bessere Bedingungen geschaffen. Wirklich redeten einige Militärs, wie Roon und Alvensleben, derartigen weitergehenden Ansprüchen das Wort. Aber der Gedanke, daß die Vogesen die natürliche Völkerscheide bildeten, war zu sehr eingelebt und wurde auch von Bismarck und Moltke seit Jahren geteilt. Bereits im September wurde die verlangte Grenze auf den Karten, welche den kommenden Friedensverhandlungen dienten, wesentlich entsprechend dem schließlichen Ergebnisse gezeichnet. Ihre Hauptabänderung bestand darin, daß die Franzosen im letzten Augenblicke durch Thiers' Geschicklichkeit Belfort retteten. Abgesehen von Belfort und Umgebung war vom Sundgau bis in die Straßburger Gegend die Grenze durch den Gebirgskamm gegeben. Schwieriger war die Entscheidung in Lothringen. Hätte Deutschland sich nach der Volkssprache gerichtet, so wären die strategischen Gründe vernachlässigt, besonders Metz ausgeschlossen worden. Daran war ernstlich nicht zu denken. Wenn Bismarck wirklich, wie er nach Jahren behauptete, vorübergehend das geplant hätte, gab er solche Bescheidenheit jedenfalls bald wieder auf. Die Frankfurter Zeitung erinnerte in den letzten Novembertagen an Sonnemanns 1871 geäußerten Widerspruch gegen den Erwerb der Reichslande. Sie sah im Ende des jetzigen Weltkrieges wie in der langjährigen schweren Friedensrüstung der Völker eine nachträgliche Rechtfertigung ihres alten Redakteurs. Wenn dieses Urteil sich auf die Annahme gründet, daß Bismarck und Moltke sich 1871 getäuscht, daß sie gegen ihre Erwartungen einen neuen Krieg hervorgerufen, nicht verhütet hätten, so muß dem jedenfalls entgegengehalten werden, daß sie sich über die psychologische Wirkung auf die Franzosen keinen trügerischen Hoffnungen hingaben. Sie haben mit deren Rachegefühl als notwendigem Kriegsergebnisse gerechnet, wie immer die Friedensbedingungen gelautet hätten. Ein von Bismarck inspirierter Artikel erklärte: "Rache für diese Niederlagen der stolzen Nation wird, auch wenn man ihr kein Land nimmt, fortan das Feldgeschrei in Paris und [95] den von da beeinflußten Kreisen sein, wie man Jahrzehnte lang dort an Rache für Waterloo gedacht hat." Weder Bismarck noch Moltke glaubten an einen ewigen Frieden. Als der alte Prinz Peter von Oldenburg in einer weitschweifigen Denkschrift den Reichskanzler bat, durch eine Konferenz die Kriege dauernd aus der Welt zu schaffen, scherzte Bismarck: "Das Opus soll dem Verfasser mit ins Grab gelegt werden." Und wie Moltke sich im Reichstage über den ewigen Frieden als einen "Traum" ausgesprochen hat, ist allbekannt. Der Notwendigkeit, über kurz oder lang mit den Franzosen wieder kämpfen zu müssen, sahen 1871 Bismarck wie Moltke zielbewußt ins Auge. Wenn sie sich über die Zukunft geirrt haben, geschah das nur in der Richtung, daß sie 1871 schwerlich hofften, dreiundvierzig Jahre den Frieden zu erhalten. Man sollte sich vielleicht gerade heute des Wortes von Lord Castlereagh erinnern, der 1815 gemeint hat, 7–10 Jahre sei der weiteste Termin, den man sich im Kriege wie in der Politik setzen dürfe.
|