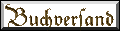|
 Friedensaussichten?
[Scriptorium merkt an: der Leser bedenke, daß dieses
Nachwort noch vor dem Versailler
Friedensdiktat geschrieben wurde! Eine rechtzeitige
Kenntnisnahme der in dieser Ausführung herausgearbeiteten
Lehren der Geschichte hätte evtl. den Zweiten Weltkrieg
verhindern können. Prophetische
Worte eines genialen Historikers - Gänsehautmaterial!! Weder im einzelnen Menschen- noch im Völkerleben läßt sich die Zukunft weissagen. Mit alten Gewohnheiten, Grundsätzen und Charaktereigenschaften paaren sich jederzeit neue Eindrücke und Beweggründe und erzeugen fortwährend gemeinsam etwas bisher nicht Dagewesenes, von allen früheren Erscheinungen Abweichendes. Die geschichtlichen Bedingungen sind also nur eine einzelne von verschiedenen Voraussetzungen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Wir fragen deshalb nicht, was wahrscheinlich geschehen wird - denn dieses Rätsel ist unlösbar - sondern, was die geschichtliche Erfahrung lehrt. Hierauf zu antworten, ist der Historiker berechtigt, ja verpflichtet. Sein Studium wäre unfruchtbar, wenn es nicht den Stoff zum wissenschaftlichen Anschauungsunterricht liefern und das Urteil über gegebene politische Lagen befruchten würde. Gerade jetzt muß das besonders betont werden. Die Gegenwart ist überrascht und geblendet von neuen, unvorhergesehenen und einzigartigen Erscheinungen. Das "Umlernen", [96] der Bruch mit eingewurzelten Überzeugungen und Einrichtungen wird darum nicht nur von bestimmten Parteien gepredigt. Solche Lehren entbehren auch niemals der Berechtigung. Der Lebensbaum der Völker tragt ständig neben jungen grünen Ansätzen und Zweigen halb oder ganz verdorrte Äste, deren Anblick uns gewöhnt ist, die jedoch sonst nicht mehr Daseinsbefugnis haben. Aber anderseits neigen Zeiten großer Umwälzungen und Gärungen dazu, frische Eindrücke zu über-, die noch fortwährende Bedeutung des Alten zu unterschätzen. Dadurch gewinnen Theorien und Schlußfolgerungen, welche sich der Mitwelt scheinbar gewaltsam aufdrängen, in der gewordenen Wirklichkeit indes keinen Boden besitzen, allzu stark die Oberhand. Der Historiker hat ihnen gegenüber die Erfahrungen und Tatsachen hervorzuheben. Augenblicklich scheint mir die Gefahr ungeschichtlicher Betrachtungsweise am verhängnisvollsten in unserem Urteil über die kommenden Friedensaussichten zu wirken. Selbst nüchtern denkende Zeitgenossen versprechen sich vom Völkerbunde und von Schiedsgerichten mit Zwangsvollstreckungen wenn nicht einen ewigen Frieden, doch eine wesentliche und lang andauernde Einschränkung neuer Kriegsgefahren. Nun kann man solche Bestrebungen für sehr nützlich halten und wird doch eine derart umstürzende Wirkung ablehnen. Denn sie widerstreitet nicht nur jeder geschichtlichen Erfahrung, sondern auch den geschichtlich entwickelten Aufgaben jedes Staates. Ein Völkerbund hätte dem Rechte Geltung zu verschaffen. Der Staat ist jedoch die politisch organisierte Macht und hat die Machtinteressen seiner Angehörigen zu befriedigen. Beide Ziele geraten in Widerstreit, wenn die Entwicklung des formalen Rechts hinter wichtigen praktischen Notwendigkeiten zurückbleibt, ja, wenn politisch maßgebende Kreise auch nur annehmen, daß ihre zwingenden Bedürfnisse sich in einem Rechtsverfahren nicht durchsetzen lassen. Deshalb sind alle ähnlichen Vorschläge von Menschheits- und Völkerverbrüderungen seit Jahrtausenden gescheitert und werden immer wieder scheitern. Es ist nicht einmal sicher, ob Völkerbund, Schiedsgericht und Zwangsverfahren im entscheidenden Falle einen Krieg erschweren oder erleichtern würden. Sehr gut kann ein Staat, der für sich allein zu gewaltsamen Schritten [97] zu schwach wäre, den Völkerbund zur kriegerischen Erfüllung von Machtinteressen ausnutzen, ein Staat, welcher die eigene Volks- und Heereskraft nicht einsetzen würde, den Kampf durch die militärische Hilfe des Völkerbundes austragen. Die Zukunft und Wirkung eines Völkerbundes würde ganz davon abhängen, wer in ihm die Macht besitzt und ausübt. Die Vergangenheit widerlegt ebenso schlagend alle Friedenserwartungen, welche sich an die Demokratisierung der menschlichen Gesellschaft knüpfen. Man mag im übrigen, sei es grundsätzlich, sei es aus heutigen Zweckmäßigkeitsrücksichten, Monarchist oder Republikaner, Aristokrat oder Demokrat sein; keine Staatsform schützt zuverlässig gegen Kriegsgefahr und ist auch nicht dazu berufen. Mit großen Einschränkungen ist vielleicht zuzugeben, daß in Monarchien und Aristokratien mehr Familien- und Klasseninteressen, in Demokratien mehr wirtschaftliche Massenbedürfnisse den Ausschlag geben. Aber daß die einen notwendig den Frieden sichern, die anderen den Krieg herbeiführen, widerlegt der Verlauf jedes Jahrhunderts der Weltgeschichte. Hungersnot und Arbeitslosigkeit können ebenso gut Kriegsursache werden wie fürstliche Erbstreitigkeiten oder das Bedürfnis herrschender Schichten, die innere Unzufriedenheit nach außen abzulenken. Aber auch weite Kreise, welche nicht an den ewigen Frieden glauben, welche nichts vom Völkerbunde halten und den veränderten Staatsformen nur einen begrenzten Einfluß auf Krieg und Frieden zuschreiben, halten nach dem jetzigen Weltkampfe eine jahrzehntelange Erschöpfungspause für selbstverständlich. Daß die jetzt Fünfzig- oder gar die Sechzigjährigen einen neuen Krieg erleben könnten, gilt den meisten Zeitgenossen für ausgeschlossen. Deutsche Schwarzseher sagen seit den Novembertagen sogar, das deutsche Volk sei auf 40, 50 Jahre vollständig niedergerungen und schon deshalb seien neue Feindseligkeiten unmöglich. Nun kann natürlich niemand voraussagen, wann der Schlachtruf wieder ertönt. Oft genug haben die wichtigsten Entscheidungen an einem Faden gehangen und oft genug hat ein ganz unberechenbarer Zwischenfall das gesamte Spiel völlig unerwartet verändert. Ausgeschlossen ist also nicht, daß wir einer längeren Reihe von Friedensjahren entgegengehen. Aber [98] der Historiker muß betonen, daß diese heute allgemein für selbstverständlich gehaltene Aussicht allen Erfahrungen der neueren europäischen Geschichte durchaus widersprechen würde. Zunächst hat das deutsche Volk seit den Römerzeiten niemals so lange einen ununterbrochenen Frieden genossen wie 1871–1914. Wer erwartet, daß sich diese Ruhepause sofort wiederholt oder gar noch vergrößert, gleicht dem Spieler, welcher einen großen Gewinn gemacht hat und bei der nächsten Runde auf die gleiche Nummer setzt. Außerdem wissen wir, daß die Dauer des Frankfurter Friedens dem Zusammentreffen verschiedener, besonders glücklicher Umstände zuzuschreiben ist. Bismarcks Friedensschlüsse hinterließen bei den Besiegten gewiß schmerzliche Empfindungen, machten ihnen aber das Staats- und Wirtschaftsleben nicht unerträglich. In die inneren dänischen, österreichischen und französischen Verhältnisse mischte er sich nicht ein. Er sicherte lediglich die eigenen Bedürfnisse und Daseinsbedingungen; außerhalb dieser Grenze achtete er die fremden. Hierdurch nötigte er keinen Gegner zu Verzweiflungskämpfen und zur rasch auflodernden Rache. Deswegen verleiteten ihn aber auch niemals die größten Siege, die augenblickliche Lage zu möglichst weitgehenden Forderungen auszunutzen; sondern er verlangte nur das, was er brauchte und voraussichtlich auch später behaupten konnte. So erreichte er, daß die Dänen und Österreicher, wenn auch notgedrungen, mit ihren Verlusten sich aussöhnten, daß die Franzosen immer wieder ihre Hoffnungen vertagten, deren Erfüllung für sie keine Lebensfrage war. Vor allem verhinderte er auf solche Art, daß die Neutralen in seinen Friedensschlüssen eine Verkümmerung ihrer Interessen erblickten. Die Franzosen konnten mithin lange Zeit hindurch weder aus eigener Kraft die Einbußen des Frankfurter Friedens wettmachen noch Bundesgenossen finden, welche wichtige Interessengegensätze mit Deutschland auszufechten hatten. Dabei verschob sich die Volksziffer bei jeder Zählung zu Gunsten der Deutschen. Die Seite, welche sich 1870 als überlegen gezeigt hatte, wurde es also noch mehr. Gleichzeitig steckte sich das Deutsche Reich nicht nur für sich friedliche Ziele, sondern erkannte, daß es eines allgemeinen [99] Friedens in Europa bedurfte, um am zuverlässigsten seine Kräfte zu entfalten. Es übernahm die Rolle des ehrlichen Maklers bei Meinungsverschiedenheiten, an denen es nicht beteiligt war. Da ihm nur daran lag, auswärtige Zusammenstöße zu verhindern oder örtlich zu beschränken, nicht nach bestimmten selbstsüchtigen Richtlinien zu leiten, gewann es auch abgesehen von äußeren Machtmitteln eine große innere Autorität zur Schlichtung fremder Streitfragen. Hierbei half ihm, daß zwei alte europäische Erdbebengegenden, Deutschland und Italien, durch die letzten Jahrzehnte zur Ruhe gekommen waren. Im wesentlichen brannte nur ein alter Vulkanherd, der Balkan, weiter, und dieser lag abseits von Mitteleuropa. So bewahrten Bismarck und seine Nachfolger nicht nur Deutschland den Frieden, sondern hinderten auch größere europäische Verwicklungen, welche Deutschland zunächst nichts angegangen hätten, aber zuletzt doch in Mitleidenschaft ziehen konnten. Trotz dieser außergewöhnlich günstigen Bedingungen ist der deutsche Friede keineswegs 43 Jahre ungefährdet geblieben. Am 6. Februar 1888 sprach Bismarck aus: "Ist, nachdem der große Krieg von 1870 geschlagen war, irgend ein Jahr ohne Kriegsgefahr gewesen?" Wir wissen heute, daß wir häufig alle Geschicklichkeit aufwenden mußten, um den Krieg zu vermeiden, und daß wir wiederholt am Abgrunde taumelten. Es wäre wissenschaftlich fruchtbarer, vielleicht auch für das deutsche Nationalinteresse dienlicher, statt immer wieder die Schuld oder Unschuld am Weltkriege zu erörtern, einmal gemeinverständlich und aktenmäßig zu schildern, wie mühsam jahrzehntelang die maßgebenden deutschen Kreise den Frieden gerettet haben. Die Erkenntnis, daß der Friede nur mit Anstrengungen erhalten worden ist, macht man auch in anderen langen Kampfespausen. Nach dem Wiener Kongreß waren die Bedingungen ebenfalls für den Frieden außergewöhnlich günstig. Nicht nur war Frankreich durch die 23 Jahre der Revolutionskriege reichlich so erschöpft wie jetzt das deutsche Volk, sondern besaß auch eine Regierung, die den Siegern ihren Thron verdankte und große Erschütterungen nicht vertrug. Rußland, der Hauptsieger, verfolgte wesentlich orientalische Interessen, [100] welche Deutschland noch weniger als zu Bismarcks Zeiten berührten. Österreich hatte nur das eine Verlangen, sein Gefüge keinen schweren Belastungsproben auszusetzen. Zwischen beiden deutschen Großmächten bestand ein erträgliches Verhältnis. Trotzdem drohte schon nach 15 Jahren ein neuer Krieg von französischer Seite. In der kurzen Zeit von 1849–1866 mußte Preußen zweimal seine Truppen mobil machen. Wie schwer Friedrich der Große nach dem Siebenjährigen Kriege um den Frieden gerungen hat, wird erst jetzt durch die Veröffentlichung seiner politischen Korrespondenz deutlich. Selbst in scheinbar ruhigen Zeiten kann ein Staatsmann leichter drei Kriege entfesseln als einen verhüten. Schon diese Überlegungen müssen unsere Friedensaussichten wesentlich herabstimmen. Man darf aber auch weiter schon jetzt behaupten, daß, wie auch die Bedingungen im einzelnen lauten mögen, der Friede viel schwieriger zu erhalten sein wird als bisher. Die Besiegten werden auch im günstigsten Falle viel härter getroffen werden als Bismarcks Gegner und in ihren gesamten Lebensbedürfnissen beeinträchtigt sein. Ob sie dann dauernd den gleich starken Friedenswillen sich bewahren werden wie vor dem Weltkriege und noch jetzt, wird die Zukunft lehren; aus der Geschichte wissen wir jedenfalls, daß solche Verhältnisse gern die Brutstätten neuer Kriege sind. Gefördert würden dieselben durch die Erwägung, daß der heutige Krieg nicht von einem bestimmten Sieger, sondern von einer gesamten Siegergruppe gewonnen worden ist. Ihre Mitglieder haben, abgesehen vom gegenwärtigen Kriegszweck, sehr verschiedene Interessen, die sich nach erreichtem Ziele geltend machen werden. Jedoch selbst wenn bei den Deutschen keine Kriegslust über kurz oder lang erwacht, sind sie lange nicht mehr wie bisher imstande, Kämpfe zu verhindern. Sie besitzen dazu weder das alte Ansehen noch die frühere Macht. Ferner hinterläßt der jetzige Krieg im Gegensatze von 1815 und 1871 nicht bloß auf dem Balkan, sondern auch in weiten Gegenden Ost- und Mitteleuropas einen Zündstoff, der sich jederzeit entladen kann. Was auf dem Balkan, in Rußland und Österreich geschehen ist und in nächster Zeit geschehen wird, ist großenteils das Machtgebot unbeteiligter, abseits wohnender Kreise, welches ihren allgemein weltpolitischen Be- [101] strebungen, nicht dem gerechten Abwägen natürlicher bodenständiger Ansprüche entspringt. Man wird kaum annehmen, daß die Völker, welche bisher durch eine gemeinsame Obrigkeit in Schranken gehalten wurden und jetzt mit ihren abweichenden Wünschen aufeinanderprallen, in der kommenden Lösung einen endgültigen Vergleich erblicken. Erst müßte doch bei diesen Völkern selbst das Gefühl erwachen, daß bestimmte Regeln ihrem natürlichen gegenseitigen Kräfteverhältnisse, den beiderseitigen Interessen und der Billigkeit Rechnung tragen. Stimmt schon der Vergleich der heutigen Lage mit der nach dem Wiener Kongreß und deutsch-französischen Kriege übertriebene Friedenshoffnungen herab, so wird der Historiker noch mißtrauischer, wenn er in die früheren Jahrhunderte hinaufsteigt und die ganze neuere Geschichte ins Auge faßt. Innerhalb der letzteren ist der Abschluß einer Kriegsepoche nach nur sieben Jahren, wie er Deutschland 1871 beschieden war, eine vereinzelte Ausnahme. Bismarck hatte es verstanden, geschickt Mäßigung mit Vorsichtsmaßregeln zu verbinden, die Gesamtlage zu berücksichtigen, die von seinen Kriegen ausgegangenen Erschütterungen örtlich zu begrenzen. Die von ihm 1866 bekämpften Staaten zogen Nutzen aus seiner deutschen Lösung und fanden letztere für ihre eigenen Bedürfnisse unentbehrlich. Ebenso wurden die neutralen Großmächte durch die preußischen Siege in ihren Entwicklungsbedingungen wenig gestört, teilweise sogar gefördert. Diese günstigen Voraussetzungen fehlten allen anderen Krisen der neueren mittel- und westeuropäischen Geschichte. Deshalb haben sie alle mehrere Jahrzehnte gedauert und sich entweder, wie im Dreißigjährigen Kriege, zu einer Gruppe ununterbrochener Kämpfe oder, wie in den Zeiten Maximilians I., Karls V., Ludwigs XIV., Friedrichs des Großen und der Französischen Revolution, zu einer Reihe schnell aufeinander gefolgter Entladungen geführt. Diese immer wiederkehrende Erscheinung ist kein Zufall. Zur dauerhaften Beendigung eines blutigen Ringens genügt bei den verwickelten mittel- und westeuropäischen Machtverhältnissen seit der Reformation eben nicht, daß ein Teil sich als besiegt erklärt und den Friedensbedingungen des Gegners unterwirft. Eine längere Ruhe tritt erst ein, wenn die abweichenden Interessen der unmittelbaren Kriegsteilnehmer wie der nicht uninteressierten Zuschauer [102] einen gewissen Ausgleich gefunden haben, wenn die Rechtsbeziehungen, Kräfteverhältnisse und Machtbedürfnisse der europäischen Staatengesellschaft wieder in einigermaßen natürlichen Einklang gebracht worden sind. Ranke hat in den Großen Mächten vom "Genius" gesprochen, "der Europa noch immer vor der Herrschaft jeder einseitigen und gewaltsamen Richtung beschützt, jedem Druck von der einen Seite noch immer Widerstand von der anderen entgegengesetzt und bei einer Verbindung der Gesamtheit, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt enger und enger geworden, die allgemeine Freiheit und Sonderung glücklich gerettet hat". Diese Aufgabe vermochte der "Genius" aber niemals in einem einzigen Anlaufe und regelmäßig erst nach einer größeren Frist zu erfüllen. Der einzelne Krieg hängt von zu vielen Glücks- und Zwischenfällen ab, hinterläßt neben endgültigen Ergebnissen zu viele Halbheiten und Zufallsentscheidungen, als daß sein Ausgang für einen inappellabelen Gerichtshof angesehen werden kann. So bedurften zum wirklichen Abschlusse einer Krise die Erfolge des Siegers in der neueren Geschichte immer der Bestätigung oder Abschwächung. Läßt sich nun nach solchen geschichtlichen Erfahrungen eher erwarten, daß sich nach dem jetzigen Weltkrieg die einzelne Ausnahme von 1871 wiederholt oder die allgemeine Regel bestätigt und wir noch nicht am Ende der Kämpfe stehen? Jedenfalls treffen die Ursachen, warum die Krisis der deutschen Reichsgründung nur innerhalb sieben Jahren sich abspielte, heute nicht zu. Vielleicht daß ganz andere Anstöße die gleiche Wirkung wie Bismarcks Friedensschlüsse ausüben können – starke Wahrscheinlichkeiten sprechen aber für die Erneuerung der bis 1871 ausnahmslosen Regel. Wir stehen nirgends an erloschenen Kratern, sondern an Vulkanen, die in sich eine starke Eruptionskraft bergen und bald eine neue Tätigkeit entfalten werden. Man wird sehen, ob die Mächte, welche sich ihr entgegenstemmen wollen, dazu stark genug sind oder selbst in Mitleidenschaft geraten. Die Verhältnisse sind überall durchaus unfertig, neue Elemente ringen nach Einfluß und drängen danach sich zu messen und die Welt nach ihren Wünschen zu gestalten. Von einem natürlichen Gleichgewicht zwischen den sittlichen und materiellen Kräften, zwischen Recht und Macht ist noch lange nicht die Rede. [103] Noch eine andere Erwägung mahnt die Historiker, die 1914 begonnene Krisis nicht als abgeschlossen zu betrachten. Wir haben gesehen: die Kriege Karls V., der Dreißigjährige Krieg, die Kämpfe Ludwigs XIV., die drei schlesischen Kriege, die Schlachten der Französischen Revolution und Napoleons, die Kriege Bismarcks sind einheitliche Handlungen. Der Augsburger Religionsfriede (1555) nebst dem spanisch-französischen Frieden von Château-Cambrésis (1559), der Westfälische und Pyrenäische Friede (1648 und 1660), die Frieden von Utrecht und Rastatt (1713 und 1714), der Friede von Hubertusburg (1763), der Wiener Kongreß (1815), der Frankfurter Friede (1871) sind die großen Marksteine der neueren europäischen Geschichte. Sie alle haben mit der einen Ausnahme des Westfälischen und Pyrenäischen Friedens längere Ruhepausen für weite Gegenden unseres Erdteils eingeleitet. Und sie alle tragen ebenfalls mit der einen gleichen Ausnahme ein übereinstimmendes Merkmal: 1559, 1714, 1763, 1815, 1871 waren immer die Franzosen die Geschlagenen. Seit 1494 König Karl VIII. zum ersten Male eine große französische Kontinentalpolitik eröffnete, also seit mehr als vier Jahrhunderten, ist es geradezu ein Naturgesetz der europäischen Geschichte: sobald die Franzosen gesiegt haben, war der Friede niemals ein langer; Voraussetzung seiner Dauer war immer eine französische Niederlage. Die größte Ruhepause nach einem französischen Siege genoß Deutschland 1648–74. Aber auch sie schrumpft erheblich zusammen, weil Frankreich noch bis 1660 mit dem natürlichen Bundesgenossen des Kaisers weiterfocht und diesen Kampf schon 1669 wieder eröffnete. Man darf die längste Friedensdauer nach einem französischen Siege seit den Tagen des Mittelalters auf höchstens ein Jahrzehnt abschätzen. Damit ist natürlich nicht bewiesen, daß der nächste deutsch-französische Krieg spätestens 1929 ausbrechen muß. Immerhin müssen Vorgänge, welche sich seit beinahe einem halben Jahrtausend so regelmäßig wiederholen, zwar nicht eine gleichbleibende, aber doch verwandte Ursachen haben und es ist unsere Pflicht darauf zu achten, ob diese Ursachen abermals wirksam werden können und in welchem Umfange. Sie sind im französischen Nationalcharakter, seinem Einflusse auf die auswärtige Politik dieses Landes und auf das Verhalten der anderen Völker begründet. [104] Der jahrelange Kampf um die deutschen Friedensziele entsprang der Frage, wie weit unsere nationalen Lebensbedürfnisse reichten und ob nicht unter ihrer falschen Ausdehnung die berechtigte Eigenart der fremden Völker übertrieben verkümmert würde. Aber auch die weitgehendsten deutschen Annexionisten haben auf dem Höhepunkte der mittelmächtlichen Erfolge den Gegnern ihren Siegerwillen nur soweit aufzwingen wollen, als es nach ihrer Überzeugung für die dauernde Sicherheit der deutschen Daseinsbedingungen nötig war. Niemand verfolgte den Selbstzweck, den Feinden die deutsche Oberhand möglichst fühlen zu lassen. Die Engländer waren stets brutaler in ihren Ansprüchen und Machtäußerungen, besitzen seit langem ausgedehntere Interessen, welche der Achtung vor fremder Eigenart engere Grenzen stecken, versetzen sich schwerer in Geist und Bedürfnisse anderer Völker. Aber wo nicht Vorteile in Frage kamen, haben vor dem jetzigen Weltkriege wenigstens in Europa die Engländer nicht aus Herrschsucht oder Siegerlaune gehandelt; sie haben 1713 in Utrecht und hundert Jahre später auf dem Wiener Kongreß ihre weiter vorwärtstreibenden Verbündeten zurückgehalten, obgleich beide Male der gemeinsame Gegner am Boden lag. Durch einen englischen Diktatfrieden ist bisher noch keine europäische Großmacht ihrer Stellung beraubt worden, wenn sie nicht auch sonst zum Niedergang bestimmt gewesen wäre. Zwar die Holländer, welche am Mißverhältnis zwischen einem kleinen, von der größten Festlandsmacht bedrohten Mutterlande und gewaltigen Handels- und Kolonialinteressen krankten, wurden durch die englischen Erfolge in ihrem Lebensnerv getroffen. Aber wo ein Staat unabhängig vom Wettstreit wirtschaftlicher und kolonialer Bedürfnisse ein eigenes Daseinsrecht als Großmacht besaß, haben die Engländer bisher immer nur ihre praktischen Ansprüche gedeckt und verbürgt. Sie wußten, daß sie nicht gleichzeitig eine Weltstellung und die Herrschaft über ganz Mittel- und Westeuropa erringen und behaupten können. Deshalb begründeten sie ihre Seegeltung auf dem Gleichgewicht der verschiedenen europäischen Festlandsmächte, ihrer Verbündeten wie ihrer Gegner. Ganz anders haben von jeher die Franzosen gedacht und gehandelt. Als Napoleon den Frieden von Campo [105] Formio abschließen wollte und vom Direktorium unbequeme Weisungen empfing, antwortete er am 10. Oktober 1797: "Die hervorragendste Eigenschaft unseres Volkes ist, daß es zu aufgeregt ist." Er tröstete seine Landsleute damit, daß sie bald auf lange hinaus die große Nation und die Schiedsrichter von Europa sein würden. Diese Schilderung und Zusage beleuchtet den Unterschied deutschen, englischen und französischen Wesens. Das herkömmliche französische Ziel entspringt nicht dem deutschen Bedürfnis nach Ruhe und Selbstschutz, nicht dem englischen Verlangen nach ungestörter Erfüllung von Geschäftsinteressen, sondern der Sehnsucht nach einer Vorzugsstellung, welche dem eigenen Nationalbewußtsein schmeichelt und von den übrigen Kulturvölkern ständig empfunden wird. Jedoch eine Vorherrschaft, welche sich gleichzeitig auf äußere Macht und innere Gefühle gründet, welche gleichzeitig sich praktisch ausdehnen und persönlich imponieren will, bedarf immer neuer Anreize und führt zu immer neuen Ansprüchen. So entstand jene Mißachtung der Besiegten, jene Geringschätzung der Rechtsverhältnisse und unterschriebenen Friedensbedingungen, welche wir bei Ludwig XIV. und Napoleon I. wahrnehmen. Dadurch erwuchsen aber auch aus französischen Siegen immer wieder baldige neue Kämpfe. Die englischen und deutschen Ziele, welche greifbaren Rechten, bestimmten Gebieten galten, konnten ihre Staatsmänner gewiß ebenfalls zu kriegerischen Angriffen verlocken, konnten ihnen durch Verletzung fremder Interessen ebenfalls einen Verteidigungskampf aufnötigen; aber sie ließen sich häufiger friedlich erreichen und gestatteten eher, nach blutigen Zusammenstößen auf dem Boden gegebener Tatsachen weiterzubauen; auch führen sie erst bei veränderten und dann erweiterten Bedürfnissen zur Erhöhung der Ansprüche. Sobald jedoch ein Volk hauptsächlich danach strebt, sich geltend zu machen und überlegen zu zeigen, schweifen seine Ziele nicht nur leicht ins Weite, sondern wechseln auch rasch. Sie wecken die Sorge vor unbekannten oder noch nicht vorhandenen ehrgeizigen Absichten, verschärfen die Gegensätze, weil die Unterlegenen nicht nur die Gewalt spüren, sondern sich auch gekränkt fühlen. Verstand und Empfindungen machen den anderen die Lage unerträglich. [106] Elsaß-Lothringen hat denn auch für Deutsche und Franzosen eine ganz verschiedenartige Bedeutung. Die Sieger von 1870 wollten ihren Machtbereich vom feindlichen dauernd und zuverlässig abgrenzen. Die Reichslande waren ihnen kein Pfand dafür, daß sie nunmehr sich als erste Nation fühlen durften, und ebenso wenig ein Druckmittel gegen die Nachbarn. Bismarck und die damaligen Heerführer wünschten nur, dem französischen, auf Straßburg und Metz gestützten Einfluß in Süddeutschland einen festen Riegel vorzuschieben. Den Franzosen ist es niemals um Land und Leute zu tun gewesen. Ihr Rachegefühl entsprang nicht dem Verluste der Provinzen, sondern des bis 1871 allgemein anerkannten Vorrangs in Europa; es hätte sich, wäre damals Elsaß-Lothringen französisch geblieben, an irgend einen anderen Gegenstand angeknüpft, aber bessere Angriffsmöglichkeiten vorgefunden. Deshalb wäre es ein verhängnisvoller Irrtum, mit der Rückgabe Elsaß-Lothringens die deutsch-französische Rechnung für erledigt zu betrachten. Ludwig XIV. und Napoleon I. haben in der Rheingrenze keine unübersteigbare Mauer, sondern den Schlüssel zum übrigen West- und Süddeutschland erblickt. Denn mit den französischen Vorherrschaftsgelüsten ist ein einheitliches Deutschland, das sich nach selbständigen, nationalen Zielen regiert, unvereinbar. Die Franzosen bedürfen, um als erste Nation Europas zu gelten, eines zerklüfteten Deutschland, das sie, wenn nicht vollständig, doch in einzelnen Teilen beherrschen, oder dem sie wenigstens jederzeit ihre Übermacht fühlbar machen können. Hierzu brauchen sie eine Grenze, welche ihnen ein Vorland vor der eigenen Heimat schafft, die unmittelbare Herrschaft über ein größeres Stück deutschen Kulturgebietes sichert und letzteres zur bequemen Eingangspforte in das übrige Deutschland macht. Dürfen die Deutschen nun des gewiß sein, daß die Franzosen künftig die Bahnen ihrer Vorfahren verlassen werden? Die Möglichkeit dazu ist natürlich angesichts der schweren französischen Kriegsverluste und der veränderten sozialen Verhältnisse nicht ganz ausgeschlossen. Anderseits sehen wir auch heute wieder starke Strömungen im feindlichen Lager lebendig werden, welche sich durchaus im alten französischen Fahrwasser bewegen. Hieran würden auch gemäßigte Friedens- [107] bedingungen nichts ändern. Denn in den Rahmen französischer Überlieferung würde es durchaus hineinpassen, daß die jetzt besetzten links- und rechtsrheinischen Bezirke auch dann nicht freiwillig geräumt würden, wenn der kommende Friede den französischen Erwerb auf Elsaß-Lothringen beschränkt. Die übereinstimmenden geschichtlichen Erfahrungen deuten also darauf hin: die Hoffnung auf eine kommende lange Friedenszeit ist sehr gering, ein neuer Krieg voraussichtlich nur eine Frage weniger Jahre. Nun mögen Kaufleute und Nationalökonomen, Offiziere und Techniker aus wichtigen Gründen über die deutschen Zukunftsaussichten anders urteilen und die Nutzanwendung der Vergangenheitslehren auf die jetzigen eigenartigen Verhältnisse bestreiten. Sind aber diese wichtigen Gründe so durchschlagend, um jede Möglichkeit aufzuheben, daß sich die Erfahrungen der gesamten neueren deutschen und europäischen Geschichte wiederholen? Denn nur dann würde unsere Warnung unberechtigt sein. Zunächst läßt sich bei einigen dieser Gründe beweisen, daß sie sich in der Vergangenheit als nichtig gezeigt haben. Sie würden voraussichtlich bei einer neuen Kriegsgefahr abermals versagen. Außer dem Völkerbundsgedanken und demokratischen Anstrich der Staaten hat namentlich auch die jetzt allgemeine Kampfesmüdigkeit und Erschöpfung wenig Aussicht, einen Krieg dauernd zu verhindern. Sie ist nach schweren Zeiten und nach furchtbaren Opfern an Gut und Blut keine nie dagewesene Erscheinung. Ob sie jetzt oder früher stärker war, läßt sich nicht mathematisch sicher bestimmen. In der Vergangenheit ist sie jedenfalls kein unbedingtes Kriegshindernis gewesen. Tatsächlich schlagen solche Gefühlswallungen schnell vollständig um. Es wäre durchaus denkbar, daß, falls in irgendeinem Lande die Not allgemein, der Druck unerträglich würde und ein einigermaßen aussichtsreicher Krieg Linderung erhoffen ließe, gerade die Massen trotz aller gegenwärtigen Kriegserlebnisse einen nochmaligen Kampf als geringeres Übel ansehen und erzwingen würden. Mithin bleiben als wirklich bedeutsame Gründe gegen einen baldigen neuen Krieg und gegen die Wiederholung der geschichtlichen Erfahrungen nur die sogenannten technischen Unmöglichkeiten übrig. So weisen besonders Offiziere darauf [108] hin, daß sich auf viele Jahre hinaus ein Kampf nicht vorbereiten lasse und daß frühere Beispiele, wie das von 1813, wegen der jetzt viel schwierigeren Beschaffung der Kriegsmaterialien nicht gelten können. Aber gerade in den letzten 5 Jahren ist viel geschehen, was Sachverständige früher für ausgeschlossen gehalten haben. Noch Ende Juli 1914 haben mir angesehene Nationalökonomen versichert, bei den heutigen verwickelten Wirtschaftsverhältnissen sei ein Krieg größeren Stiles überhaupt nicht oder nur kurze Zeit denkbar. Ebenso hat aus militärischen Gründen ein Fachmann wie Schlieffen einen langen Krieg für unmöglich erklärt. Mit welcher mathematischen Sicherheit ist nicht von englischer und französischer Seite unsere Kapitulation infolge der Blockade oder des Munitionsmangels, von deutscher Seite die englische Aushungerung durch die Unterseeboote erwartet worden! Der menschliche Erfindungsgeist und die Willensenergie eines kampfentschlossenen Volkes sind zu vielem bisher für unausführbar Gehaltenen fähig. Für Schwierigkeiten, welche jetzt unüberwindlich scheinen, kann sich schnell eine überraschend einfache Lösung herausstellen. Der Historiker wird also ohne weiteres zugeben, daß die technischen Voraussetzungen eines neuen Krieges alle geschichtliche Erfahrungen, die für einen baldigen neuen Kampf sprechen, umstoßen können; aber er wird bezweifeln, ob das so naturnotwendig geschehen muß, wie das viele jetzt wünschen oder glauben.
|