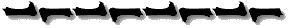|
Wie man mit verwundeten, kranken, sterbenden und toten deutschen Soldaten umging Ton und Behandlung der französischen Ärzte und Pfleger den doppelt wehrlos gewordenen deutschen Soldaten, den Verwundeten und Kranken gegenüber, sind uns schon aus einigen Erlebnisberichten vertraut geworden. Völker unterster Kulturstufen quälen ihre körperlich kampfunfähig gewordenen Feinde nicht weiter, nur dem "kultivierten" Frankreich blieb es vorbehalten, in dieser Hinsicht sich unter die Wilden zu stellen. Es gab auch darüber grauenhafte Berichte. Der Gießener Universitätsprofessor Dr. M. H. Göring, Rittmeister d. L. und selbst ehemaliger Kriegsgefangener in Frankreich, gab in seinem Buche Über die Behandlung verwundeter und kranker deutscher Gefangener in Frankreich aus über hundert französischen Lazaretten eine Blütenlese solcher "humanen" Fälle, gesammelt bei deutschen Offizieren und Sanitätsoffizieren. Der ehemalige Regimentsarzt Dr. August Gallinger aus München stellte in seinem Buche Gegenrechnung eine reiche Auswahl Erlebnisse deutscher Offiziere und [205] Mannschaften, aber auch von Franzosen selbst zusammen. Weitere Berichte brachten die Denkschriften Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland. Amtliches Material. Frankreich und Frankreich und das Kriegsrecht. Schandtaten an der Front, wie auch andere Veröffentlichungen des Reiches; ebenfalls die Gutachten des Geheimrats Prof. Dr. Meurer, Würzburg. Und natürlich waren die Erlebnisbücher der Kriegsgefangenen selbst voll von Anklagen gegen das französische Sanitätswesen. In manchen dieser Bücher wurde in dem Bestreben, gerecht zu bleiben, hervorgehoben, daß es auch gewissenhafte Ärzte, Pfleger und Schwestern, wie saubere, ordnungsmäßig geführte Lazarette in Frankreich gegeben hat. Ich verzichte darauf, das hier besonders herauszustreichen, war es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und daß diese Ausnahmen von den streng gerecht urteilenden deutschen Wissenschaftlern und Soldaten so hervorgehoben wurden, war nur ein Beweis dafür, daß es mit der Regel schlimm ausgesehen hat. Man kann aus dem erwähnten Buche von Dr. M. H. Göring den Schluß ziehen, daß über zwei Fünftel der französischen Lazarette nicht oder nur zum Teil geklagt wurde, dafür wogen die Klagen über rohe und brutale, ja bestialische Behandlung in den anderen um so schwerer. Aus der Denkschrift Frankreich und das Kriegsrecht. Schandtaten an der Front: (Anl. 120): Bericht des Soldaten Reinhold Kalisch: "Die Behandlung durch die Krankenschwester in [206] Lyon war nicht gerade schlecht zu nennen, doch ging sie wenig rücksichtsvoll mit den Verwundeten um. Es kam vor, daß sie die Verbände vierzehn Tage lang auf den Wunden ließ. Ich selbst hatte mir den Rücken aufgerieben, ohne daß ich eine Gummiunterlage oder den Rücken eingerieben bekam, trotzdem ich darum gebeten hatte. Bei der Operation wurden mir nur die Granatsplitter aus dem rechten Oberschenkel entfernt. Der Arzt erklärte ausdrücklich, und zwar mir gegenüber, daß seine Aufgabe nicht darin bestände, mich zu heilen, sondern nur zu verhüten, daß ich sterbe, da dann der französische Staat bezahlen müsse. Das sagte er in gebrochenem Deutsch..." (Anl. 123): Bericht des Leutnants d. R. Carl Kunze: "Ich wurde nach der Gefangennahme von einem französischen Offizier ohne jede Ursache mit dem Revolver durch beide Beine und durch den Kopf geschossen (folgt Schilderung des Vorfalls). Nachdem ich mich mit Hilfe von deutschen Soldaten durch ein Dorf geschleppt hatte, wurde ich auf Anweisung des französischen Arztes zum Negerverbandplatz gebracht. Hier habe ich stundenlang im Freien gelegen. Inzwischen war es Nacht geworden. Die Tragbahre, auf der ich lag, wurde zwischen die beiden Räder eines Karrens gehängt und bis zum nächsten Verbandplatz gefahren. Dort stand Bahre an Bahre, meist mit Negern darauf. Dann wurde ich mit obengenanntem Karren bis zu einem Krankenautohalteplatz befördert. Dort wurde ich mit fünf Negern zusammen in [207] ein Auto verladen. Es war geradezu eine Höllenfahrt. Erstens fuhr der Chauffeur wie ein Wilder auf der von schweren Wagen und Granaten durchfurchten Straße, so daß einem schon als gesunder Mensch die Knochen im Leibe wehgetan hätten, geschweige denn als Verwundeten, zweitens brüllten die verwundeten Neger jedesmal wie wilde Tiere bei dem Stauchen des Autos, so daß einem Sehen und Hören verging. Ich wurde in einem niedrigen Wellblechbarackenlazarett, in dem nur deutsche Verwundete lagen, abgeladen. Hier bot sich mir ein trauriger Anblick. Die meisten Verwundeten lagen schon tagelang mit ihren Notverbänden, über und über mit Blut bedeckt. Zu essen hatten sie überhaupt noch nichts bekommen, zu trinken gab man ihnen, ebenso wie mir, trübes übelriechendes Wasser. Ich kam dann mit andern Verwundeten in das nächste Barackenlazarett. Dort legte man mir neue Verbände an. Wie das Essen dort war, weiß ich nicht, da ich wegen meines Kopfschusses nichts essen konnte und so erschöpft war, daß ich meistens geschlafen habe. Tags darauf kam ich mit einem Krankenauto nach Amiens ins Lazarett Hotel Dieu. Hier mußte ich eine Stunde nach meiner Einlieferung, durch zwei deutsche Soldaten gestützt, zwei bis drei Treppen heruntergehen, um geröntgt zu werden. Nachdem dies geschehen war, wurde ich auch nicht getragen, sondern mußte laufen. Im Lazarett war ein französischer Arzt, der sich in der gemeinsten Weise benahm. Er freute sich riesig, wenn ein Verwun- [208] deter beim Verbinden schrie und sagte dann: 'Haben Sie Schmerzen? Ich habe keine!' oder er sagte 'Das schadet Ihnen nichts, das ist die Strafe dafür, daß mir die Deutschen in Lille meine Wohnung ausgeräumt haben.' Gleich am ersten Tage wollte er mir eine Kugel aus dem Bein mit einer großen Schere herausschneiden. Ich tat, als fühlte ich nichts. Er setzte ab und ging zynisch lächelnd zum nächsten Bett. Das Essen, das man uns dort vorsetzte, war schlecht und ungenügend. Zu dem zähen Fleisch wurde nicht einmal ein Messer geliefert. Als eines Nachts deutsche Flieger über Amiens gewesen waren, beschimpfte uns der obengenannte Arzt als feige Mörderbande und meinte, in einigen Tagen würden die Franzosen ja in Deutschland sein, und dann würde dort auch keine Rücksicht auf Frauen und Kinder genommen werden; man könnte auch eventuell mit Petroleum etwas nachhelfen. Einige Monate später erzählte mir ein Kamerad in einem Gefangenenlager, daß in demselben Lazarett die deutschen Verwundeten bei einem Fliegerangriff auf Amiens drei Tage lang nichts zu essen bekommen haben. Das Lazarettpersonal hier war natürlich von der gemeinen Gesinnung des Arztes angesteckt worden. Eines Tages brauchte ich das Bettklosett; der Wärter brachte es mir nicht und meinte, ich solle es mir selber holen. Es blieb mir weiter nichts übrig, als mich von einem Bett zum andern zu ziehen und es mir zu holen. Ein deutscher Oberarzt, der aus dem Lazarett Coutance kam, erzählte uns später im [209] Gefangenenlager, daß er gesehen habe, wie die Franzosen ganze Reihen von Betten mit deutschen Verwundeten derartig narkotisiert hätten, daß viele nicht mehr aufwachten. Er sagte: 'Ich muß es als Arzt beurteilen können, ob so starke Narkosen nötig waren.' Aus allem geht hervor, daß die Franzosen ihre Gefangenen planmäßig kaputtmachen wollten..." (Anl. 136): Bericht des Füsiliers Emil Hesse: "Am 23. Oktober kam ich weiter nach Poitiers, wo ich im Hospital 18 vierhundert Tage blieb und deutsche Verwundete pflegen mußte. In diesem Hospital hatten die Verwundeten viel unter Hunger und Kälte zu leiden, besonders dann, wenn die Franzosen an der Front eine Schlappe erhielten. Besonders schlecht war es im Jahre 1917, wo hier mehrere Kameraden an Hunger gestorben sind, die nur eine geringe Verwundung und gar kein Fieber hatten. So freuten sich die Verwundeten, wenn sie schnell geheilt waren und ins Lager kommen konnten. Der Chefarzt benahm sich am gemeinsten gegen uns und redete uns nur mit 'boche' und 'cochon' an; er behandelte die Verwundeten ganz gemein. So wollte er eine Zeitlang weiter nichts als Beine und Hände amputieren und machte es den Verwundeten vor, daß es nicht anders ginge. Ich und einige andere haben die Verwundeten jedoch überredet, sie sollten sich das nicht gefallen lassen, worüber uns der Chefarzt besonders böse war. Die Verwundeten wurden dann auch ohne Amputation gut geheilt. Aber trotzdem wurden vielen Ver- [210] wundeten die Gliedmaßen abgenommen, damit möglichst viel als Krüppel nach Hause kämen. Der Chefarzt hatte seine Freude daran, die Verwundeten im Verbandzimmer ordentlich zu quälen, wühlte in den Wunden herum, bis die Leute vor Schmerz umfielen, benutzte öfter dasselbe Instrument, ohne es zu säubern, für mehrere Verwundete. Bemerken möchte ich noch, daß die Franzosen wirklich in dem Wahne lebten, daß die Deutschen den Frauen und Kindern die Hände abhacken und sich diese dann braten." (Anl. 3): Bericht des Fliegers Walter Ellinger: "Ich lag im Lazarett in Chalons. Am 12. September 1914 stürzten französische Kolonialtruppen in unseren Lazarettsaal und schossen ohne Grund auf uns. Ich erhielt hierbei einen Infanterieschuß in den Leib und zwei Kameraden wurden erschossen. Zivilbevölkerung, die anfangs öfter in unser Lazarett kam, zeigte sich sehr feindselig gegen uns. Sie schlug mit Stöcken und Schirmen nach uns." (Anl. 40): Bericht des Vizefeldwebels Franz Rediker: "Die Unterbringung im Fort in Blaye-Gironde und die Verwundetenpflege spotteten jeder Beschreibung. In den alten Steinbaracken des von Vauban gegen die Engländer erbauten Feste lagen wir auf feuchtem Zementboden. Jeder erhielt ein kleines Bündel Binsenstroh als Bett. Dies reichte nicht einmal für den Rücken aus, die Beine lagen auf dem feuchten, kalten Boden. Wochenlang hatten wir nur einen Teller und einen Löffel zum Essen für die 20 Mann, die nur auf der Seite liegend [211] in dem Raume Platz finden konnten. Decken gab es erst nach drei Monaten, kurz vor Weihnachten. Nach sechs Wochen erhielt ich erst ein Hemd. Das schlimmste war die fehlende ärztliche Behandlung. Über drei Wochen wurden wir nicht verbunden, so daß Maden in den Wunden auftraten. Erst als mehrere Verwundete gestorben waren, kümmerte man sich um uns. Vorher mußten wir uns selbst helfen, so gut es ging. Ein leichtverwundeter Feldwebel und ein Unteroffizier waren des Nachts in das Hospital eingebrochen und hatten dort einige Verbandmittel beschafft. Mit diesem wurden vor allem die Leute mit den Bauchschüssen und weitklaffenden Wunden notdürftig des Nachts verbunden. Der Eitergeruch war unbeschreiblich. Dazu wurde des Nachts ein Petroleumkübel als Abort in den Raum gestellt. Fast alle bekamen wir die Ruhr. Erst als der Wundstarrkrampf immer stärkere Formen annahm, etwa 30 Mann bereits gestorben waren, kamen Ärzte aus Bordeaux. Einer von diesen Ärzten zeichnete sich durch sein gemeines Gebahren vor allen anderen aus. Den Verwundeten, die er verbinden sollte, schnitt er die Knöpfe von Rock und Kragen. Als er einem Unteroffizier das Bein verband, tat er so, als ob er ihm das Bein abnehmen wolle. Bei mir steckte er seinen ganzen Zeigefinger in die Schulterwunde, drehte und krümmte ihn und fragte, ob das weh täte. Als ich verneinte, wiederholte er dasselbe noch mehrere Male und wurde äußerst wütend, als er mir nicht das Geständnis des Schmerzes herauspressen konnte. [212] Mitte Januar 1916 kam ich in die Nähe von Rochefort in ein Arbeitslager. Um die Gesinnung des dortigen Kommandanten zu kennzeichnen, werden zwei seiner Äußerungen genügen. Als ihm eine Beschwerde über das mangelhafte Essen vorgebracht wurde, sagte er: 'Es genügt, wenn die Boches nur noch ganz wenig atmen können, wenn sie wieder über die Grenze kommen. Jedenfalls werde ich dafür sorgen, daß sie später weder geistig noch körperlich zu irgend etwas zu gebrauchen sind.' Als eine neutrale Kommission das schlechte Brot bemängelte und feststellte, daß es für die menschlichen Mägen unbrauchbar sei, sagte er, er behaupte auch gar nicht, daß es für Menschen genießbar sei, für Schweine wäre es jedenfalls noch gut genug, und die Boches ständen weit unter den Schweinen." (Anl. 7): Unteroffizier Karl Kuhlen: "Im Lazarett in Rochefort traf ich wieder mit Kameraden, die mit mir gefangengenommen waren, zusammen. Sie erzählten mir, sie seien, als ich von ihnen getrennt war, von französischen Soldaten wieder in den Stollen zurückgeschleppt und dort von ihnen in widernatürlicher Weise geschlechtlich gebraucht worden, und zwar durch Einführung des Geschlechtsteils in den Anus." (Anl. 73): Feldunterarzt Claus: "Während meines Aufenthaltes im Hospital in Rochefort ist mir noch aufgefallen, daß uns niemals, trotz mehrerer Bitten, gestattet wurde, an der Beerdigung verstorbener deutscher Kameraden teilzunehmen. Ich war daher [2123] in bezug auf die Würdigkeit dieser Beerdigungen sehr mißtrauisch, kann etwas Bestimmtes darüber nicht angeben. Ich habe nur einmal gesehen, wie die Leiche eines Deutschen auf einer Tragbahre, nur mit einer Decke bedeckt, in der Dämmerung aus dem Hospital in die Stadt getragen wurde." (Anl. 115): Oberleutnant d. R. Heinrich Heyder: "Spitalbehandlung in Le Puy: Die Untersuchung meines durch einen Schuß gespaltenen Ohres durch den französischen Arzt bestand darin, daß derselbe einmal heftig an der einen herabhängenden Ohrfläche zerrte. Trotzdem ich schon mehrere Tage im Spital gewesen war, war das äußere Ohr immer noch nicht genäht. Auf meine Bitte, es doch zusammenzunähen, geschah nichts. Dann heftete es die Schwester mit Heftpflaster zusammen. Eine Untersuchung des inneren Ohres fand aber erst nach vier Wochen statt. Das Ohr ist jetzt taub." Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland. Amtliches Material. Frankreich: "Lager Auch: Lagerarzt ist bei Gründung des Lagers Dr. Tissot. Er hat seine ärztlichen Pflichten gröblich vernachlässigt. Im November 1916 versucht er die Vorstellung der Ordonnanzen vor die Schweizer Ärztekommission zu verhindern. Im Januar 1917 hat er einen Offizier mit Gehirnerschütterung überhaupt nicht besucht. Im Februar 1917 abberufen, wird er nach einem Monat wieder eingesetzt. Malariakranke besucht er erst nach zwei bis drei Tagen, wenn das Fieber gesunken ist, und [214] läßt sie dann bestrafen, weil sie vom Appell fortgeblieben sind. Lager Aulnat. Auf Leutnant Jauberts Veranlassung, der bei der ärztlichen Untersuchung der Kranken meistens zugegen ist, werden selbst Fieberkranke vom Arzt nicht anerkannt, sondern mit 15 bis 30 Tagen Arrest bestraft, der nach getaner Arbeit und oft ohne Brot verbüßt werden muß. In Sarliève nimmt dieser Arzt die Untersuchung flüchtig am Automobil vor oder, wenn er nicht anwesend ist, Leutnant Jaubert selbst. Lager Caen. Die ärztliche Behandlung liegt in den Händen eines Arztes, der die Leute roh und ohne jedes Interesse behandelt. Die eigentliche ärztliche Untersuchung nimmt der Adjutant Quesneville beim Appell vor. Es darf sich dem Arzt nur vorstellen, wem er es erlaubt. Leute, die der Arzt zu leichter Arbeit geschrieben hat, treibt er in die Kohlen oder zum Säcketragen, häufig mit Schlägen und Fußtritten. Zahnkranke werden nur gefragt, ob sie noch essen können. Im Revier Lefebre sind für 450 Mann nur vier Betten, im Bahnhofslager für 250 Mann nur zwei Betten. Lager Dinan. Die ärztliche Behandlung liegt in den ersten Monaten in den Händen eines französischen Arztes, der sich um Kranke und Verwundete oft wochenlang nicht kümmert. Seine Visite besteht gewöhnlich darin, daß er mit zwei aus Elsaß-Lothringen stammenden Zivilgefangenen, die er als Krankenpfleger bestellt hat, ein bis zwei Stunden plaudert, Zigaretten raucht und dann [215] wieder geht. Als etwa 115 Leicht- und Schwerverwundete, die aus der Marneschlacht kommen, im Lazarett untergebracht werden, treten Zustände ein, die jeder Beschreibung spotten. Nur ein geringer Teil kann in der eigentlichen Infirmerie unterkommen, die übrigen liegen in den Mannschaftsstuben herum, auf losem Stroh ohne Decken in ihren zerrissenen, beschmutzten, blutigen Uniformen. Die Kriegsgefangenen dürfen den Kameraden nicht helfen, auch die deutschen Sanitäter werden daran gehindert. Es fehlt an Verbandzeug. Die Kriegs- und Zivilgefangenen sammeln 80 Francs unter sich, damit etwas angeschafft werden soll davon, doch das Geld wird von dem Kommandanten mit dem Bemerken zurückgewiesen, die Zumutung, daß die Gefangenen Verbandzeug kaufen wollten, sei eine Beleidigung der französischen Republik. Der französische Pfarrer bringt darauf Verbandzeug und Öl zum Massieren unter der Soutane versteckt ins Lager. Es treten 58 Todesfälle ein, größtenteils am Starrkrampf. Die vom Starrkrampf Befallenen werden in einer Bodenkammer ohne Nahrung und Pflege eingeschlossen. Amputierte und Beinkranke müssen sich selber Krücken beschaffen. Auch hier hilft heimlich der französische Pfarrer. Der erste Besuch eines Schweizer Arztes im Winter 1914, der u. a. feststellt, daß der Lagerarzt einen Schwerverwundeten mit Bauchschuß seit drei Monaten nicht gesehen hat, bringt einige Verbesserungen. Bei den Akten der Infirmerie in Dinan befindet sich ein Schriftstück, in dem der [216] Lagerarzt sich gegen solche unangemeldeten Besuche verwahrt, die ihre "Bochophilie" hinter der Maske der Neutralität verbergen. Lager Roanne. Der den Revierdienst versehende Arzt ist grob und launisch. Statt sich um die Kranken zu kümmern, politisiert und schimpft er. Während der Stürme auf Verdun droht er, falls die Festung falle, alle Kranken aus der Krankenstube herauszuwerfen. Sie könnten dann sehen, wie es ihnen gehe. Lager Rouen. Medecin-major I. cl. Dr. Pellerin verfährt in der nachlässigsten und rücksichtslosesten Weise bei der Untersuchung. Die weitgehendste Ausnützung der Arbeitskraft der Gefangenen ist für ihn der leitende Gesichtspunkt. Fieberkranke, Leute mit offenen Geschwüren und Arbeitsverletzungen werden ohne Untersuchung zur Arbeit geschickt. Lager Villegusien. Kriegsgefangener Bähr stirbt im Dezember 1916 an Nierenwassersucht, nachdem er mehrere Male vergeblich versucht hat, sich krank zu melden. Lohmann, Ldw.-Inf.-Regt. 40, meldet sich wegen eines Fußleidens krank und wird mit 30 Tagen Arrest bestraft. Trotzdem ihn der Arzt krank schreibt, muß er seine Strafe absitzen. Stäbler, Jäger-Bataillon 14, verwundet an Auge, Lunge und Arm, wird wegen "unbegründeter Krankmeldung" bestraft. Er soll mit dem 40-Pfund-Sandsack marschieren und weigert sich, nachdem er es versucht, weil er dazu nicht imstande sei. Nach dreimaliger Aufforderung wird er zu zehn [217] Jahren Zwangsarbeit wegen Gehorsamsverweigerung bestraft. Der Gefreite Krantz wird bei einem Ausbruchsversuch vom Dach heruntergeschossen. Der Wachtoffizier schlägt den Verwundeten mit dem Gewehrkolben und tritt ihn mit Füßen, worauf Krantz ohne ärztliche Behandlung an Händen und Füßen gefesselt in die Zelle geworfen wird. Die französische Note behauptete, er sei weder verwundet, noch geschlagen, noch gefesselt gewesen. Korsika. Aussage Börner: "Ein französischer Arzt mit Namen Marcantoni sollte die Kranken behandeln. Dieser Arzt war ein Barbar im wahrsten Sinne des Wortes. Kranke mit 40 Grad Fieber ließ er durch die kalte Winterluft zu sich in die Wohnung tragen, da er zu faul war, sie aufzusuchen. Es kam vor, daß er solche Kranken als Simulanten einsperren ließ. Den beiden gefangenen deutschen Ärzten Dr. Brausewetter und Dr. Heller verbot er unter Androhung von Kerker, ihre erkrankten Landsleute zu behandeln." Dr. Brausewetter vermerkt in seinem Tagebuch unter dem 10. Dezember 1914: "Ziesing tot. 20 Jahre. Dysenterie. Ich sage dem Kommandanten, daß der Arzt ihn nie besuchte. Der antwortet, er habe keine Macht über den Arzt. 13. Dezember 1914: Marcantoni ordnet an, daß die Schwerkranken ins Gefängnis kommen, weil sie nicht zur Konsulte heruntergekommen waren. Ich laufe ins Büro in toller Wut. Heute großes Theater. Die Totkranken werden zum Arzt getragen. Ave morituri te salutant. 20. Dezember 1914: Krankheit und Tod fordern weitere Opfer. Pfleiderer gestern [218] nach unten gekommen, heute gestorben. Fordere Diät, verweigert. Kein deutscher Arzt durfte zu ihm, was soll werden? Unterernährung. Dysenterie grassiert. Marcantoni besucht keinen." Aussage Dr. Heller: "Der französische Arzt Dr. Marcantoni war ein direkter Verbrecher, der Schwerkranke einsperren ließ, weil sie nicht arbeiten wollten." Marokko. Der schwerste Schaden für die in Marokko befindlichen Kriegsgefangenen ist durch die mangelnde Sorgfalt des Sanitätsdienstes entstanden. Im französischen Sanitätsdienst herrschte die Auffassung, daß Marokko ein gesundheitlich günstiges Land sei, daß sich außerdem alle Gefangenen außerhalb der Sumpfgebiete befänden. Diesem Optimismus sind viele deutsche Soldaten, die an Malaria erkrankten, zum Opfer gefallen. Am Schwarzwasserfieber Erkrankte wurden in einem schlecht gefederten Krankenwagen den 20 Kilometer langen Weg nach Casablanca im Trab gefahren, auch wenn der Urin noch dunkel mit Blut vermischt war. Die Folge dieses rücksichtslosen Transports war stets eine Verschlimmerung der Krankheit, in vielen Fällen sogar der Tod. Aus Tunis kam der Notschrei eines deutschen Gefangenen: "Wir sterben hier mit der Zeit noch alle am Fieber." Das Sanitätsjournal des deutschen Sanitätsgefreiten Grohmann zeigt die hohen Fiebertemperaturen und die vielen Todesfälle unter den Gefangenen. Militärgefängnis Avignon. Die ärztliche Fürsorge [219] ist unzureichend. Vergünstigungen, die der Arzt befohlen hat, werden obendrein vom Kommandanten wieder entzogen. Wer als krank befunden wird, bekommt Hungerdiät.
 Lazarette: Das Ansehen, welches die französische Chirurgie in Friedenszeiten in deutschen Gelehrtenkreisen genoß, wurde aufs tiefste erschüttert durch die Erfahrungen, welche mit den aus französischer Gefangenschaft zurückkehrenden Deutschen gemacht wurden. Es kann unmöglich für diese chirurgischen Mißerfolge und Schädigungen die Hast der Kriegsversorgung verantwortlich gemacht werden. Auch dafür bestanden schon in Friedenszeiten gewisse Regeln, denen leicht zu folgen gewesen wäre, wenn der ernste Wille und die genügende Vorbereitung dahinter gestanden hätten. Das Prinzip der modernen Kriegschirurgie bestand vor allem für Extremitätenschüsse in der Anlegung eines sauberen Verbandes, guter Schienung und Ruhigstellung der Wunde und vor allem in gewissenhafter Nachbehandlung nach konservativer Methode. Welchen Eindruck mußte es auf alle Beteiligten machen, als beim ersten Gefangenenaustausch aus französischen Gefangenenlagern 82 Prozent Amputierte und aus deutschen Lagern nur 48 Prozent Amputierte zurückkehrten. Die Rückkehr der verstümmelten Deutschen bot einen geradezu erschütternden Anblick. Sie waren in den verschiedensten Stadien der Verletzung amputiert worden, eine große Anzahl primär am ersten oder zweiten Tage nach der Verwundung. Auf Befragen [220] gab von diesen eine ganze Reihe an, daß sie, ohne vorher über ihre Einwilligung befragt oder über die Schwere des Eingriffs verständigt worden zu sein, ohne daß sie selbst ihre Verletzung für aussichtslos hielten, das Glied noch warm und nicht abgestorben war, Finger oder Zehen noch bewegt werden konnten, auf den Operationstisch gelegt wurden und mit der Verstümmelung erwachten. Man hatte den Eindruck, als ob grundsätzlich jeder Versuch unterblieben war, die Extremität zu erhalten. Wenn nach den Worten des großen Chirurgen Volkmann jede Amputation eine Bankerotterklärung unserer ärztlichen Kunst darstellt, dann hat sich die französische Chirurgie bei der Behandlung der Gefangenen recht oft frühzeitig bankerott erklärt. Als Beleg hierfür dienen die Aussagen einiger persönlich darüber vernommenen Amputierten. Vizewachtmeister Rosner, Drag.-Regt. 8, sagt aus: "Ich wurde am 26. September 1914 durch Querschläger am rechten Arm verwundet und am 29. September gefangen nach St. Menehould in ein Lazarett gebracht; am 30. September wurde ich amputiert, ohne vorher gefragt oder irgendwie aufgeklärt worden zu sein. Ich hatte bis dahin weder Fieber, noch war von einer Infektion der Wunde das geringste zu bemerken. Ich bin fest überzeugt, daß mein Bein erhalten worden wäre, wenn deutsche Ärzte mich behandelt hätten. Daß ich nach der Amputation eine schwere Infektion bekam und noch einmal über dem Knie amputiert werden mußte, führe ich nur auf die unsaubere Arbeit des französischen Arztes [221] zurück, denn ich wurde vor der Operation nicht einmal meiner vom Schützengraben her verschmutzten Uniform entledigt." Leutnant Melcher, Inf. -Regt. 57: "Ich wurde am 25. Oktober 1917 am linken Oberarm schwer verwundet, der Knochen war zertrümmert, der Blutverlust jedoch unbedeutend. Die Finger konnte ich zum Teil noch gut bewegen, Gefühl war noch vollkommen vorhanden. Ich hatte die Hoffnung, daß mir der Arm erhalten werden könne. Am gleichen Tage nach Viercy abtransportiert, bat ich dort, mir den Arm zu erhalten; ich wurde aber, ohne davon vorher verständigt zu sein, exartikuliert. Meine Einwilligung hätte ich nicht gegeben." Unteroffizier W. Halmer, Inf.-Regt. III, sagt aus: "Am 23. Oktober 1917 vormittags wurde ich am rechten Oberarm verwundet und kam zwei Stunden später in Gefangenschaft. Der Schuß hatte die Muskeln, aber nicht die Knochen verletzt. Die Finger waren beweglich und warm, das Gefühl vollkommen erhalten. Am 24. Oktober, abends acht Uhr, wurde ich auf den Operationstisch gelegt, ohne daß man mir vorher ein Wort gesagt oder meine Einwilligung zu einer Operation eingeholt hätte. Nur in der Narkose hörte ich das Wort: Operation. Als ich erwachte, war mein rechter Arm amputiert. Ich habe stets starke Hoffnungen gehabt, daß er erhalten werden könne." Unteroffizier E. Röhm, Ers. Inf.-Regt. 67: "Ich wurde am rechten Oberarm verwundet und gleich darauf gefangengenommen. Der französische Arzt, [222] der mich zuerst untersuchte, meinte, daß der Arm sicher erhalten werden könne. In einem anderen Lazarett wurde mir, aber trotz meiner Weigerung, der Arm amputiert. Die Finger waren noch beweglich gewesen, das Fieber, das am ersten Tag bestanden hatte, sank am zweiten Tage zur Norm." Musketier H. Wendling, Inf.-Regt. 41: "Ich kam am 25. Juli 1915 unverwundet in Gefangenschaft. Nach zweijähriger Dauer derselben wurde ich am 22. Juni 1917 nachts, in der zweiten Etage des Gefangenenlagers, durch Gewehrschuß verwundet. Der Schuß kam aus der Wachstube, die unter uns zu ebener Erde lag, und ging durch beide Fußböden und durch den Strohsack in meinen rechten Arm. Ich hatte ganz entschieden den Eindruck, daß mein Glied erhalten bleiben könne, denn ich konnte die Finger noch gut bewegen. Ohne aber um meine Einwilligung gefragt worden zu sein, wurde ich am 24. Juni amputiert." Nach Aussagen von zurückgekehrten Gefangenen, wurden im Hôspital Lycée Marceau in Chartres im Winter 1914/15 von einem Dr. Kaplan nahezu alle Extremitätenverletzten amputiert und von ihnen sind die meisten gestorben. Nahezu alle Amputierte kamen ohne reguläre Krücken an, die meisten mußten getragen werden, viele hatten sich notdürftig aus Besenstielen und kleinen Querhölzern Krücken hergestellt. Im Gegensatz hierzu wurden aus deutschen Lagern ausnahmslos alle Amputierten mit einfachen, aber tragfähigen Krücken entlassen. Eine ungewöhnlich große Zahl von Schußfrakturen [223] kam mit Knochenfisteln zurück, die durch ihre oft jahrelange Eiterung die Kräfte erschöpft hatten... Mit ganz geringen Ausnahmen war mit den zahlreichen Nervenverletzten gar nichts geschehen. Der größte Teil der Kieferverletzten kehrte ohne Prothese zurück. Die Leute befanden sich in einem meist außerordentlich elenden Zustande, da ihre Ernährung nur durch Flüssigkeiten und Brei unterhalten werden konnte, weil das Kauen vollständig versagte. Dagegen trugen alle aus deutschen Lagern entlassene Gefangene Gleitschienen, intermeditäre Prothesen oder völlige Ersatzstücke, und bei nur ganz wenigen hatte die orthopädische oder operative Behandlung noch zu keinem Ziele geführt. Die große Zahl der nichtoperierten Empyme war in einem derartigen Zustande, daß sie ohne Zweifel dem baldigen Tode verfallen war; nur ein einziger Fall eines deutschen Offiziers kam mit einem guten Resultat der Ausheilung zurück. Während ein großer Teil der Mißerfolge bei den aus der Gefangenschaft zurückgekehrten deutschen Verwundeten auf die angewandte oder die unterbliebene Methode zurückzuführen ist, trägt zu einem andern Teil die mangelhafte Nachbehandlung, wie sie fast durchweg in den französischen Gefangenenlagern geherrscht hat, die Schuld. Die Angaben der Leute decken sich in jeder Beziehung und zu allen Zeiten der Kriegsdauer, daß die kurative Behandlung der Wunden eine äußerst oberflächliche war. Die Kranken bekamen oft wochenlang keinen Arzt zu sehen, oder der Arzt ging alle paar Tage über die [224] Abteilung, ohne die Wunden zu besichtigen. Meist waren sie völlig ungeübten oder unsauberen Händen überlassen, oder den Verletzten wurde von Zeit zu Zeit ein Stück Watte auf das Bett geworfen, womit sie selber den Verband erneuern sollten. So kam es, daß Sekundärinfektionen hinzutraten, die Eiterungen unterhielten, die längst hätten abgelaufen sein sollen. Das kam besonders zum Vorschein in den Internierungslagern der Schweiz, wo die Ärzte mit der allergrößten Sorgfalt arbeiteten, um noch zu retten, was zu retten war. In vielen Fällen kam eine schnelle Wendung, nach der die Wunden der Heilung entgegengingen. Wie leicht wäre alles dies zu vermeiden gewesen, wenn das rechte Verantwortungsgefühl vorhanden gewesen wäre, das jede ärztliche Tätigkeit, auch dem Feinde gegenüber, leiten soll. Hospital Lisieux: Das Hospital Lisieux war untergebracht in zwei Fabrikgebäuden. Die Unterbringung läßt sehr zu wünschen übrig, die Heizung ist völlig ungenügend. Im Winter sind die Wände so feucht, daß sich Schimmel und Pilze ansetzen. Das Essen wird den Bettlägerigen durch Gesichts- und Hautkranke gebracht. Diese müssen auch die Wäsche ihrer Kameraden waschen. Ein Saal ist für die Lungenkranken bestimmt, wird aber regelmäßig auch mit Rheumatikern belegt. Die Urintöpfe stehen oft den ganzen Tag im Raum, ohne entleert zu werden. Die Holzdielen haben breite Ritzen, aus denen ein dumpfer, muffiger Geruch aufsteigt. So haben die Lungenkranken ständig unter der schlechten [225] Luft zu leiden. Desinfiziert wird der Lungenkrankenraum in acht Monaten nur einmal. Die Schwindsüchtigen erhalten dieselbe Nahrung wie die anderen. Der Auswurf der Lungenkranken wird in der Waschküche in eine Rinne geschüttet und schwimmt von dort in dem offenen Rinnstein durch den Hof, der als Bewegungsraum für die anderen Gefangenen dient. Als eine Schweizer Reisekommission angekündigt wird, erscheint vorher eine französische Kommission, die veranlaßt, daß die Rheumatiker von den Lungenkranken getrennt werden, aber kaum haben die Schweizer Ärzte das Lager verlassen, werden Tuberkulöse und Nichttuberkulöse wieder zusammengelegt. Neutralen Besuchern gegenüber wird also nur der Schein gewahrt. Das Wohl der kranken Kriegsgefangenen ist Nebensache. Das kommt sogar in den Erlassen des französischen Kriegsministeriums zum Ausdruck, wo darauf hingewiesen wird, daß bei Besuchen neutraler Kommissionen Vorbereitungen getroffen werden sollen, damit sie einen günstigen Eindruck bekommen und der französische Sanitätsdienst nicht in Mißkredit komme. Über die Behandlung der Kranken durch das Personal des Hospitals Lisieux liegt eine Reihe ernster Klagen vor. Die Arrestzellen werden fast niemals leer, da die Gefangenen bei der geringsten Kleinigkeit bestraft werden. Jeder Grund ist dazu recht, um sie zu bestrafen. (Folgen Beispiele, ferner Beispiele von Mißhandlungen.) Rouen – Hospital Mixte. Geklagt wird über das [226] rohe und gehässige Verhalten einer Krankenschwester, namens St. Pierre, die im Saal 17 des Hospitals tätig gewesen ist. Sie hat sich Mißhandlungen und Brutalitäten den deutschen Verwundeten gegenüber zuschulden kommen lassen. Leutnant der Reserve Späthe berichtet darüber folgendes: "Während ich schwerkrank daniederlag, kam die Schwester jeden Morgen mit der Zeitung an mein Bett und las mir in prahlerischer Weise von den großen französischen Siegen vor. Manche Ohrfeige habe ich von der Schwester bezogen, und ich wurde täglich von ihr und den Wärtern beschimpft. Die Behandlung der Wunden von seiten der Schwester war die denkbar unsauberste. Sie benutzte dieselben Instrumente ungereinigt bei allen Verwundeten." Ein genaues Bild von dem Verhalten dieser Krankenschwester hat man sich in Deutschland erst im Jahre 1917 machen können, als mit dem Schwerverwundetenaustausch eine Anzahl Kriegsgefangener zurückkam, die dieser Peinigerin in die Hände gefallen waren. Wenn die Schwester St. Pierre dem schwerverwundeten Soldaten Otto Lux (sein rechtes Bein ist ganz, das linke unterhalb des Knies amputiert) den Verband entfernen sollte, so weichte sie die Gaze nicht auf, sondern riß sie mit zwei Pinzetten mit einem Ruck ab. Als Lux bei dieser Quälerei einmal stärker aufschrie, schlug sie ihm mit einem Handtuch mehrere Male derb ins Gesicht. St. Yrieix. In St. Yrieix haben von September 1914 bis März 1915 etwa 1800 verwundete deutsche Kriegsgefangene gelegen, unter Verhältnissen, die [227] allen Vorschriften des Völkerrechts und aller Menschlichkeit Hohn sprechen. Die leeren Räume einer Infanteriekaserne wurden ihnen zur Verfügung gestellt, in denen weder Betten noch Strohsäcke vorhanden waren. Es wurde nur loses Stroh geliefert, auf dem die Verwundeten, darunter zum Beispiel mindestens dreißig mit komplizierten Knochenbrüchen, sozusagen auf dem blanken Steinfliesenboden liegen müssen. Die ärztliche Leitung liegt in den Händen eines Arztes, der sich nicht im geringsten um die Patienten bekümmert, außer um die Elsässer und Polen. Die Wunden der eingebrachten Gefangenen sind infolge der nachlässigen Behandlung alle infiziert, viele sogar schwer infiziert. Erst nach zwei bis drei Wochen, nachdem die Kantinenpächterin Kisten für Schienen überlassen hat, können die Knochenbrüche geschient werden. Material zu Gipsverbänden wird nicht geliefert. Für eine Station von 150 Mann werden täglich ausgegeben: zwei Pakete weiße Watte, zwei Pakete gelbe Polsterwatte (zu je ein Kilogramm), ein Paketchen Gaze, fünf Binden. Zum Desinfizieren gibt es nur Calium permanganatum und Creosol. Vaseline und Salben sind erst nach wochenlangem Drängen der deutschen Ärzte zu haben. Dabei ist der Empfang aller dieser Sachen äußerst unregelmäßig. Wochenlang gibt es überhaupt keine Watte, Gaze, Binden, Drains, Thermometer usw. Um dem furchtbaren Mangel an Verbandzeug abzuhelfen, zertrennen die deutschen Krankenschwestern, die im Lazarett sind, ihre Hemden und machen Binden daraus, die [228] immer und immer wieder gewaschen und benutzt werden müssen. Öfters sehen sich die deutschen Ärzte gezwungen, den Verband bei Sterbenden sitzen zu lassen, um für diejenigen zu sparen, die Aussicht haben, gesund zu werden. Die Verbände, die nur alle fünf bis sechs Tage, manchmal auch vierzehn Tage erneuert werden können, wimmeln nur so von Maden. An Instrumenten ist vorhanden: Eine alte Säge, ein Amputationsmesser, zwei verrostete Nadeln, eine anatomische, eine chirurgische Pinzette und vier Peans. Hammer und Meißel, wie sie die Bildhauer gebrauchen, müssen in der Kantine von den deutschen Ärzten gekauft werden. Für die massenhaften ruhrartigen Durchfälle wird lediglich Opium zur Verfügung gestellt, besondere Diät gibt es nicht. Nur durch Ankauf von Reis, Haferflocken usw. durch die deutschen Ärzte, kann dem Mangel an Krankenkost in bescheidenem Maße abgeholfen werden. Bei solchen Verhältnissen hat der Tod natürlich schon fürchterlich unter den Gefangenen gewütet. Über 30 Verwundete gehen allein am Wundstarrkrampf zugrunde, da Tetanusserum nicht zur Verfügung steht. Ruhr und Typhus grassieren in weitem Umfange und natürlich tritt bei den ungünstigen Verhältnissen in St. Yrieix auch die Wundrose in vielen Fällen auf. Der Tiefstand der allgemeinen Hygiene ist geradezu erschreckend. Es gibt weder Eimer noch Stechbecken oder sonstiges Material für die Verwundeten, trotzdem 300 bis 400 von ihnen ihr Lager nicht verlassen können. Diese müssen [229] zur Erledigung ihrer Bedürfnisse ihre Stiefel nehmen oder entleeren ihren Kot im Zimmer oder auf dem Flur. Verwundete mit Beinschüssen kriechen auf allen Vieren nach draußen, um die Latrinen dort, die vor Schmutz starren, benutzen zu können. Irgendeine Bade- oder Brausegelegenheit haben die Gefangenen nicht. Wohl befindet sich in einem Pavillon neben der Kaserne eine vollständige Brauseeinrichtung, aber die Benutzung wird vom Kommandanten streng verboten. Auch Waschgelegenheit für Hemden, Strümpfe ist nicht vorhanden, Seife wird nicht geliefert, warmes Wasser ist nur unter den größten Schwierigkeiten zu erlangen. Da außerdem in der ersten Zeit den Gefangenen überhaupt keine Wäsche geliefert wird, nimmt die Läuseplage entsetzlich zu, auch Krätze verbreitet sich. Brennmaterial wird nur sehr wenig ausgegeben, das Essen ist ganz außerordentlich schlecht. Es gibt morgens nicht einmal einen ganzen Trinkbecher voll Kaffee, mittags und abends meist eine Brotsuppe. Fleisch wird kaum ausgegeben. Enthält die Suppe irgendwelche Fleischstücke, wie Lunge, Leber, Gefäße, so sind sie größtenteils ungenießbar. Kennzeichnend für die Art der Zubereitung ist es, daß die Gefangenen zum Beispiel ein Darmstück mit halbverdautem grünem Kot, Tieraugen, eine Maus in der Suppe fanden. Der Reis ist nicht gesäubert und schwärzlich wie ein Linsengericht, auch werden Maden in ihm gefunden. Erst als deutsche Gefangene die Küche übernehmen, verbessert sich die Zubereitung, aber die Menge der gelieferten Nahrung bleibt noch [230] ungenügend. Die Verwundeten sind oft so vom Hunger gepeinigt, daß sie in den Abfalleimern Nahrung unter den von den Franzosen weggeworfenen Überresten suchen. Ein Teil der zahlreichen Todesfälle in St. Yrieix ist auf die Unterernährung zurückzuführen. Daß bei all den geschilderten Mißständen der Mangel an Vorbereitung nicht als Entschuldigungsgrund gelten kann, geht daraus hervor, daß innerhalb eines halben Jahres von den deutschen Ärzten keine Besserung erreicht werden kann. Beschwerden werden bestraft." Der Kommandant, der sich für die in dem letzten Bericht geschilderte Engelmacherei an deutschen Soldaten vor seinem Gewissen zu verantworten hatte – denn vor einem französischen Gericht wird er es nie nötig haben – hieß Coubère; die Stadt St. Yrieix liegt nicht etwa dicht am vormaligen Kampfgebiet, sondern weit hinten in friedlich, freundlicher Gegend, zwischen Limoges und Brive. Aus dem Buche Über die Behandlung verwundeter und kranker deutscher Gefangener in Frankreich von Dr. jur. et. med. M. H. Göring: Feldlazarette bei Chaulnes: "Mitte Oktober 1916. Die Unterbringung im zweiten Feldlazarett war unsauber, die Verpflegung zu knapp. Die Ärzte waren roh. Leutnant I., der einen schweren Kieferschuß hatte, wurde ohne Narkose operiert. Feldlazarett 18: In diesem Lazarett ereignete sich folgendes: Drei Soldaten mit hohem Fieber lagen mit Leutnant I. in einem Raum. Der eine hatte einen Bauchstreif- [231] schuß, der andere einen nicht besonders schweren Kopfschuß, dem dritten war ein Fuß amputiert worden. Als sie etwa acht Tage im Lazarett waren, bekamen sie an zwei oder drei verschiedenen Tagen je eine Einspritzung in den Oberschenkel, ungefähr um 4 oder 5 Uhr. Alle drei starben am Tage der Einspritzung, abends zwischen acht und neun Uhr. Die Einspritzung erfolgte mit einer Spritze, die sicher viele Kubikzentimeter faßte; der Kolben der Spritze ging hin und her wie der Kolben einer Lokomotive." Reims, Kathedrale: Eine große Anzahl Verwundeter war in der Kathedrale eingesperrt. Die Eingänge waren von Posten besetzt, die auf jeden schossen, der heraus wollte. Mehrere Verwundete wurden auf diese Weise ohne Grund getötet. Als die Kathedrale zu brennen begann, schrie das Volk, man solle die "Boches" verbrennen lassen. Dem Eingreifen eines französischen Pfarrers ist es zu verdanken, daß die deutschen Verwundeten nicht umkamen. Er ging an ihrer Spitze zu einer Seitentür hinaus und forderte die auf Posten stehenden französischen Soldaten auf, erst auf ihn, dann auf die Deutschen zu schießen. Es ist einwandfrei festgestellt worden, daß französische Geschütze gleich hinter der Kathedrale standen, obwohl vom Turm die Rote-Kreuz-Flagge wehte. Amiens. Gemischtes Hospital. (Hôtel Dieu.) Die Ärzte waren nicht unfähig, benahmen sich aber skandalös. Als Leutnant H. am 25. September, morgens 8 Uhr, in den Operationssaal gebracht wurde, [232] empfing ihn der Arzt mit unglaublichem Gelächter. Er wurde auf den Operationstisch mehr geworfen als gelegt. Der Arzt griff in die handtellergroße Oberschenkelwunde und schmiß Lt. H. lachend Knochensplitter ins Gesicht. "Dieses deutsche Schwein wird später einmal einen schönen Exerziermarsch machen können!" rief er dabei. In dem Raum, in dem Hauptmann G. lag, starb ein Feldwebelleutnant, an der Leiche sagte der Arzt: "Dieses Schwein ist tot, hoffen wir, daß es nicht das letzte ist." Im Operationssaal sagte er bei einer Hodenoperation: "Das ist die beste Operation für die deutschen Schweine!" Dabei hielt er die abgeschnittenen Hoden hoch unter dem Gelächter der Wärter und Schwestern. Bei Leutnant Mi. wurden große Einschnitte in den linken Oberarm und die Brust gemacht, ohne irgendwelche Betäubung; als Grund für diese Behandlungsweise gab der Arzt an, Leutnant Mi. sei freiwillig für den deutschen Kronprinzen in den Krieg gegangen, jetzt solle er dafür büßen. Die Bestrafungen waren äußerst hart. Leutnant S. wurde aus folgendem Grund bestraft: Dr. Coudron hatte ihn Schwein genannt und mit "tu" angeredet, daraufhin fragte Leutnant S.: "Hast Du das zu mir gesagt?", worauf Dr. Coudron anordnete, daß er sofort in eine Arrestzelle der Zitadelle verbracht wurde, obwohl die Wunde noch eiterte. Erst nach fünf Tagen kam ein Infirmier zum Verbinden, er war freundlich und kam jeden zweiten Tag wieder. Er wollte Leutnant S. in das Hospital zurückverlegen, der weigerte sich aber, da er den Beleidigungen des [233] Dr. Coudron sich nicht wieder aussetzen wollte. Erst als nach acht Tagen hohes Fieber eintrat und ein hinzugezogener Arzt die Überführung ins Lazarett anordnete, kam Leutnant S. in das gemischte Hospital zurück, aber nicht zu Dr. Coudron auf den zweiten Stock, sondern auf den ersten; dieses hatte der Arzt, der ihn auf der Zitadelle besucht hatte, durchgesetzt. Es wurde sofort eine Operation durch den Chefarzt vorgenommen, aber ohne jede Betäubung, trotzdem der Eingriff sehr schmerzhaft war; auf Vorhalt erklärte der Chefarzt, daß er bei Lappalien nicht anästhesiere. Als Leutnant S. sich nach der Operation beim Chefarzt bedankte, erwiderte dieser, das sei überflüssig, er tue, was ihm befohlen sei, von einem deutschen Soldaten wolle er keinen Dank; die Deutschen seien der Abschaum der Menschheit. In demselben Lazarett wurde ein deutscher Soldat, der wegen eines Kopfschusses nicht zurechnungsfähig war, von Infirmiers aus dem Bette gerissen, mit Fäusten geschlagen und, weil er schrie und sich wehrte, mit Ketten ans Bett gefesselt. Belle Isle, Militärhospital. Dem Leutnant T. war ein teures Medikament verschrieben worden, das er aber selbst bezahlen sollte. Als kurz darauf ein Paket für ihn ankam mit Zigarren, erklärte der Chefarzt Dr. Gilbert, er würde ihm das Medikament gratis geben, wenn er ihm die Zigarren dafür schenken wolle. Leutnant T. bot ihm daraufhin eine Kiste von 50 Stück einfacher Qualität an, doch [234] der Chefarzt meinte, er ziehe die andere Kiste, in der 25 Importen waren, vor, und eignete sie sich an. Grenoble, Hilfshospital Knabenlyzeum. Oberleutnant L., der wegen Dysenterie mit 40 Grad Fieber eingeliefert worden war, erhielt während der ersten drei Tage von einem Studenten im zweiten Semester täglich ein Brechmittel mit den Worten, die "boches" äßen alle zu viel. Ein Arzt kam einmal etwa nach drei Wochen, der Pfleger zeigte auf das Bett des Leutnants und sagte, er sei aktiver Offizier, darauf gab der Arzt dem Bett einen Fußtritt und ging weiter. Der Student behandelte auch alle deutschen Soldaten. Beim Verbandswechsel mußten sich die meisten ganz ausziehen, auch wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Dazu kamen dann die weiblichen Wesen des Hospitals, etwa 20, fast regelmäßig. Ein Lungenkranker mußte im Dezember zu einer Untersuchung splitternackt über den Hof laufen; eine französische Schwester warf einen auf der Bahre liegenden deutschen Offizier mit Steinen. Limoges, Hospital Kaserne Jourdan. Die ärztliche Behandlung war gemein. Alle Mannschaften, an deren Aufkommen die Franzosen zweifelten, wurden in einen Pferdestall gelegt, der verschlossen wurde; nach 48 Stunden nahm sich auf den Lärm hin, den ein Soldat an der Tür machte, eine katholische Krankenschwester der Leute an. Das schwerverletzte Auge des Leutnants F. wurde überhaupt nicht behandelt. Pflegerin bei den Offizieren war die Frau eines Kommandanten; ihr Morgengruß war: "Ich verabscheue Sie!" Den Ärzten und an- [235] deren Pflegepersonen gegenüber äußerte sie, wie später eine von ihnen erzählte, sie betrachte es als ein gottgefälliges Werk, wenn möglichst vieler ihrer Pflegebefohlenen umkämen, dann würde Gott ihre Söhne an der Front besser beschützen. Diese Pflegerin gab einem deutschen Leutnant, der einen schweren Lungenschuß hatte, täglich als Gesamtnahrung nur ein viertel Liter Milch mit dem Bemerken, es gäbe nicht mehr und andere Nahrung dürfe er nicht essen. Dem Leutnant D. steckte sie die Drainröhren, die sie auf den Boden hatte fallen lassen, ungereinigt wieder in die Wunden. Bei einem sehr schwer verwundeten Leutnant wechselte sie acht Tage lang nicht den Verband. Als er dann starb, waren seine Wunden über und über mit Maden durchfressen. Für sieben Offiziere besorgte sie erst auf andauerndes Drängen nach einigen Monaten einen Kamm; sie gab ihn zuerst einem Offizier, der eine offene Kopfwunde hatte und an Starrkrampf erkrankt war, was die anderen aber erst nach seinem Tode erfuhren. Rouen, Hotel Dieu. Der Soldat T. wurde mit einem Schulter- und Wadenschuß fieberfrei eingeliefert, ersterer heilte nach 14 Tagen. Bald darauf trat Fieber ein, das zwischen 39 und 40 Grad schwankte; bei flüssiger Kost fiel, bei fester stieg die Temperatur. Ein Arzt erschien zunächst nicht. Eines Sonntags kam der Chefarzt, der den Kranken vorher nie gesehen hatte und erklärte, das Bein müsse abgenommen werden. Dies geschah auch. An der Operationswunde war keine wesentliche Reaktion zu bemerken. Trotzdem wich das Fieber [236] nicht. T. starb; Hauptmann F. fragte die Krankenschwester, ob T. nicht vielleicht Typhus gehabt habe, worauf sie erwiderte, das sei wohl der Fall gewesen. Aus dem Buche Gegenrechnung von Dr. A. Gallinger: Über das Lager Blaye bei Bordeaux berichtet Walter von Ihring, Kaufmann aus Hamburg, an die Chirurgische Klinik in München: "Ankunft etwa 11. September 1914. Zeit der Behandlung Mitte Oktober 1914. Aus dem Unterschied zwischen Ankunft in Blaye und Zeit der sogenannten Behandlung geht hervor, daß eine Wundbehandlung der schweren Verletzung etwa sechs Wochen durch oberflächliche Spülungen fachunkundiger Kameraden stattfand, weil die Ärzte sich damit begnügten, ab und zu in die Zimmer zu kommen, Zigaretten zu rauchen und uns dabei zu verhöhnen. 'Haben Sie Hunger?– Singen Sie Deutschland, Deutschland über alles, dann werden Sie satt!' Zeugenangabe auf Wunsch. Bei der endlich stattfindenden ersten Behandlung, welche auf Drängen eines französischen Korporals stattfand, wurde die Wunde oberflächlich gespült. Der Zustand war vollständige Vereiterung und mehrwöchige Verunreinigung durch Würmer. Wundbehandlung fand im Stehen statt. Zweck der Behandlung waren politische Gespräche. Da ich aus meiner Gesinnung kein Hehl machte und dem Verlangen des Arztes, zu sagen, der Kaiser sei ein Lump, nicht entsprach, stieß mich derselbe mit der in der Wunde befindlichen Spitze des Irrigators in die Wunde, so [237] daß die am Verbandsplatz von deutschen Ärzten angebrachten Nähte platzten und zum Teil durch Fleischteile hindurchgingen. Bei Wiederholung der Stöße brach die Spitze ab." Oberarzt Arthur Krüger, Berlin: "Im Mai 1919 kam ich mit zwei anderen deutschen Ärzten an das Kriegsgefangenenlazarett Fleury sur Aisne, wo etwa 300 innere und chirurgisch Kranke bis zu unserer Ankunft von einem französischen Arzt versorgt waren. Dann erschien auf der Bildfläche noch der Oberarzt Stillmunkes, und damit begann ein trauriges Leben für unsere ernsten Kranken. Wir hatten eine ganze Anzahl schwer an Hungerödem Erkrankter unter uns, auch übrigens ein Zeichen für die 'menschliche' Behandlung der Gefangenen durch das Kulturvolk. Diese Leute waren durchweg bei ihrer Gefangennahme kräftige, gesunde Soldaten gewesen; sie waren im Laufe von wenigen Monaten durch übermäßige Anstrengung bei unerhört schlechter Unterbringung und Hungerverpflegung zu Skeletten abgemagert, mit starken Schwellungen an den Beinen und so großer Schwäche, daß sie kaum noch mühsam einige Schritte zu schleichen vermochten. Besonders erinnere ich mich an einen Mann von etwa dreißig Jahren, der durch die schlechte Behandlung und Verpflegung innerhalb ganz kurzer Zeit zu einem lebenden Skelett geworden war, zu schwach, um sich noch erheben zu können, der sich nicht mehr von einer Seite auf die andere ohne Hilfe legen konnte. Es war nicht möglich, für diesen Unglück- [238] lichen angemessenes Essen zu bekommen. Herr Stillmunkes tat nichts dafür, obwohl es in seiner Macht gelegen hätte. Da wir Deutschen nur wenig für den Unglücklichen tun konnten, starb er langsam den Hungertod. Denn auch in diesem sogenannten Lazarett gab es unter Stillmunkes in der Hauptsache nur Bohnen, die hart und unverdaulich waren und den Kranken mehr schadeten als nützten. Die den Schwerkranken zustehende Milch war derartig verdünnt, daß sie nur noch schwach weißlich gefärbt war, und sie hatte außerdem einen so eklen Geschmack, daß zu ihrem Genuß selbst bei starkem Hunger eine große Überwindung gehörte. Haarsträubend war, daß die große Anzahl von Kranken mit offener Lungentuberkulose mitten unter den anderen Kranken lagen; dabei standen die Krankenbetten eng aneinander. Sie bildeten eine furchtbare Gefahr für ihre anderen Kameraden, die, durch Krankheit und Hunger geschwächt, um so empfänglicher für die Tuberkulose waren. Trotzdem wir wiederholt darum vorstellig wurden, daß diese Lungenkranken von den anderen getrennt werden sollten, wies das Stillmunkes jedesmal ab. Dabei stand eine große Anzahl von Sälen leer. Wir versuchten auch vergeblich, den Austausch dieser Unglücklichen über die Schweiz zu erreichen; vielleicht wäre dem einen oder anderen doch noch zu helfen gewesen. Erst im Juli wurden die am schwersten Erkrankten nach Bar le Duc gebracht, angeblich, um ausgetauscht zu werden. Ein großer Teil von ihnen war aber schon so heruntergekom- [239] men, daß ein Abtransport nach Deutschland nicht gewagt werden konnte, einige von ihnen sind noch bei uns gestorben, drei oder vier ruhen in Bar le Duc. Einer dieser Unglücklichen, der an einer tuberkulösen Gehirnhautentzündung starb, war von dem Unmenschen in dem kalten Winter 1918/19 wochenlang eingesperrt worden, in einem ungeheizten Raum, ohne Bett und Pritsche mit Steinfußboden. Natürlich verließ der arme Mensch nach wochenlanger Qual seinen Kerker nur, um im Lazarett nun seinem sicheren Tode entgegenzugehen; er ruht mit vielen anderen Opfern französischer Rachgier auf dem Friedhof des Lazaretts in Fleury sur Aisne, wenn nicht gallische Vertiertheit ihren hysterischen Zorn auch noch an den Gräbern ihrer Beute ausgetobt hat. Auch damit mußte man rechnen. Konnte doch im August 1919 unwidersprochen in einer französischen Zeitschrift etwa folgendes geschrieben werden über die deutschen Kriegerfriedhöfe in Frankreich, auf denen bekanntlich neben den Deutschen auch viele der Gegner in durchaus würdiger Weise bestattet worden sind: 'Wir wollen den Boches gestatten, den Boden 'de la douce France' zu düngen mit ihren Leichen; sechs Fuß in die Länge und sechs Fuß in die Tiefe sollen ihnen bewilligt sein, nicht aber sechs Fuß in die Höhe!' Also mit anderen Worten, dieser typische Franzose fordert zur Zerstörung der Grabstätten unserer Gefallenen auf. Dieses Schmutzwerk erschien in einer vielgelesenen wissenschaftlichen Zeitschrift, der Presse Médicale, und hatte zum Ver- [240] fasser einen französischen Oberstabsarzt, der übrigens in demselben Artikel zugeben muß, daß die Grabstätten der in Deutschland während des Krieges gestorbenen Franzosen in guter Ordnung sind. Doch zurück zu Herrn Stillmunkes. 'Ah, diese Schweine! Sie stinken wie die Affen!' war eine beliebte Begrüßung unserer Kranken, die unter dieser Art seelischer Therapie nicht wenig litten. Am tollsten aber war es, daß keine Visite vorüberging, in der er nicht den einen oder anderen schlug, wobei er auch vor Schwerkranken nicht halt machte. So schlug er eines Tages einen älteren Mann an den Kopf, der mit schwerer Lungentuberkulose im Bett lag und hohes Fieber hatte, weil er sich nicht schnell genug aufrichtete, wozu er aus Schwäche nicht imstande war..." Professor Dr. Veit, Marburg: "Durchgangslager in Rouen. Am 10. Dezember, mittags, verließen wir vier Sanitätsoffiziere das Lazarett in Vineuil und wurden nach Rouen gebracht. Hier konnten wir zu Hunderten die armen verhungerten Gestalten studieren, wie wir sie als Kranke und Sterbende eingeliefert bekommen hatten. Die armen Jungens konnten sich kaum noch auf den Beinen halten, im Dreck der Küchenabfälle wurde herumgestöbert, um einige Kartoffelschalen oder Rübenschnitzel der französischen Küche herauszusuchen. Es war ein schrecklicher Anblick. Dabei faßten die Franzosen, anscheinend auf Befehl des französischen Oberleutnants, scharf zu und verhinderten solche 'Bereicherungen' der Verpflegung. [241] Ein französischer Offizierstellvertreter, der fließend deutsch sprach (er hatte zwei Jahre in Bonn studiert), klagte uns sein Leid, so etwas mit ansehen zu müssen, er würde aber wohl bald versetzt werden, er sei zu gut zu den Deutschen. Interessant war es, zu beobachten, wie die Franzosen, die aus deutscher Gefangenschaft entlassen waren und sich auf dem Kasernenhof nebenan befanden, sich verhielten. Diese Leute steckten unseren Jungens durch den Zaun Zigaretten und Brotstücke usw. zu, soweit sie irgend konnten. Wollte einer von den Posten dies verhindern, so fuhren sie los: 'So behandelt man keine Gefangene, sie wären in Deutschland streng, aber gerecht behandelt worden. Man hätte sie nicht verhungern lassen.' Es soll in den nächsten Tagen nach unserer Abreise noch zu ganz anderen stürmischen Auftritten der französischen Heimkehrer zugunsten der verhungerten Deutschen gekommen sein, wie uns Offiziere erzählten, die nach uns das Lager Rouen passierten. Wer solche Mannschaftslager mit eigenen Augen gesehen hat, kann sich nur wundern, daß überhaupt noch Deutsche lebend aus der französischen Gefangenschaft herausgekommen sind... Ich habe Frankreich hassen und verachten gelernt!"
 Über "die Zivilisation in den Lazaretten" schrieb der freiwillige Oberkrankenpfleger Dr. Levides Pericles, Dozent an der Universität Athen, das folgende: "Es war zu Kriegsbeginn. Täglich wuchs der Strom der edlen Opfer ihrer hingebenden Pflicht an [242] das Vaterland, niemand hatte das Recht, untätig zu bleiben, jeder mußte herbeieilen, um, soweit es in seinen Mitteln stand, derartige Leiden zu mildern. Als Ausländer wohnte ich seit 15 Jahren in Paris; im Augenblick der Kriegserklärung befand ich mich in Trouville und ich eilte, um meine Kräfte dem Lazarett zur Verfügung zu stellen. Ich wurde begeistert empfangen und mit Dank überhäuft. Den Franzosen steht ja in bewunderungswürdiger Weise die Redegabe zur Verfügung, und sie bedienen sich ihrer geradezu künstlerisch, wenn ihre Interessen auf dem Spiele stehen. Mein Aufenthalt in diesem Lazarett war nur von kurzer Dauer. Im folgenden kann man lesen, warum ich mit Zorn und Widerwillen schied. Es war ein deutscher Soldat vom Infanterie-Regiment...., Karl Patz hieß er; er war am rechten Oberschenkel verwundet. Kaum hatte der Unglückliche die Halle des Lazaretts durchschritten, als ein einziges Wort von aller Lippen kam: 'Der Boche, der schmutzige Boche, was bringt man den hierher? Man müßte diese Sau auf der Stelle kalt machen!' So empfing man einen tapferen verwundeten und waffenlosen Soldaten. Der Chefarzt selbst kam herbeigeeilt und ließ den Boche in ein enges Loch ohne Luft und Licht hineinbringen, das sonst als Rumpelkammer diente, und wo sich zufällig ein ungemachtes und unsauberes Bett befand. Dort ließ man den Unglücklichen allein von sechs Uhr abends bis zum folgenden Tage fünf Uhr abends, ohne Nahrung, ohne Pflege, ohne Krankenpfleger [243] und ohne Licht. Jedem war es strengstens verboten, sich dem Unglücklichen zu nähern, und um die Sicherheit noch zu erhöhen, wurde seine Tür mit dem Schlüssel verschlossen. Am folgenden Tage, also gegen fünf Uhr nachmittags, 23 Stunden nach der Ankunft des Verwundeten, betrat der edle und menschliche Chefarzt das Gelaß des Deutschen, wobei ihm wohl an die zehn Neugierige folgten. Er warf schnell einmal einen Blick auf seine Wunde (diese genaue Prüfung dauerte nicht zwei Sekunden) und befahl darauf seinen Untergebenen: 'Geben Sie diesem schmutzigen Ungeheuer zu essen. Morgen lassen Sie ihn in den Operationssaal bringen, der Oberschenkel wird amputiert.' Dieser Befehl ist wörtlich wiedergegeben. Ich war zugegen und mußte schweigen, ich wagte keinen Einwurf zu machen, aber mein Zorn und meine Entrüstung ließen mich zittern. Man brachte also dem unglücklichen deutschen Soldaten einige Stunden später feste Nahrung, und dabei sollte er am nächsten Tage seine schwere Operation überstehen. Er aß, weil er ja nicht wußte, was ihm bevorstand. Ich nahm an der Operation teil. Es war die reinste Schlächterei. Gehen wir mit Stillschweigen darüber hinweg, daß die Operation nicht notwendig war, daß die Wunde gut heilbar war. Der menschenmordende Haß, der die Seele des operierenden Arztes erfüllte, gab sich durch harte Bewegungen kund, durch Verziehen des Gesichtes, durch Beleidigungen, die er dem wehrlosen Opfer entgegenschleuderte. [244] Endlich war das Glied vom Körper gelöst. Der Henkersknecht warf es mit Entsetzen in die Ecke und sagte grinsend: 'Die Hunde werden sich zum Abend ein gutes Mahl aus dem Gliede ihres Bruders machen. Diese Schweinerei ist gar nicht wert, daß man sie erst begräbt.' Ja, das ist eben das Volk, das mit lauter Stimme der Welt hat schreiend verkünden können, daß es an der Spitze der Zivilisation einherschreitet. Nach dieser verbrecherischen Operation wurde der unglückliche Karl Patz in denselben Winkel gebracht, wo er hergekommen war. Man ließ ihn von neuem in vollkommener Einsamkeit ohne Heilmittel, ohne Pflege. Es war elf Uhr morgens. Während des ganzen Nachmittags, der ganzen folgenden Nacht blieb er allein in der Dunkelheit. Kein Krankenpfleger nahte sich ihm oder brachte ihm etwas, dessen er bedurfte. Der Leser wird sich kaum die Folgen einer solchen Grausamkeit vorstellen können. Möge er sich mit Mut wappnen, um das Folgende zu lesen. Am folgenden Tage, acht Uhr morgens, konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich entschloß mich, den Befehl zu durchbrechen, um zu sehen, was aus diesem armen, gepeinigten menschlichen Geschöpfe geworden war. Entsetzlich! Ich fand ihn auf der Erde liegend in einer Pfütze von Blut. In den Zuckungen seines Todeskampfes war er aus dem Bett gefallen. Das Blut hatte Laken und Matratze durchtränkt. Über all dem lag ein betäubender Geruch. Der Amputierte hatte alle feste Nahrung, die [245] man ihm vor der Operation gereicht hatte, wieder von sich gegeben. Karl Patz starb einige Stunden später; er war ermordet worden. Sein Mörder war ein französischer Sanitätsoffizier. Zwei Tage später gab ein anderer deutscher Soldat in unserm Lazarett seinen Geist auf. Er war tödlich verwundet, und als man ihn uns brachte, war er ohne Besinnung. Er erlangte sie auch nicht und so war es nicht möglich, seinen Namen festzustellen. Drei Tage später starb er, und es wurde befohlen, die Leiche in den Keller hinabzutragen und sie bis zur Beerdigung dort zu lassen. Man warf sie auf die Erde in irgendeine Ecke; etwa 24 Stunden später wollte man sie wieder zur Beerdigung heraufholen. Man kann mir vielleicht einwerfen, was ist denn daran so schrecklich? Es folgt. Eine Krankenpflegerin, ebenfalls Ausländerin, eine junge Frau, die den besten Schichten ihres Landes angehörte, holte mich und sagte mir: 'Bitte gehen Sie und sehen Sie sich an, in welchem Zustande sich die Leiche befindet.' – 'Warum?' frage ich. – 'Kommen Sie bitte mit', sagte sie darauf. Sie führte mich zu den sterblichen Überresten des jungen deutschen Soldaten. Ich schaudere zurück. Das Gesicht war unkenntlich. Es waren weder Nase, noch Augen, noch Ohren vorhanden! Entsetzt bat ich eine Krankenpflegerin um Aufklärung, die mit gierigen Augen diesen herzergreifenden Anblick betrachtete. Sie lachte nur roh und antwortete mir: 'Die Ratten des Lazaretts haben heute nacht ein [246] gutes Abendbrot gehabt. Nur schade, daß sie nicht den ganzen Boche gefressen haben. Sie hätten uns dann wenigstens die Mühe erspart, dieses Schwein zu begraben.' Am selben Abend verließ ich das Lazarett, um es nie wieder zu betreten." Dr. Levides Pericles schloß das Vorwort zu seiner Broschüre, in der er diese und noch andere unmenschliche Dinge erzählte, mit den Worten: "Meine Leser werden vor Entsetzen zittern; haben sie diese Schrift zu Ende gelesen, können sie eigentlich nur mit Entrüstung ausrufen:
"Ja, das sind doch die wahren Barbaren!" |