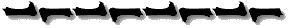|
[176] Korsika, Marokko, Algier, Tunis, Saloniki Im Cri de Paris stand am 15. Februar 1915 zu lesen: "Gut beraten war die hervorragende Persönlichkeit, die die Regierung veranlaßt hat, dreitausend deutsche Gefangene nach der Myrtheninsel Korsika zu verbannen, um die dort so ungesunde Ostküste zu sanieren. Bekanntlich ist das Klima dieser Küste unbedingt totbringend. Zu wiederholten Malen hat die Regierung Kredite bewilligt, um Handwerker an die korsische Ostküste zu senden, aber die Malaria hat immer wieder mit allen aufgeräumt. Hoffen wir, daß die deutschen Kriegsgefangenen zu einem kleinen Teil wenigstens dazu beitragen werden, das Sanierungswerk in Korsika in der Hauptsache durchzuführen." In dem von der französischen Akademie preisgekrönten Werk des französischen Militärarztes Dr. Jaubert heißt es u. a.: "Die notorische Ungesundheit der Ostküste beruht darauf, daß infolge des Mangels an Gefällen der Anschwemmungsboden die Mehrzahl der Wasserläufe, welche die Ebene durchziehen, in Sümpfe verwandelt, während die Berge, die im Westen abschließen, die Wirkung des Ost- und Südostwindes lahmlegen und Gegenwinde erzeugen, welche die Auswirkungen der Ausdünstung des Sumpfbodens fast an Ort und Stelle niederhalten." "Die französische Regierung hat mit vollem Bewußtsein den Tod und die schwere Krankheit zahl- [177] reicher deutscher Kriegsgefangener in Korsika verschuldet", klagte die deutsche Denkschrift Frankreich an. "Der französische Staat hatte schon lange vor dem Kriege, anscheinend im Jahre 1884, das Zuchthaus von Aleria aufheben lassen, weil dieser Landstrich schwere Gefahren für die Gesundheit bot. Noch immer lebt in der ganzen Gegend das Wort: 'Aleria, Aleria, wen du nicht tötest, den machst du zum Invaliden!' In diese Gegend, die durch die französischen Kammerdebatten schon berüchtigt geworden war, sandte man die deutschen Kriegsgefangenen."
 Ich entnehme dem Buche: In französischer Gefangenschaft von R. S. Waldstätter folgende Schilderungen: Bericht des Soldaten Blümel: "...In Marseille wurden wir nach der Insel Korsika eingeschifft. Man schickte uns in den Laderaum hinunter, wo nur ganz wenig Licht und Luft durch eine Luke drang. Aber kaum waren wir in diesem Raum, wurde auch die Luke zugeklappt, so daß wir die ganze Zeit in tiefstem Dunkel saßen. Als wir ausgeladen wurden, waren wir in Bastia auf Korsika. Das Volk umrannte uns scharenweise und wollte die Menschenfresser sehen. Von allen Seiten flogen Schutt, Steine und Flaschen auf uns. Es wurde auch mit Revolvern geschossen, so daß sogar die französische Bewachung in Lebensgefahr kam. Ein Sergeant wurde verwundet... Im Lager von Casabianda wurden wir untergebracht und mußten sofort arbeiten. Die Verpfle- [178] gung war miserabel und die Unterkunft denkbar schlecht. Bei Tage arbeiteten wir in glühender Hitze und des Nachts erstarrten wir fast vor Kälte. Durch das Dach der Baracke konnte man den Sternenhimmel beobachten. Für uns 250 Mann stand nur ein Kübel zum Austreten zur Verfügung. Da wir alle mehr oder weniger krank waren, wurde der Kübel ununterbrochen benutzt. Einmal lief er über, aber wir konnten nicht hinaus, da die Baracke abgeschlossen war. So rann der Inhalt des Kübels auf die Gefangenen hinab, die in der untersten Etage lagen. Die Malariakrankheit nahm von Tag zu Tag zu. Als sie zu stark zugenommen hatte, wurde ein Teil von uns nach dem Lager von Servione überführt. Hier hatten wir einen halbverrückten Waldaufseher... In den Baracken hatten wir keine Waschgelegenheit. Wir wimmelten von Ungeziefer, die Kleidungsstücke waren lebendig wie ein Ameisenhaufen. Damit wir im Schmutz nicht halb zugrunde gingen, besorgten wir uns an der Küche Wasser; denn wenn es gut ging, wurden wir nur alle Woche einmal zu einem Bach zur Reinigung geführt... Später kam ich ins Lager von Calensana, wo es ebenso traurig war. Wir lebten auf einer verlassenen Farm und waren ganz der Gewalt unserer unmenschlichen Bewachung ausgeliefert. Um Kochwasser zu bekommen, gruben wir ein Loch in den Sumpf. Aber was für Wasser war das! Es stank nach Verwesung.... Der Sergeant erhielt das Geld für unsere Verpflegung. Er ging zu einem Schäfer [179] und kaufte eine alte Ziege, die für 25 Mann drei Tage reichen sollte. Am zweiten Tage war das Fleisch grün und am dritten Tage so voll Würmer, daß es sich beinahe von selber vowärtsbewegte. Wir mußten von morgens 4 Uhr ab arbeiten. Besonders tierisch war der Sergeant, wenn Weiber da waren. Dann nutzte er jede Gelegenheit aus, um uns zu mißhandeln. Eine Abteilung von uns wurde nach Liamone abkommandiert, wo eine Brücke über den Sumpf zu bauen war. Dabei holten sich die meisten die Malaria. Ein Mann starb plötzlich. Ein Arzt war nicht da. Unsere Soldaten zimmerten einen Sarg aus Brettern der Pakete, die sie aus der Heimat erhalten hatten und warteten, bis ein französischer Arzt die Krankheit festgestellt hatte. Am nächsten Tag kam ein französischer Adjutant und befahl, dem Toten die Uniform auszuziehen. Die Kameraden taten es nicht, weil es sich nicht gehörte und weil der Leichnam zudem schon in Verwesung übergegangen war. Wie der Franzose weg war, nagelten wir den Sarg zu und trugen ihn nach dem nächsten Friedhof. Als wir dort das Grab schaufelten, kam der Pfarrer und schrie: 'Fort mit dem Boche! Hier wird kein Boche beerdigt!' Nach langem Streit mußten wir den toten Kameraden wieder forttragen und wollten ihn auf einem freien Felde beerdigen. Aber da kam der Farmbesitzer auf einem Esel angeritten und jagte uns mit der Leiche fort. Wir waren in einer verzweifelten Lage. Überall jagten uns die Leute mit dem Toten fort. [180] Länger warten konnten wir nicht mehr, denn die Leiche roch schon stark. Schließlich trugen wir den Toten weit fort nach dem Meeresstrand und dachten daran, ihn ins Meer zu werfen. Am Strand war aber kein Mensch zu sehen, und so schaufelten wir schnell ein Grab und beerdigten den heimatlosen Leichnam. Am folgenden Sonntag zimmerten wir ein Kreuz und schmückten das einsame, weltverlassene Grab. Die Frau des Toten schrieb uns dann später, wir möchten ihr berichten, an was ihr Mann gestorben sei und wo er begraben läge. Das konnten und durften wir aber nicht melden. Um ihr noch einen Trost zu geben, malte einer eine Karte mit dem Meeresgolf und dem einsamen Grab darauf, und das schickten wir der armen Frau hin."
 Es ist lesenswert, dieses Büchlein In französischer Gefangenschaft, das ein Schweizer nach Berichten deutscher Soldaten und des griechischen Arztes Dr. Levides zusammengestellt und ihm einen kurzen Auszug aus dem Völkerrecht vorausgeschickt hat, der wie blutiger Hohn klingt: "Gefangenenbehandlung nach dem Völkerrecht. Die Gefangenschaft ist im heutigen Kriege nur Sicherungshaft mit Schonung des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Gefangenen. Den Kriegsgefangenen verbleibt ihr persönliches Eigentum, mit Ausnahme der Waffen, Pferde und der Schriftstücke militärischen Inhalts. Den Kriegsgefangenen wird in der Ausübung ihrer Religion und in der Teilnahme an Gottesdiensten volle Freiheit gelassen. [181] Für die Errichtung von Testamenten der Kriegsgefangenen gelten dieselben Bestimmungen wie für die Militärpersonen des eigenen Heeres. Dasselbe gilt für die Sterbeurkunden sowie für die Beerdigung der Kriegsgefangenen. Die kranken und verwundeten Soldaten sind durch die Genfer Konvention vom 6. Juli 1906 geschützt. Nach jedem Kampf soll die das Schlachtfeld behauptende Partei die Verwundeten aufsuchen und sie wie die Gefallenen gegen Beraubung und schlechte Behandlung schützen."
 Der amerikanische Sanitätsmajor James Rob. Church hatte bei Gelegenheit der amerikanischen Inspektion einen Bericht über das Bestehen von Malaria auf Korsika vorgelegt, in dessen Schlußfolgerungen es hieß: "Aus den bestehenden Tatsachen habe ich folgende Schlüsse gezogen:
a) daß auf der Insel Korsika Malaria in weitestem Umfange herrscht; b) daß sie sich auf die tiefer gelegenen Striche beschränkt, in der Zeit vom Juni bis November herrscht und im September und Oktober am schlimmsten ist; c) daß die höher gelegenen Stellen des Landes von dieser Krankheit frei sind usw.; d) daß die meisten dieser Malariakranken Leute sind, die aus den Lagern in den Bergen abkommandiert und zur Arbeit nach dem Tiefland geschickt worden sind. [182] Meine Ansicht, die sich auf einen 5½jährigen Tropendienst stützt, währenddessen ich mit dieser Krankheit ständig in Berührung gekommen bin, ist, daß von Leuten, aber besonders nicht an dieses Klima gewöhnten Ausländern, nicht verlangt werden sollte, in der ungünstigsten Jahreszeit dort zu wohnen..."
 Aus den Krankenbüchern der Kriegsgefangenenläger gab der amerikanische Arzt dazu die vielen Malariafälle bekannt. Die deutsche Regierung hat wiederholt und mit allem Nachdruck darauf gedrungen, daß die fiebergefährlichen Lager geräumt würden, was schließlich nach den Angaben der französischen Regierung erreicht wurde, im Sommer 1917 sind dann die Kriegsgefangenen aber trotzdem wieder an der Ostküste zu Arbeiten verwandt worden. Inspektionen von Neutralen bekamen von solchen Kommandos nichts zu erfahren. Liamone: "Die Verbringung deutscher Gefangener nach dem Liamone war ein besonders schweres Verschulden", führte die deutsche Denkschrift aus, "da die Gegend durch ihre ungesunde und fiebergefährliche Lage berüchtigt ist. Die Landbestellung in dieser Gegend erfolgt durch landfremde Arbeiter. Keine Fermen wagen sich in der Ebene anzusiedeln, die Malaria hält die Bevölkerung von dort fern. Für die Zeit von Mai bis Oktober wird der Aufenthalt von Ardouin-Dumazet als geradezu totbringend bezeichnet. Die deutsche Regierung weiß, daß von Anfang des Jahres 1915 bis zum August 1916 dort 150 deut- [183] sche Kriegsgefangene waren. Das Kommando hat in einem Sumpf zur Trockenlegung arbeiten müssen. Die Leute hatten sich geweigert, sind aber trotzdem dazu gezwungen worden. Von den 150 waren 13 ständig krank. Nur alle vierzehn Tage kam ein Arzt... Dazu die schlechte Nahrung... In Porto-Pollo, in der ungesunden Taravo-Niederung, arbeiteten 100 Mann, von denen täglich 15 bis 20 krank waren. Hatten die Leute am Morgen nur 37 Grad Fieber, so mußten sie zur Arbeit gehen, auch wenn sie am Abend vorher 40 Grad gehabt hatten. Wer sich auf den Arbeitsplätzen krank meldete und nicht krank befunden wurde, bekam Arrest; ein auf diese Weise mit Arrest bestrafter Mann brach schon gleich nach der Untersuchung vor Erschöpfung zusammen; er hatte tatsächlich 40 Grad Fieber. Von einer Arbeitsabteilung von 30 Mann waren gleichzeitig 20 Mann mit Fieber und Dysenterie im Hospital. Am 12. Juni 1916 verlangte die deutsche Regierung die Aufhebung der beiden Kommandos. In ihrer Antwort hat die französische Regierung es gewagt, zu bestreiten, daß die Arbeit der Gefangenen auf den beiden Kommandos gesundheitsgefährlich sei, sie bezeichnete den Gesundheitszustand in Porto-Pollo als "sehr gut", und den im Liamone-Kommando sogar als "ausgezeichnet". Auf erneute deutsche Beschwerden gibt sie dann die Antwort, daß die beiden Kommandos geräumt worden seien. Gerade in der fiebergefährlichsten Zeit, vom Mai bis August 1916, hat sie sie aber noch bestehen lassen. [184] Die Zahlen, die für ganz Korsika für die einzelnen Kategorien in Betracht kommen, sind in Deutschland nicht bekannt. Aber die Tatsache, daß ein großer Teil der Gefangenen auf Grund der schweren Fieberinfektionen ihre Gesundheit verloren haben, ist hinreichend klargestellt. Die Transporte des großen Austausches der über 18 Monate Gefangenen zeigten unter den von Korsika Anfang 1918 abtransportierten Leuten zahlreiche Leute mit schwerer Anämie und allgemeiner Entkräftung. Die ständige Antwort nach dem Grunde dieser Erscheinungen war: Malaria."
 Die Denkschrift befaßte sich dann unter anderem auch mit der mangelhaften Organisation der Überfahrt der Kriegsgefangenen von Marseille nach Korsika. "Wir wurden im untersten Laderaum verstaut. Es fehlte uns Licht und Luft und der 'Pelion' war einer der ältesten französischen Kästen, gerade gut genug für die Boches", erzählte Dr. Max Brausewetter in seinem Buche. Mr. Georges Cahen-Salvador stellte in seinem Buche die kühne Behauptung auf, die 5000 deutschen Kriegsgefangenen, die man 1915 nach den nordafrikanischen Kolonien verschickt habe, seien dort "bei guter Verpflegung und Unterkunft" zu Straßen- und Eisenbahnbauarbeiten verwendet worden, und er gab entrüstet die Proteste der deutschen Regierung und der deutschen Presse wieder, die zu Gegenmaßnahmen gegen diese "gute Behandlung" aufforderte. Nun wird dieser Direktor des französi- [185] schen Kriegsgefangenenwesens wohl kaum selbst jemals zur Inspektion der Gefangenenlager in Nordafrika gefahren sein; er wird sich auf die Berichte der Leute verlassen haben, die ein Interesse daran hatten, alles im rosigsten Lichte zu schildern, schon um sich selbst nicht den einträglichen und angenehmen Druckposten zu verderben. Immerhin sollte Cahen-Salvador doch schon die deutsche Denkschrift über die Zustände in seinem afrikanischen Bezirk zu denken gegeben haben. Auch jener bedeutende französische Gelehrte, der in einem offenen Brief an Deutschland schrieb, Tunis, Marokko und Algier seien die Sanatorien Europas, und wenn er deutscher Kriegsgefangener wäre, würde er gerade darum bitten, nach Afrika versetzt zu werden, wird diese Gegend wohl auch nur aus der Perspektive der Sanatorien und Hotels, zum mindesten recht erträglicher Lebensverhältnisse gekannt haben. Es kam schließlich auch hier wieder darauf an, wie und wo man die deutschen Kriegsgefangenen unterbrachte. Die Denkschrift Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland. Amtliches Material. Frankreich berichtete sehr ausführlich über die Läger Algeriens, Tunis und Marokkos, man hörte da wieder die alten, schon fast selbstverständlichen Klagen über die mangelhafte und ekelhafte Ernährung, über die verständnislose Unterbringung, über brutale Behandlung, über die Malariagefahr, über die glühende Hitze im Saharagebiet und in Algier wieder über Kälte im Winter. Genügenden Schutz gab es gegen beides nicht; dazu kam hier noch ein Strafsystem, das wohl den Rekord [186] aufstellt in der sadistischen Quälerei deutscher Soldaten, wie sie in Frankreich zum System gehörte.
 Ich bringe zuerst aus der erwähnten Denkschrift den Wüstenmarsch nach Djellal [Scriptorium merkt an: Algerien] zur Kenntnis, den dreihundert deutsche Kriegsgefangene am 14. Mai 1915 antreten mußten: "Die Gefangenen hatten sich, soweit sie dazu imstande waren, vorsorglich aus eigenen Mitteln verproviantiert. Sie mußten, Fieberkranke und Verwundete ebenso wie Gesunde, außer ihrem Gepäck noch Zelte und Decken tragen. Wer auf dem Marsche zurückblieb, wurde von einem Sergeanten, der von Beruf Maurer war, einer ärztlichen Untersuchung unterzogen und dann nach Belieben zum Weitergehen angetrieben oder auf eins der Kamele gebunden, die das Gepäck der Franzosen trugen. Nach 22 Kilometer Marsch erreichte man die erste Oase. Alles verlangte bei größter Hitze nach Wasser. Die Durstigen wurden aber zuerst im weit auseinanderliegenden Dorf den Arabern als Siegestrophäe vorgeführt. Nur wenige glückliche Besitzer einer Flasche konnten sich hier für den weiteren Marsch in die Wüste hinein mit Wasser versorgen. Auf dem Marsch von Ain-Naga bis Wiribel-Onet (44 Kilometer) wurde keine Wasserstelle angetroffen. Infolge der glühenden Hitze waren viele dem Wahnsinn nahe. Aus einem von Tieren stark verunreinigten Morastgraben haben die Gefangenen dann den Schlamm geschlürft. Die französischen Bajonette waren dagegen machtlos. Alles stürzte gierig in die Jauche, und wenn es den Tod kostete, [187] der hier ja doch nur eine Erlösung war. Stundenweit hinter dieser Kolonne wurden Besinnungslose mit verglasten Augen von den Spahis gesammelt. Diese arabischen Reiter haben sich sehr um unsere ärmsten Kameraden bemüht und ihnen gewürztes Getränk gegeben. Feldwebel Schuppner hatte schon beim Abmarsch von Biskra starke Entzündungen am Fuß, der Eiter quoll ihm beim Marsch heraus. Als er unmöglich mehr weiterkonnte, wurde er auf ein Kamel gepackt, mußte aber nach zwei Stunden schon einem müden Franzosen den Platz frei machen und den ganzen Tag in dem heißen Sand etwa 100 Kilometer ohne Stiefel laufen. Bei Ankunft an der Arbeitsstelle waren nur einige Stunden Zeit, um ein Lager aufzubauen. Schon am folgenden Tage wurde mit dem Straßenbau begonnen." Wie es bei solcher Arbeit zuging, erzählt der Gefreite Elmpt: "Wir kamen in Südalgerien zu dem Arbeitskommando in Koque-Klaba, wo wir an dem Bau einer Eisenbahn arbeiten mußten. Die Arbeitszeit war von morgens 7 Uhr bis mittags um 11, und dann nach anderthalbstündiger Pause wieder bis halb fünf Uhr. Unter der starken Hitze hatten wir sehr zu leiden, insbesondere die schwächeren Kameraden, von denen viele dabei waren. Es war regelmäßig eine Temperatur von 30 bis 40 Grad, manchmal auch mehr. Sehr hart war die Behandlung, die uns von den aufsichtführenden Schwarzen zuteil wurde." [188] Unteroffizier Emmeluth: "Leutnant Aubert hatte stets einen Palmenstock bei sich, mit dem er die Gefangenen bei jeder Gelegenheit prügelte, sogar Kranke mißhandelte. Auch ein französischer Korporal hatte die Gewohnheit des Leutnants angenommen, die Leute ohne Grund mit einem Palmenstock zu bearbeiten. Diese Mißhandlungen fanden auch ihre Fortsetzung, als wir in der Gegend von Kangha-Sidi-Nadj arbeiteten." Soldat Graßl: Da die Kost für die schwere Arbeit gänzlich unzulänglich war, wurde der Lagerführer bei der Regierung diesbezüglich vorstellig. Die Folge davon war, daß er durch einen anderen Offizier ersetzt wurde. Von diesem Zeitpunkt an begannen unsere Leiden. Ohne Rücksicht auf Verwundung oder körperliche Schwäche wurde nunmehr von jedem ein bestimmtes Stück Arbeit täglich verlangt, das unter allen Umständen erledigt werden mußte. Bei besonders schweren Arbeiten, insbesondere bei Durchbruch durch harten Boden, stand der Leutnant, mit Namen Aubert, mit einem Palmenknüppel an der Arbeitsstelle und schlug um sich auf jeden, der sich umsah oder einen Augenblick ausruhen wollte. Nachdem der Lagerführer angefangen hatte zu schlagen, folgten die Unteroffiziere seinem Beispiel. Besonders drangsalierte uns der Adjutant Martien, der dann später Lagerführer wurde."
 Die französische Literatur und Presse hat auf die "kräftigen Sklaven" hingewiesen, die man nach Nordafrika versandte. Der deutsche Kriegsgefangene [189] sollte gedemütigt und der Bevölkerung, der man die französische Kolonialherrschaft aufzwingen wollte, sollte gezeigt werden, daß deutsche Kriegsgefangene in fremder Hand seien. Ein weiterer Beweis waren die unmenschlichen, geradezu mittelalterlichen Strafen. In der Denkschrift: Frankreich und das Kriegsrecht. Schandtaten an der Front berichtete der Reservist Mertens, Infanterie-Regiment 137, unter Eid darüber: "In Algier angekommen, wurden wir wieder in der niederträchtigsten Weise mißhandelt. Man warf nach uns mit allen möglichen Gegenständen, verschiedene erhielten sogar Messerstiche. Die in Algier wohnenden Franzosen hetzten die Eingeborenen auf uns los... Man stellte uns ihnen als 'Barbaren' vor. In Algier kamen wir nach dem Depot Tizi-Ouzou und wurden dort in Baracken untergebracht. Es gab dort weder Eßgeschirr noch Schlafstelle. Unser Essen mußten wir uns in alten Büchsen, die in der Müllgrube herumlagen, holen. Schlafen mußten wir auf dem bloßen Betonboden. Im März 1915 kamen wir nach dem Lager Targa. Dort war alles verwildert und Sumpf. In dem Sumpf mußten wir unser Lager aufschlagen. Auch hier mußten wir auf der bloßen Erde liegen. Wir mußten dort in der glühendsten Hitze die schwersten Arbeiten machen, und zwar hauptsächlich Straßenbau. An einem Arbeitstage mußte jeder Mann vier Kubikmeter, ob es nun lose Erde oder Feld war, ausheben. Wer dies nicht fertigbrachte, [190] bekam es von der Löhnung abgezogen und wurde eingesperrt. Der Kommandant des Lagers, ein geborener Saarbrücker und früherer Fremdenlegionär namens Lehmann, hatte in dem Lager die 'Taboo' -Strafe eingeführt. Diese bestand darin, daß ein einhalb Meter tiefes Loch in die Erde gegraben und eine kleine Zeltbahn darüber gespannt wurde. In dieses Loch wurde dann der mit Arrest bestrafte Mann mit auf dem Rücken gebundenen Händen, Gesicht nach oben hingelegt, so daß er sich nicht bewegen konnte. Es wurde auch immer eine Stelle ausgesucht, wo die Sonne den ganzen Tag mit aller Kraft hinschien. Unter acht Tagen gab es keine Strafe. Ich habe acht Tage lang in dem Loch liegen müssen und mir dabei Malariafieber zugezogen. Fast alle im Lager untergebrachten Gefangenen litten an Malaria. Wir bekamen aber weder Behandlung noch Medikamente, so daß viele sterben mußten, wie z. B. (folgen Namen) und noch einige 50 Mann, auf deren Namen ich mich nicht mehr besinnen kann. Der Lagerkommandant ließ sich morgens alle Leute, die sich krank meldeten, vorführen. Wer nicht 38 oder 40 Grad Fieber hatte, erhielt die Taboostrafe. Ein Arzt war überhaupt nicht vorhanden, sondern bloß ein Apotheker aus Algier, der keine Ahnung hatte. Der Lagerkommandant prügelte die Leute ohne ersichtlichen Anlaß mit dem Bambusstock. [191] Die Verpflegung war außerordentlich schlecht. Immer nur dünne Suppe und schlechtes Brot. Als Eßgeschirr dienten alte Petroleumkübel. Die Kochkessel waren verrostete Karbidkübel. Ich war 18 Monate im Lager Targa und kam dann nach Carpiagne in Frankreich. Dort waren alle an Malaria erkrankt gewesenen Kameraden untergebracht. Man war dort vollständig auf sich selbst angewiesen, es kümmerte sich kein Mensch um uns, so daß selbst die Schwerkranken ohne Aufsicht blieben." Wehrmann Gustav Bühler: "Von Marseille aus kam ich zu Schiff nach Algier, dann nach Aumale und hierauf nach Boghni, dort war das erste Lager. Die Behandlung war sehr schlecht und wir waren ganz auf uns selbst angewiesen. Man nannte uns den Ausschuß der Menschheit, und wir seien dorthin gekommen zum Kaputtmachenlassen. Dieser Anschauung entsprechend war auch unsere ganze Behandlung. Etwa vier oder fünf Monate waren wir in dem Lager Boghni. Hier lagen wir auf der bloßen Erde. Auch die ärztliche Behandlung war äußerst schlecht... Später kam ich nach dem Lager Tigziert. Wir waren hier alle mit der Kleidung schlecht gestellt, manche von uns mußten barfuß, sogar in der Unterhose laufen. Weil es an ärztlicher Hilfe fehlte, wurden viele, die sich krank meldeten, einfach eingesperrt. Der Bestrafte mußte sich selbst ein Loch in die Erde graben und mußte darin seinen Arrest absitzen. [192] Über sich hatte er nur eine Zeltbahn. Wer einen Entflohenen tot oder lebendig wieder zurückbrachte, erhielt 50 Franken Belohnung. Es wurde mir auch erzählt, daß von den Arabern einmal zwei Entflohene umgebracht worden seien. Ich erkrankte einmal an Malaria und bekam regelmäßig jeden zweiten Tag Anfälle, trotzdem mußte ich weiterarbeiten und wurde bei solchen Anfällen einfach in den Straßengraben gelegt, bis der Anfall vorüber war. Dadurch wurde ich derartig geschwächt, daß ich schließlich ins Lazarett geschafft werden mußte." Jäger Paul Schmidt: "Januar 1915 wurden wir in Stärke von etwa 200 Mann über Marseille nach Algier geschafft. Bei dem Marsch durch die Stadt bewarf uns die angesammelte weiße Bevölkerung mit Steinen, Kot und Eisenschrauben, so daß eine Anzahl Kameraden verletzt wurden. Nachdem wir die Nacht im Festungsgefängnis in Algier zugebracht hatten, kamen wir am nächsten Morgen nach Tizi-Ouzou, etwa vier Bahnstunden von Algier, und von da nach Blida. Von dort wurde ich dann im Mai 1915 nach Tigziert an der Meeresküste geschafft. Die Verpflegung war dort sehr schlecht, die Behandlung kann man nur als gemein bezeichnen. Bei den geringsten Anlässen gab es Arreststrafen. Als Arrestzelle diente ein auf dem blanken Boden errichtetes Zelt, das jedoch höchstens einen halben Meter hoch war, so daß man den ganzen Tag in der Gluthitze liegen mußte. Wenn beim Appell die [193] Kranken nicht pünktlich zur Stelle waren, wurden sie vom Sergeanten mit Ruten geschlagen. Am 27. Februar 1916 ereignete sich folgendes: Ein gefangener deutscher Unteroffizier namens Hermanns, wohl von einem mecklenburgischen Infanterie-Regiment, hatte mit einer Anzahl Soldaten Strafexerzieren und sollte in der Mittagshitze bergauf bergab Laufschritt machen. Das verweigerte er gegenüber dem Dolmetscher, einem französischen Soldaten. Dieser versetzte ihm darauf einen Stoß, worauf er von Hermanns eine Ohrfeige bekam. Der Dolmetscher rief sofort einen Posten herbei und ließ von diesem Hermanns mit dem Bajonett niederstechen. Hermanns wurde schwer verwundet, wir holten ihn nach ein paar Stunden auf einer Bahre weg. Er ist dann nach zehn Wochen gestorben. Uns wurden auch gedruckte Speisezettel vorgelegt, die wir nach Hause schicken mußten. Darauf standen eine Anzahl Speisen, die wir angeblich erhielten, was jedoch nicht der Wahrheit entsprach. Wer den Zettel nicht schickte, wurde mit Arrest bestraft.'' Bericht von Leutnant Weich und eine eidliche Aussage von Unteroffizier Boengruber: "Die Strafen waren furchtbar streng. Zuerst kannten wir nur das Tombeau. Eine einzige Zeltbahn, 1,50 Meter im Quadrat, wurde an den Enden auf der Erde befestigt, so daß sie in der Mitte 40 bis 50 Zentimeter hoch war. Unter dieses Zelt kam der Bestrafte, Kopf und Füße kamen natürlich am Ende [194] heraus. So lagen die Armen in der schrecklichen Sonnenhitze... Für gefundene Stücke französischer Zeitungen gab es ein bis vier Wochen Arrest, als Zusatz dazu noch Lohnabzug und Strafexerzieren. Der Bestrafte bekam einen mit Steinen gefüllten Sack über die Schulter und mußte damit zwei Stunden lang einen Hügel hinauf- und heruntergehen." Wenn ein Mann schlecht arbeitete, wurde er zunächst mit Arrest bestraft, und zwar in immer höherem Grade, zuletzt gab es nur noch Strafen von 60 Tagen, und zwar wurde jeder Gefangene schon dann bestraft, wenn er sich einmal von der Arbeit aufrichtete. Eine andere Strafe für die Leute, die nicht arbeiteten, war das Strafexerzieren in der glühendsten Mittagshitze von 12 bis 2 Uhr mit Sandsäcken auf dem Rücken. Ein deutscher Unteroffizier mußte jeweils mit der Uhr in der Hand dabeistehen, damit das Tempo 114 eingehalten wurde. Tat er das nicht, so wurde er selbst mit zum Strafexerzieren eingeteilt. Die Arreststrafen waren hier so: Die Leute mußten unter eine etwa 40 Zentimeter hoch vom Erdboden aufgesteckte Zeltbahn kriechen, bekamen nur Wasser und Brot und durften unter der zu kleinen Zeltdecke weder die Füße noch den Kopf herausstecken, so daß sie in ständig gekrümmter Haltung verharren mußten. Wegen des niedrigen Raumes herrschte unter der Zeltdecke eine glühende Hitze. Der die Zeltbahn bewachende Posten mußte, wenn der Arrestant einen Körperteil hervorsteckte, danach schlagen. [195] Eine andere Arreststrafe war folgende: Es wurde ein rundes Loch von etwa 60 Zentimeter Tiefe in die Erde gegraben und von einem Durchmesser, der gerade hinreichte, daß ein Mann in dem Loche kauernd sitzen konnte, und darüber ein Zelttuch gespannt. Eine weitere Strafart war folgende: Der Mann mußte eine 50 bis 60 Kilo schwere vierkantige Eisenstange auf die Schulter nehmen und mit dieser Last zwei bis drei Stunden stillstehen, ohne sich zu rühren. Meist brachen die Leute unter der Last schon vorher zusammen." Gefreiter Elmpt: "Eine sehr harte Strafe war folgende: Ein Apparat wurde auf beide Daumen gebracht und so fest angeschraubt, daß die Daumen ganz rot von dem zusammenfließenden Blut wurden. Diese Bestrafung mit der Daumenschraube ist während meiner Zeit in Koque-Klaba dreimal verhängt worden." Was in Algerien das "Tombeau" war, war in Marokko der "Silo", ein Loch im Erdboden von drei Meter Tiefe, einem unteren Durchmesser von etwa zwei Meter und einem oberen von 80 Zentimeter. Dieses Loch mußten sich die Gefangenen selber graben und hineinsteigen, zu einem, zu mehreren, in Sidi-el-Aidi sogar Leute mit 40 Grad Fieber. Ebenfalls gab es in Marokko die Strafe des Einzelzeltes; eine kleine Zeltbahn, die in der Mitte geknickt und bis zu einer Höhe von 50 Zentimeter über der Erde straff gespannt wird. Kopf und Füße blieben dabei unbedeckt. Bei Regenwetter, bei [196] großer Hitze oder bei kaltem Boden war diese Strafe die fürchterlichste Menschenquälerei. In Sidi-el-Aidi und anderen Lägern mußten die Leute, die das Arbeitspensum nicht geschafft hatten – zwölf Kubikmeter Steine am Tage klopfen, das ist wenigstens acht Stunden saure Arbeit, wobei eine Hitze von 75 bis 80 Grad Celsius oder körperliche Schwäche nicht als Entschuldigung für das Nichtleistenkönnen galten – des mittags in der sengendsten Hitze in Gruppen Laufschritt machen, wobei sie von Arabern mit der Knute geschlagen wurden. In Ber-Rechid mußten sie, ebenfalls in der heißesten Tageszeit, wenn die anderen zur Ruhe in ihren Zelten waren, an der Fahnenstange stramm stehen. In El-Boroudj war die Prügelstrafe offiziell. Nach El-Boroudj kamen hauptsächlich Leute mit aufrechter nationaler Gesinnung. Man hat hier vergeblich versucht, diesen besten Deutschen den steifen Nacken zu brechen; wenn sie eine Strafe unter dem Einzelzelt abzubüßen hatten, sangen sie noch "Deutschland, Deutschland über alles!", worauf sie in das sogenannte Büro des renseignements geschleppt und dort von arabischen Bastarden verprügelt wurden. Als diese Prügelei zu umfangreich wurde, wurde der französische Kommandant auf Veranlassung der Schweizer Kommission abgelöst. Man schickte dann von Paris aus einen neuen Kommandanten nach El-Boroudj, und zwar einen Offizier, der in deutscher Gefangenschaft gewesen war, der also nun Gelegenheit bekam, sich für die "schändliche Behandlung" in Deutschland an den Deutschen selbst zu rächen. Aber der Mann [197] tat alles, um das Los seiner Gefangenen zu verbessern. Seltsam! Der Capitaine Grand in Tunis nahm mit Vorliebe die deutschen Kriegsfreiwilligen zu Arbeiten wie Latrinenreinigen und Kohlenkarren. Er bestrafte die Leute, indem er sie ohne Wasser und ohne Bewegungsmöglichkeit – bei der Hitze – einsperrte. Die Unterärzte Scheffer und Fuchs berichteten auf Grund ihrer Erlebnisse im Kriegsgefangenenlager Carpiagne in Frankreich über den Zustand der aus Nordafrika zurückkehrenden Transporte: "Transporte, die aus Afrika kamen, sahen regelmäßig aus wie ein Leichenzug. Sie machten infolge der Malaria den Eindruck schwerer Blutarmut und entsetzlicher Unterernährung. Der französische Sanitätsdienst stand auf dem Standpunkt, daß Malaria keine Krankheit sei. Wir haben Transporte aus Algerien, Tunis und Marokko gesehen. Von einem Transport blieben 40 bis 50 Mann beim Appell in Carpiagne, der 50 Minuten dauerte, in den Baracken wegen Fieberanfälle zurück. Sie wurden krank gemeldet, aber der Leutnant verlangte, daß sie am nächsten Tag mit herauskommen sollten."
 Über das Lager Mikra bei Saloniki gab das Heft Gegenrechnung der Süddeutschen Monatshefte folgenden Bericht: "Vom 11. Januar 1919 bis 6. Juni 1919 weilte ich im französischen Gefangenenlager Mikra bei Saloniki. Das seit dem Winter 1918/19 übel berüchtigte Lager Mikra war während des Krieges – nach per- [198] sönlich mir gegenüber gemachten Aussagen eines französischen Arztes – infolge ausdrücklicher internationaler Abmachungen, die den bekannten schlechten hygienischen Verhältnissen des Lagers Rechnung trugen und die seines Wissens auch in die Berner Konvention aufgenommen wurden, nur als Sammellager benützt worden, um die an der mazedonischen Front gemachten Gefangenen dort zu sammeln und mit dem nächsten Schiff nach Frankreich abzubefördern. Mit dem Moment des Waffenstillstandes benützten die Franzosen das zu diesem Zweck in keiner Weise eingerichtete und in sanitärer Hinsicht jeder Beschreibung spottende Lager als Dauerlager. An dieser Tatsache, wie überhaupt an den ganzen Verhältnissen des Lagers Mikra, kann in selten überzeugender Weise die bewußte Absicht der französischen Regierung und verantwortlichen Befehlsstellen nachgewiesen werden, die Zeit nach dem Waffenstillstand – als Deutschland ohnmächtig geworden war – dazu auszunützen, die deutschen Gefangenen, das heißt, einen der kräftigsten und zukunftsvollsten Bestandteile der deutschen Jugend, soviel als irgend möglich entweder ganz zugrunde zu richten oder doch derart seelisch und körperlich zu schädigen, daß sie nur als gebrochene Männer zurückkehren sollten. Ein solcher Nachweis ist für Frankreich als Staat ungleich belastender als die Feststellung von Grausamkeiten französischer Einzelpersonen, die zwar die allgemeine Psychologie der französischen Rasse, aber nicht das System und die verantwortliche Politik Frankreichs treffen. [199] Sämtliche Gefangene (etwa 400 Deutsche, 500 Österreicher und Ungarn und zahlreiche Bulgaren), gleichgültig, ob Offizier, Unteroffizier oder Mann, waren in französischen Spitzzelten, sogenannten Marabous, untergebracht. Die Zelte, deren Normalbelegung auf höchstens zehn Mann berechnet ist, waren oft mit über zwanzig belegt. Fast sämtliche Zelte waren durchlöchert und derart brüchig, daß von einem Schutz gegen Wind und Wetter nicht die Rede war. Bei Regen stand das Wasser oft fußhoch in den Zelten, bei Sturm waren die Zeltstangen oft geknickt und die Zelte wurden weggeweht. In den eisigkalten Winternächten verließen unsere Leute oft ihre Zelte, um durch Bewegung das Erfrieren von Gliedmaßen zu verhindern. Strohsäcke gab es nicht. Glücklich war, wer eine Decke oder ein Zelttuch hatte; 95 Prozent besaßen jedoch nichts derartiges. Wir Offiziere konnten uns nach einiger Zeit durch heimlichen Kauf etwas Holz beschaffen und uns daraus Bettstellen zimmern. Die Mannschaften lagen jedoch den ganzen Winter auf der bloßen, feuchten, kalten Erde; zum Teil sogar ohne Mäntel. Infolge der zahlreichen Regenfälle war während des Winters der Boden des Lagers ein Morast, in den man bis zu den Knöcheln einsank, da es Wege oder Knüppelpfade nicht gab. Die Folge war, daß die Leute dauernd nasse Füße hatten. Über die sanitären Verhältnisse des Lagers Mikra ist folgendes zu sagen: Zunächst gab es für über 1200 Mann (Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften) nur eine Latrine, bestehend aus einem [200] schmalen, etwa ein Meter tiefen und 30 Meter langen Graben mit einem Brett davor, das jedoch bei Regen vollkommen in den Schmutz versank, so daß man dann noch bis über die Stiefel im Wasser stak. Die ganze Umgebung der Latrine war mit Kothaufen, die zum Teil mit Blut und Ruhrschleim durchsetzt waren, bedeckt. Man mußte oft viertelstundenlang bei Sturm und Regen anstehen, bis man einen Platz bekam. Regnete es, so lief die Latrine meistens über, und da sich das Gelände von der Latrine aus zum Lager senkte, so war dann der ganze Lagerplatz oft ein Sumpf von Schmutz, Lehm, Regenwasser, Urin und Kot. Ein fürchterlicher Gestank verbreitete sich dann über das ganze Lager. Aber auch, wenn es nicht regnete, war die Latrine des morgens wegen der Überbenützung der Nacht (infolge der zahlreichen Dysenterie- und Ruhrfälle) derartig mit Kot angefüllt, daß eine Benützung ausgeschlossen war und man seine Notdurft auf dem freien Lagerplatz, unserer einzigen Spaziergangsmöglichkeit, verrichten mußte. Chlorkalk gab es ganz selten und dann viel zu wenig. Als die erste Latrine dieser Art mit der Zeit unhaltbar geworden war, ließen die Franzosen sie notdürftig zuschütten, auf dem noch stinkenden und dampfenden Boden Unterkunftszelte errichten, in denen die Leute wieder auf dem bloßen Boden liegen mußten, und an einer anderen Stelle eine Latrine im gleichen Stil ausheben. Beschwerden bei französischen Ärzten wurden nur mit Achselzucken beantwortet. In dem einzigen Trink- und Waschwasserbrunnen des Lagers floß fast dauernd von [201] dem in der Nähe befindlichen Arrestkotter, in dem bis zu 80 Arrestanten kauerten, Urin zu, so daß darauf in erster Linie die zahlreichen Darmerkrankungen unserer Leute zurückzuführen sind. Das einzige Revier des Lagers bestand aus einer gänzlich zerfallenen, fensterlosen, feuchten, dunklen Lehmhütte, durch die jeder Windzug hindurchpfiff und die meist ungeheizt war. Nur in schwerkrankem Zustande wurden die Leute in das Revier überführt; an Medikamenten, Diätlebensmitteln, Eß- und Kochgeschirren, Decken, Betten, Waschgefäßen herrschte völliger Mangel. Die schlechte und pflegelose Unterbringung und die raffinierte Bestimmung, daß jeder Neuaufgenommene am ersten Tage überhaupt keine Nahrung bekam, hatten zur Folge, daß sich unsere Leute erst viel zu spät in ärztliche Behandlung begaben. Auch liefen sie dabei Gefahr, von dem französischen Arzt zurückgewiesen zu werden und dann von dem Aufsichtssergeanten als ganz besonderen Drückeberger mißhandelt zu werden. So ist es unter anderem vorgekommen, daß ein junger, sonst kerngesunder Kanonier, trotz hohem Fieber und mit jedem Tag zunehmender Entkräftung, sich nicht ins Revier meldete, aus begründeter Angst, von dem französischen Sergeanten aus der Reihe der Revierkandidaten noch vor der Vorstellung beim französischen Arzt herausgeholt und dann zu besonders schweren Arbeiten kommandiert zu werden. Schließlich mußte er gewaltsam von seinen Kameraden ins Revier getragen werden, doch es war zu spät, einige Stunden darauf verschied er im französischen La- [202] zarett. Die einzige Austrittsmöglichkeit der Revierkranken bestand in einer über ein Meter hohen, scharfkantigen Tonne (zugleich für Kot und Urin), die im Freien außerhalb des Reviers aufgestellt war, so daß selbst die schwer Ruhr-, Typhus-, Blasen- und Malariakranken, um ihre Geschäfte zu verrichten, bei Nacht, oft bei Sturm, Regen und eisiger Kälte ins Freie wanken mußten. Mehrmals brachen sie an und noch vor der Tonne entkräftet zusammen. Der Abzugsgraben der genannten Reviertonne lief mitten durch das Offizierlager, so daß bei Regen der aus Pfützenwasser, Urin und Kot (letzterer oft mit Blut und Schleim durchmischt) bestehende Grabeninhalt über die niederen 'Ufer' trat und die Zelte durchschwemmte, in denen wir, zuerst auf dem Boden, dann auf niederen Holzgestellen schliefen. Nur schwer Fieberkranke wurden krank geschrieben, fieberfreie Malariakranke oder an Rheumatismus Leidende galten nicht als krank und mußten weiterarbeiten. Ich habe es selbst gesehen, wie Rheumatismuskranke bei der Arbeit mit Vorliebe auf die Körperteile geschlagen wurden, an denen sie sowieso schon rasende Schmerzen hatten. Rücksichtslos wurden arbeitsunfähige Leute zur Arbeit geschickt, oft wurden sogar fehlende Arbeitskräfte aus dem Revier selbst von den Revierkandidaten ersetzt. Notorisch hoffnungslos tuberkulöse und geisteskranke Leute wurden genau so wie die Gesunden zur Arbeit mit herangezogen, und nicht ins Lazarett gebracht, geschweige denn, daß unsere Gesuche um ihre Abbeförderung nach Frankreich und vertrags- [203] gemäße Repatriierung anders als durch Hohngelächter beantwortet wurden. Zwar wurden diese Leute später auf die energische Forderung deutscher, aus der Ukraine gekommener Ärzte, mit dem Invalidenschein versehen und mit der bestimmten Versicherung getröstet, sofort nach ihrer Ankunft in Frankreich, nach Deutschland entlassen zu werden; in Frankreich angekommen, wurden ihre Invalidenscheine jedoch nicht anerkannt, und sie genau so wie ihre gesunden Kameraden ins zerstörte Gebiet zu Wiederaufbauarbeiten abbefördert. Die in Mikra eingerichtete Entlausungsanstalt war derart mangelhaft, daß die Leute anstatt entlaust, nur mit neuen Läusen und schweren Erkältungen behaftet, und ihrer geringen Habseligkeiten (Wäsche, Mäntel) beraubt, ins Lager zurückkehrten. Für die beim Arbeiten nicht verwendeten Offiziere und Unteroffiziere bestand die einzige Bewegungsmöglichkeit im Spaziergehen auf dem vor der Latrine liegenden, im Winter gänzlich versumpften Lagerplatz. Meistens wurde man jedoch von den Schwarzen (ohne Grund) einfach aus Vergnügen, durch Steinwürfe und Kolbenstöße am Spazierengehen gehindert.
Serbische Offiziere gaben mir öfter ihrer Empörung und Entrüstung über das barbarische Vorgehen der Franzosen in Mikra Ausdruck. Positive Schritte zur Besserung wurden jedoch nicht von ihnen unternommen. Unsere Lage besserte sich erst mit Hilfe unserer von der Ukraine Mitte März 1919 gekommenen 'Internierten', deutschen Kameraden des sogenannten Detachements Hopman, etwa [204] 6000 Mann. Am 9. April 1919 wurden wir dann nach Marseille abbefördert." C. v. Hofacker, ehemaliger Leutnant d. R. im
Ulanen-Regiment 20, Oberleutnant der deutschen
Mil.-Mission Türkei, Führer der türkischen Jagdstaffel 15. |