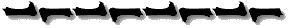|
Die Kriegsgefangenenläger in Frankreich Decken wir das Humanitätsgeheuchel weiter auf. Renaults Régime betonte, daß die deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich im Anfang des Krieges in Kasernen untergebracht worden seien. Als sich das Bedürfnis steigerte, habe man Baracken gebaut. Nur ausnahmsweise seien die Kriegsgefan- [125] genen in Zelte verwiesen worden. Man habe nur die besten Kasernen ausgewählt und auf "Komfort" gesehen. Behördliche Rundschreiben hätten die Gesundheitserfordernisse in den Vordergrund gestellt. Und Cahen-Salvador gab in seinem Buche Les prisonniers de guerre Briefe von Gefangenen und Gesandtschaftsberichte wieder, die alle voll des Lobes waren über die Art, wie die deutschen Kriegsgefangenen untergebracht, behandelt und verpflegt wurden. Merkwürdig ist aber nur, daß man in Deutschland keinen einzigen ehemaligen "Prisonnier" antrifft, der von solch einem Leben wie Gott in Frankreich zu erzählen weiß.
 Um zuerst ein allgemeines Bild von den Kriegsgefangenenlägern in Frankreich zu bringen, gebe ich den ruhig-objektiven und sehr umfassenden Bericht eines früheren deutschen Lagerführers in seinen wesentlichsten Teilen wieder. Der Verfasser, Studienrat Dr. Schreiner aus Trier, geriet als Vizefeldwebel der Reserve am 6. September 1914 verwundet in Gefangenschaft, wurde bald darauf von seinem Heimatregiment zum Leutnant befördert, was von den Franzosen aber nicht anerkannt wurde; so blieb Leutnant Schreiner in Mannschaftslagern. Der Bericht war eine Eingabe an das Preußische Kriegsministerium, die der Verfasser nach seinem Austausch in der Schweiz aufgesetzt hatte. "Die Lage der deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich ist recht trübe und wird für die seit 1914 Gefangenen mit der fortschreitenden Verlängerung des Krieges verzweifelt. In den meisten [126] Lägern, die ich kenne, behandelten uns die Franzosen mit drückender Härte, stellenweise mit Brutalität. Wohlwollen kennen sie nicht für uns. Eine ausdrückliche Ausnahme muß ich da machen für gewisse Läger in der Bretagne: Ich kenne diese Region nicht, indessen erklärten mir einwandfreie Zeugen, daß die dortigen royalistischen Offiziere die Kriegsgefangenen gut behandelten, und auch die Bevölkerung ihnen nicht übel gesinnt war. Die meisten der in Depots kommandierten Unteroffiziere erblicken in den deutschen Kriegsgefangenen nach wie vor den Feind, über dessen Greueltaten ihre Presse nicht aufhört, sie zu belehren, und der Haß macht sich da, wo die Deutschen nicht auf Wahrung ihrer Würde bedacht sind, und das ist in den meisten Fällen leider nicht der Fall, in einer völlig unwürdigen und verächtlichen Behandlung Luft. Selbst besser Denkende können ihren Widerwillen gegen die 'Boches' nur schwer verhehlen. Am besten kommen unsere Leute noch mit den einfachen Wachmannschaften aus, aus den meist ganz ungebildeten niederen Ständen des französischen Volkes. Da diese unter dem ständigen Druck ihrer eigenen Vorgesetzten seufzen, so verbindet sie mit dem 'Boche' ein unbewußtes Solidaritätsgefühl, und manchmal schauen diese sozial und politisch Entrechteten mit dem Respekt des Schwächeren zu ihren verwegenen und selbstbewußten Gefangenen auf. Diese Scheu vor den Deutschen scheint mir sogar im Anfang ziemlich allgemein gewesen zu sein, leider haben unsere Volksgenossen es nicht [127] verstanden, diese Stellung zu bewahren. Auch bei den das Kriegsgefangenenwesen leitenden höheren Stellen darf man sich meiner Überzeugung nach guten Willens nicht versehen. Scheut sich doch das französische Kriegsministerium bei seinen ewigen 'Reziprozitätsmaßnahmen' nicht, die eigenen seit drei Jahren geübten Plackereien den staunenden Kriegsgefangenen als deutsche Neuerungen vorzusetzen. Und beim Lager Souilly erleben wir es, daß dieselbe amtliche Stelle vor der Kammer überhaupt sein Dasein ableugnet, und zur selben Zeit sitzt bei uns auf der Ile de Ré Vizefeldwebel Hummel, der acht Wochen dort Depotchef war. Ich will von dem, was ich in den vielen Lagern erlebt habe, das mitteilen, was einmal der deutschen Regierung noch nicht von anderer Seite her mitgeteilt ist, andererseits wenigstens in seinen Nachwirkungen noch fortbesteht. Einzelberichte laufen wohl fortwährend bei unserer Regierung ein, da ich aber als nachbeförderter Offizier die ganze Zeit im Mannschaftslager gewesen bin, so dürfte ich in der Lage sein, auch ein anschauliches Allgemeinbild zu entwerfen. Um mir nicht den Vorwurf der Einseitigkeit zuzuziehen, schicke ich noch voraus, daß ich infolge einer kriegsgerichtlichen Sache nach erfolgtem Freispruch aus dem Depot III in Toulouse, einem verhältnismäßig guten Lager, wenigstens was die Behandlung angeht, nach Auch strafversetzt wurde, dann nach abermaligem zweimonatigem Aufenthalt in Toulouse nach dem Fort du Murier und von dort Sommer 1916 in die berüchtigte drei- [128] zehnte Region kam, um schließlich Anfang 1917 auf der Ile de Ré zu landen. Doch beziehen sich meine Angaben keineswegs nur auf die Läger, in denen ich selbst gewesen bin, da ich besonders auf Fort de Murier und auf der Ile de Ré die reichlich vorhandene Gelegenheit ausnutzte, mich auch über andere Läger zu unterrichten. Die an der Spitze der Läger stehenden Offiziere, bei kleineren Leutenants, bei größeren Kommandanten oder Kapitäne, setzten sich in der Regel aus den ungeeignetsten Elementen des Reserveoffizierkorps oder aus ausgedienten Unteroffizieren der Kolonialtruppen zusammen, die sich durch besondere Brutalität auszeichnen. Sämtlichen Lägern einer Region ist als Stellvertreter des kommandierenden Generals ein Oberst vorgesetzt. Kennzeichnend für die Art, wie viele den Kriegsgefangenen gegenüberstehen, ist das von mir mitgeteilte kleine Vorkommnis in Blaye, wo der Kommandant in Gegenwart sämtlicher Deutschen und Franzosen nach einem "Sous-Offizier-Boche" ruft. – Der Vermittler zwischen den französischen Vorgesetzten und den deutschen Kriegsgefangenen ist der deutsche Lagerälteste, den die Franzosen in einzelnen Lägern als Chef de camp, in anderen, um ihm von vornherein keine allzu großen Befugnisse einzuräumen, als Interprête oder Transmetteur d'ordre bezeichnen. Von der Persönlichkeit des Ältesten und ob dieser sich für einen so schwierigen, verantwortungsvollen, viel Selbstverleugnung verlangenden und unter Umständen gefährlichen, jedenfalls [129] aber aufreibenden Posten eignet, hängt sehr viel ab. Bei der in französischen Verwaltungen üblichen Regellosigkeit und bei dem Mangel einer beständigen und gerechten, auch den Klagen der Gefangenen zugänglichen Überwachung ergeben sich Beschwerden der Mannschaften und Streitpunkte mit den französischen Vorgesetzten tagtäglich, und die Mannschaften sind darauf angewiesen, daß der Älteste ihre Angelegenheiten geschickt und entschieden vertritt. Mit Entschiedenheit ist bei den Franzosen viel zu erreichen, zumal sie meist nicht unbescholten sind und einem Skandal, der die Aufmerksamkeit auf sie lenken könnte, aus dem Wege gehen müssen. Natürlich, wenn ein solcher Mann den Franzosen nicht unentbehrlich ist, entweder wegen der Kenntnis der Sprache und der Geschäfte des Lagers oder deswegen, weil er allein genügende Autorität hat, um mit den Deutschen fertig zu werden, so muß er gewärtigen, daß sie sich bei einer passenden Gelegenheit seiner entledigen. So endet diese Laufbahn häufig mit einer längeren Arreststrafe, und Ende 1916 zogen die Franzosen die meisten dieser Depotleiter, die sich für ihre Zwecke nicht hergaben, die sogenannten "Fortes-têtes" auf der Ile de Ré zusammen. Da sich die französischen Kommandanten meist in einer Art Pascharolle gefallen, so hat es der Lagerälteste meistens mit den französischen Unteroffizieren zu tun, die auch in den über ihre Zuständigkeit hinausgehenden Fällen den Kommandanten maßgebend beeinflussen. In manchen Lägern [130] ist nämlich der Kommandant den Kriegsgefangenen überhaupt unerreichbar, so bedurfte es bei dem Kommandanten Pechin im früheren Mannschaftslager Auch einer vorherigen Meldung auf dem französischen Büro, daß man den Kommandanten sprechen wolle. Als ich einmal in einem Falle ganz grundloser Bestrafung einiger Leute beim Büro eine Unterredung erbat, suchte man mich zunächst durch Hinweis auf das Gefährliche des Schrittes davon abzubringen, ich bestand aber auf die Anmeldung. Da man diese aber trotzdem ganz einfach unterließ, so war ich doch gezwungen, die Unterredung selber, mit Umgehung der von dem Kommandanten vorgeschriebenen Formen, herbeizuführen. Er ließ mir damals sagen, wenn ich mich noch einmal persönlich an ihn wende, so werde er mich bestrafen. In Roanne bediente sich der leitende französische Adjutant-Marschall, ein Elsässer, deutscher Vorgesetzter als Spione. Insbesondere waren die Franzosen über die Gesinnung der "Intellektuellen", die die Franzosen stets besonders im Auge behalten, und auch über etwaige Fluchtversuche fast immer sehr gut unterrichtet. Unterbringung: In Toulouse und Montauban waren wir 1914–1915 in Geschützschuppen untergebracht, große, aus Eisenkonstruktion und dünnen Ziegellagen bestehende Gebäude, in denen wir den harten Winter mit seinen eisigen Pyrenäenwinden auszuhalten hatten. In Roanne befindet sich das Lager im Saale einer ehemaligen Spinnerei. Da er [131] sehr überlegt ist, so ist dort des nachts eine fürchterliche Luft, die noch verschlechtert wird durch die unmittelbare Nähe des Abtrittes, der nur durch eine Holztür abgetrennt ist. Da die Franzosen niemals rechtzeitig für Entleerung der Abortgrube sorgten, so kam es alle drei Wochen vor, daß Kot und Urin überliefen und bis in den Wohn- und Schlafraum eindrangen, wodurch die Luft dann für einige Tage – solange dauerte es immer, bis Abhilfe geschaffen wurde – geradezu verpestet war. In Chagnat, wo jetzt ein Polenlager sein soll, wohnten wir bis Dezember 1916 in einer alten Zuckerfabrik. Die Mannschaften waren in Räumen des Erdgeschosses untergebracht, wovon der eine mit Ziegeln gepflastert war. Die andern aber hatten nur den gewachsenen Boden, waren sehr hoch und ungenügend beleuchtet. Die Unteroffiziere waren in einem Raum im Obergeschoß, durch einen Plankenbelag von dem Mannschaftsraum getrennt, untergebracht. Dieser Raum hatte ungefähr die Maße zwanzig mal acht mal vier, und dort lagen wir zuletzt 80 Mann stark; man sagte mir aber, das sei noch nicht schlimm, sie hätten da schon zu 107 gelegen. Überhaupt war das sogenannte régime de faveur im Depot Aulnat-Gerzat ein reiner Hohn. Für den Sommer waren nun die Wohnungsverhältnisse in Chagnat nicht so übel, da man die ganze Nacht die Fenster auflassen konnte und tagsüber sich meist im Freien aufhielt. Desto schlimmer aber war es im Winter, wo die Kälte durch die schadhafte Decke und alle möglichen Ritzen und [132] Löcher des baufälligen Gebäudes eindrang. Heizung gab es selbstverständlich im ganzen Bereich des Depots Aulnat-Gerzat nicht, ebensowenig wie in Roanne. Ich selbst habe nur auf dem Fort du Murier, in Riom und in St. Martin de Ré geheizte Räume erlebt. Geradezu eisig aber war es in Chagnat in dem einen Mannschaftsraum, dabei hatte man uns im September 1916 die eine der beiden Decken abgenommen, mit der Behauptung, es stände uns nur eine Decke zu. Und dann waren im Oktober und November ständig Transporte aus Afrika nach Chagnat gekommen, wovon die meisten an Malaria litten, einige ganz fürchterlich vom Fieber zermürbt waren. Und diese Leute hatten teilweise überhaupt keine Decken, auf meine Bemühungen, vom Hauptdepot welche zu erhalten, wurde überhaupt nicht reagiert. Die Leute halfen sich bisweilen, indem sie mitten in ihrem Wohnraum aus zerschlagenen Pritschen ein lustiges Feuer anzündeten. Auch Hemden habe ich für diese Leute angefordert, natürlich ohne Erfolg. Dabei stehen nach den Bestimmungen jedem Gefangenen zwei französische Hemden zu. Wer die Verwaltung einer deutschen Kammer kennt, kann sich die Lotterei und Unterschlagung in französischen Kammern gar nicht vorstellen. Wird doch in den meisten Lägern gar nicht gebucht, was ausgegeben ist, ebensowenig natürlich die Gegenstände, die die Gefangenen abgegeben haben. Wäre es in einem deutschen Lager möglich, daß die Gefangenen, wie in St. Martin und in anderen Lägern, [133] dutzendweise die Holzpritschen verfeuerten, ohne daß die Franzosen es merkten? Ganz übel sind aber die Unterbringungsverhältnisse auf manchem der kleinen detachirten Landkommandos, wo ja niemals der Besuch eines Neutralen zu befürchten ist, und zwar besonders in Südfrankreich. Da ich erfahren habe, daß die Kantonements, die ich im Herbst 1915 kennenlernt und die damals zum jetzt aufgehobenen Mannschaftslager Auch gehörten. [Satz im Original unvollständig; Anm. d. Scriptorium.] Ernährung: Sie war im Sommer 1916 schon in dem berüchtigten Ruhelager Chagnat, das eigentlich ein Erholungslager für Kranke, außerdem für nicht arbeitende Unteroffiziere sein sollte, ganz ungenügend. Ich habe darüber die genauen Eintragungen des deutschen Küchenunteroffiziers gehabt, die mir aber die Franzosen jetzt bei meiner Abreise nach der Schweiz aus meinen Papieren weggenommen haben. So lieferte uns der Metzger beim Fleisch stets Kopf-, Gurgel- und Schulterstücke, die man nur in die Suppe tun konnte, wodurch das auf den einzelnen kommende Stück Fleisch noch winziger wurde. Denn nun schlug der Metzger, der mit Morroux und Jobert unter einer Decke steckte, einen andern Weg ein: er lieferte das Fleisch nicht mehr unmittelbar nach Chagnat, sondern ans Hauptdepot Gerzat. Und doch wurde mir von meinen Kameraden versichert, daß die Ernährungsverhältnisse mit den zur Zeit der Eröffnung des Lagers, Frühjahr 1915, herrschenden gar nicht zu vergleichen wären. Die Folge war, daß die Hälfte der Leute magenkrank wurde. An Brot [Scriptorium merkt an: Fleisch?] erhielten wir [134] damals noch die uns zustehende Menge von 600 Gramm, aber, abgesehen davon, daß sich immer Stücke darunter befanden, die ungenießbar waren, kriegten wir unsern Teil in frischem Zustande abgewogen, so daß man stets 100 bis 150 Gramm verlor. Schlecht gebacken und ekelhaft schmeckend war auch das Brot in Roanne im Sommer 1916. Als ich dort mit Franzosen zusammen in der Arrestanstalt saß, machten diese aus unserm Brot Kugeln und bewarfen sich damit gegenseitig; sie gaben uns von ihrem Brot ab. Als ich am 2. November 1916 nach Chagnat zurückkehrte und als Ältester die Leitung des Lagers übernahm, hatten sich die Verhältnisse dort sehr geändert. Zahlreiche Mannschaften, die früher auf Fort du Murier und in Afrika gewesen waren, waren eingetroffen, und noch im Laufe des Monats kamen weitere. Über die Hälfte der Mannschaften arbeitete jetzt, und zwar taten sie schwere Arbeit. Viele der Leute kamen auch ganz krank aus Afrika zurück, und da sie völlig mittellos waren, litten sie die bitterste Not. Die Nahrung war nun noch weiter schlechter als im Sommer, was ich zahlenmäßig leider nicht mehr belegen kann, da die Aufzeichnungen meines Küchenunteroffiziers, Sergeant Drees, mir abgenommen worden sind. Wir haben bisweilen abends Suppen gehabt, die nicht mit scherzhafter Übertreibung, sondern im buchstäblichen Sinne als Spülwasser zu bezeichnen waren. Dazu war alles unschmackhaft, da es uns an Salz mangelte. Die Unzufriedenheit der Leute äußerte sich stürmisch, oft [135] zogen sie scharenweise mit dem bißchen Essen zu dem französischen Kantonnementschef. Ich verlangte als einziges Mittel unsere Klagen zu befriedigen, die amtliche, vom Kriegsministerium aufgestellte Liste der Nahrungsmittel, aber der französische Sergeant erklärte, die habe er selber nicht. Im übrigen suchte uns der die Lebensmittel ausgebende Korporal zu beschwichtigen, indem er uns aus dem zum Lager gehörigen Garten Kohlköpfe zulegte, wobei ihn mein braver Küchensergeant noch regelmäßig bemogelte. Auch stahlen die auf den Feldern arbeitenden Mannschaften wacker die dem Hauptdepot gehörenden Kartoffeln, Kartoffeln erhielten wir sonst in diesem Monat so gut wie gar keine. Ich sandte einen Privatbrief an die Amerikanische Botschaft in Paris, den ich durch einen sicheren Mann besorgen lassen wollte, der auf dem Bahnhof in Clermont arbeitete. Daß wir auf amtlichem Wege mit der Botschaft verkehren konnten, war in der dreizehnten Region damals noch unbekannt, außerdem wäre auch auf diesem Wege im Depot Aulnat-Gerzat nie ein Brief dorthin gekommen. Das Gesuch vom 5. November ging am Montagmorgen, dem 6. November (Abschrift liegt als Anlage bei) nach Gerzat ab. Am Dienstag wurde uns die erbetene angebliche amtliche Liste vom Depot übersandt, mit dem Befehl, sie in den Räumen der Kriegsgefangenen anzuschlagen. Diese Liste, vom Kommandanten Morraux unterzeichnet und mit dem Siegel des Depots versehen, enthielt nun noch geringere Mengen, als wir sie bisher bekommen hatten. Einer dieser Zettel ist bis vor [136] kurzem in meinem Besitz gewesen, leider haben mir auch den die Franzosen bei der Abreise weggenommen. Zwei Tage darauf aber kam sehr hastig der Verwaltungsoffizier von Gerzat herausgefahren, entschuldigte sich, jene Liste sei: Le resultat dé une erreur, es stände uns viel mehr zu und das sollten wir auch erhalten, vor allem die Arbeiter; die Anschläge sollten sofort abgenommen und durch richtige ersetzt werden, die er ehestens herausschicken werde. Auch verschiedenere kleine Wünsche erfüllte er. Vielleicht ist diese unerwartete Nachgiebigkeit auf das Dazwischentreten eines französischen Kapitäns zurückzuführen, unter dessen Leitung ein Teil meiner Leute tagsüber zu arbeiten hatte. Dieser hatte sich tags zuvor über die geringe Arbeitsleistung der Leute ausgelassen, und als Antwort zeigten ihm diese die von Gerzat herausgekommene Liste, worauf er sehr erstaunt war. Nun aber erschien Samstag, den 11. November, der Kommandant Morroux selber, der mir sowieso nicht hold war. Er sagte mir: "Sie haben eine Kollektivbeschwerde an mich gerichtet. Sie wissen, daß Kollektivbeschwerden in Frankreich so gut wie in Deutschland verboten sind." – Ich antwortete ihm: "Aber nicht Gesuche." Darauf bemerkte er mir: "Sie klagen über das Essen in Bourdon. Nun will ich Ihnen sagen, was die Leute in Bourdon alle bekommen." Und er zählte mir auf: Kaffee, Wein, Käse usw. In der Tat arbeitete zu dieser Zeit außer der in meinem Gesuche erwähnten Abteilung, die bei der Intendantur beschäftigt war, noch eine zweite Abteilung in einer gleichfalls in Bourdon gelegenen [137] Zuckerfabrik, bei einem Privaten. Diese Abteilung, die in unserm Kantonnement keinerlei Verpflegung, nicht einmal das Brot empfing, nur eine Woche lang bei uns schlief, war am selben Sonntage, da ich das Gesuch schrieb, spät abends bei uns eingetroffen, und ging am Montag zum erstenmal auf ihren Arbeitsplatz. Das konnte natürlich dem Kommandanten des Lagers nicht unbekannt sein. Ich sagte ihm ruhig, das hätte ich schon gehört, aber um diese Leute handle es sich gar nicht, worauf er mich unterbrach: "Je m'en fous, je vous punis avec quinze jours de prison, dont huit jours de cellule!" Ein paar Tage darauf wurde die Strafe vom Obersten der Region erhöht mit folgender Begründung: "A adresse par écrit au commandant du dépôt une réclamation non fondée au nom de ses camarades concernant la nourriture qui leur était donnée a l'usine de Bourdon, qui après enquête a été reconnue non justifiée. Punition augmentée à 20 jours, dont 12 de cellule." Wenn nun auch die Zahl der Nährkalorien vertraglich zwischen den beiden Regierungen festgesetzt ist, so hindert das findige Verwaltungen nicht, schlechte und schlechteste Qualitäten der Nahrungsmittel einzukaufen. Die uns gelieferten Nudeln sind weiter nichts als Kleister, in den Linsen fanden wir Käfer, in Toulouse fischte ich einmal 40 Stück aus einem einzigen Teller Suppe heraus, und doch hatte der Koch schon vorher eine gute Anzahl abgeschöpft. In St. Martin waren Lin- [138] sen und Bohnen besonders dadurch gefährdet, daß sich darin eine Unmenge kleiner Steine befand, man konnte nur ganz vorsichtig essen, um sich nicht die in der Gefangenschaft unersetzlichen Zähne und Plomben auszubeißen. Dann kommt es sehr darauf an, was aus den zur Verfügung gestellten Mengen gemacht wird. Die Gefangenen helfen sich oft, indem sie sich aus Konservenbüchsen selber Öfen herstellen, worin mit Papier usw. gefeuert wurde; wer aber dabei erwischt wurde, wanderte natürlich in Arrest. Arbeit: Über die Arbeit unserer Kriegsgefangenen kann ich mich nur im allgemeinen äußern, da ich mich als Aufsichtsführender schon in Auch ziemlich disqualifiziert hatte. Die Arbeitszeit füllt den ganzen Tag aus, die Leute rücken morgens um sechs zur Arbeit ab und kommen erst zum Abendbrot wieder herein. In Roanne, wo noch ein stundenlanger Appell vorausging, bei dem der französische Adjutant seine Arbeitseinteilung machte, stand man schon um vier Uhr auf. In Chagnat hatten die Leute von der Arbeitsstätte noch einen Weg von über einer Stunde, kamen oft erst um sieben Uhr nach Hause. In der Regel wird eine Mittagspause von zwei Stunden gewährt, worin aber meist der Weg zur Arbeitsstätte eingerechnet ist. Auf den zu Aulnat-Gerzat gehörigen Abteilungen wurde von Zeit zu Zeit der Versuch gemacht, die Pause auf eineinhalb Stunden herabzusetzen. Widerlich ist die Antreiberei, wie sie auf vielen Arbeitsplätzen von den französischen Korporalen, oft auch von den Posten geübt wird. Da braucht nur [139] einer mal den Kopf zu heben, so erschallt das unsern Leuten so verhaßte: Allez, allez! Verliert mal einer der Leute die Geduld, so fliegt er in Arrest. Fast stets stellen die Franzosen auch an den begleitenden deutschen Aufsichtsunteroffizier das Ansinnen, die Leute zur Arbeit anzutreiben. Arbeiten sie schlecht, so wird er verantwortlich gemacht und geht in Arrest. Ich begleitete einmal Ende September 1915 eine Arbeiterabteilung in die Stadt, die von dort Bettgestelle in die Kaserne tragen sollte. Da die Arbeit drängte, so sollten auch die sogenannten Halbinvaliden mit; damit diesen Leuten nichts über ihre Kräfte zugemutet würde, sollte ein französisch sprechender Unteroffizier die Abteilung begleiten. Bei diesen Anordnungen hatte ich selbst tags zuvor dem französischen Adjutanten, der vorübergehend das Lager leitete, als Dolmetscher gedient. Daß ich anderntags mit hinaus mußte, obwohl bereits ein Offizierstellvertreter und ein Unteroffizier mit dabei waren, die französisch sprachen, führe ich auf eine vielleicht nicht von den Franzosen allein ausgehende Schikane zurück. Gleich beim ersten Gang ereignete sich folgender Zwischenfall. Einer der Halbinvaliden fiel mir auf, der mit kläglichem Gesicht neben zwei eisernen Bettfüßen stand. Ich fragte ihn: "Können Sie das auch tragen?" Worauf er erwiderte: "Ich kann nicht, aber ich muß." Ich sagte nun in aller Harmlosigkeit, weil ich dabei an die Möglichkeit einer Meinungsverschiedenheit gar nicht dachte, zu dem die Sachen ausgebenden französischen Sergeanten, der Mann sei Halbinvalide, er könne nur [140] einen Bettfuß tragen. Als ich nun die grobe Antwort bekam: "Je m'en fou", da sagte ich sehr entschieden: "Alsdann lehne ich jede Verantwortung ab!" Nun kam der französische Sergeant hinzu, der uns vom Lager aus mitgegeben war, und der mir schon nicht gewogen war, weil ich die Kriecherei vor den französischen Unteroffizieren nicht mitmachte. Ich teilte ihm noch einmal ganz ruhig den Sachverhalt mit. Nun fing er an zu schimpfen: "Die anderen Unteroffiziere sagen nie etwas" – damit hatte er auch leider nicht Unrecht – "Sie haben immer etwas zu sagen!" Darauf ich: "Wozu begleite ich denn die Leute?" Er erwiderte: "Bloß um die äußere Ordnung aufrechtzuerhalten und Marsch und Halt zu kommandieren." Ich sagte, dann sei es ja gut, ich hätte aber am Abend zuvor ganz andere Instruktionen bekommen. Nun schrie er mich an, ich hätte überhaupt viel höflicher gegen ihn zu sein, ich hätte die Hände aus den Taschen zu nehmen. Ich stand zwanglos da und hatte die Hände in den Seitentaschen des Waffenrockes; wahrscheinlich wünschte er, ich sollte stramm vor ihm stehen. Ich legte ganz ruhig die Hand an die Mütze und sagte: "Mein Herr, Sie wissen, daß ich deutscher Offizier bin." – "Sie sind kein Offizier, Sie sind Unteroffizier!", schrie er wütend. Ich antwortete ganz kalt: "Ich habe keinen Grund, darüber hier mit Ihnen zu diskutieren." Weiter habe ich außer den hier angeführten Worten nichts gesagt. Darauf drohte er mit sofortiger Meldung beim Kommandanten. Nach der Kaserne zurückgekehrt, wurde zuerst der Gefangene, um den es sich handelte, [141] hernach ich zu dem Leutnant gerufen. Der Sergeant, der doch kein Wort Deutsch verstand, beschuldigte mich, ich hätte dem Mann den Befehl gegeben, die Bettfüße nicht zu tragen. Demgegenüber stellte ich fest, ich hätte überhaupt weder einen Befehl ausgesprochen, noch ein Verbot, sondern lediglich eine Erklärung abgegeben. Ich wurde dann entlassen, aber eine Stunde später in Dunkelzelle abgeholt. Ich kriegte dreißig Tage mit folgender Begründung: "Surveillant une corvée de malingres chargées de travail léger a prétexté qu'un homme était impuissant pour ce travail, fait dementi par le interéssé lui-même, et a eu une attitude irrespectueuse envers le sous-officier franâais, qui lui faisait des observations à cause de son intervention maladroite et injustifiée." Hernach erfuhr ich, daß der arme dumme Kerl sich von den Franzosen hatte einschüchtern lassen, zu sagen, er hätte die Bettfüße wohl tragen können, dafür hätte er übrigens von seinen Kameraden beinahe Prügel bekommen, die ihn zwangen, sich wenigstens am nächsten Morgen krank zu melden. Auf meine energische Forderung, wenigstens verhört zu werden, kam der Adjutant, der mir damals jene Instruktion gegeben hatte. Ich stellte ihm die Sache vor, worauf er versprach, ich würde herauskommen. Da er aber einige Tage später wieder versetzt wurde, so blieb ich sitzen, und zwar 37 Tage. Das französische Kriegsministerium, das sich auf Veranlassung unseres Kriegsministeriums mit der schmählichen Geschichte zu befassen hatte, [142] fußte natürlich auf dem Bericht des Lagers Auch und gab als Grund meiner Bestrafung die Intervention maladroite an, ich selbst wurde natürlich nicht gefragt, erfuhr überhaupt niemals etwas von der Sache. Behandlung: Ich wende mich zu dem Kapitel Behandlung, das ein trauriges Bild schmählichster Sklaverei enthüllt. Eine besondere Stärke der Franzosen ist es, den Gefangenen durch elende Demütigung und kleinliche Quälereien das Leben zu verbittern und einen beständigen Druck auf ihnen zu lassen. So war in Roanne der übelste Tag für die Gefangenen der Sonntag, wo die Franzosen recht viel Zeit zu Schikanen hatten. Man wird es so erklärlich finden, daß viele von uns die Läger vorzogen, die sich in einem recht verwahrlosten Zustande befinden – im Gegensatz zu denen in Kasernen, wo die verhaßten Sergeanten und Korporale alle Augenblick auftauchten – da einen hier die Franzosen mehr in Ruhe ließen, auch die örtlichen Verhältnisse vielfach die Durchführung von Bestimmungen unmöglich machten. Die Besichtigungen durch den Kommandanten, die in den Arbeitslagern Auch und Roanne sonntags stattfanden, wurden von den französischen Unteroffizieren schon eine Stunde vorher mit großer Aufgeregtheit und viel Schimpfen und Drohen eingeleitet, so daß man aufatmete, wenn der Abend kam und alles vorbei war. In Roanne wurde einmal im Juli 1916 von dem Adjutanten Marschall und dem Leutnant Tailladard, genannt Fips, eine große Razzia auf überflüssige Sachen veranstaltet. Die Gefange- [143] nen mußten in Eile packen und mit ihren Sachen auf dem Hofe antreten. Innen schlugen mittlerweile die Franzosen entzwei und warfen weg, was zurückgeblieben war: Bilder, Pfeifen, Spiegel, Rasierapparate, Tabak, Lebensmittel usw. Und das mußten sich in diesem Sklavenlager die Leute ohne Widerspruch gefallen lassen. Ein Mann, der, abends von der Arbeit zurückkehrend, gegen die Wegnahme seines Rasierapparates protestierte, wurde einfach eingesperrt. Dasselbe Schauspiel veranstaltete Marschall noch einmal, als er einen liebenswürdigen Brief erhielt von dem nach Deutschland entwichenen bayerischen Unteroffizier Tregler. Noch viel schlimmer aber soll sich bei einer solchen Razzia in Roanne der aus Afrika mit einem Rücktransport deutscher Kriegsgefangener herübergekommene französische Leutnant Blanc betragen haben, auch Leutnant Jobert hat sich in Chagnat vor meiner Zeit ähnliches geleistet. In Auch veranstaltete man mit Vorliebe "militärische Sonntage". So mußten einmal an einem glühend heißen Septembersonntag die Leute, die doch die ganze Woche über arbeiteten, am Vormittag die ganzen Pritschen und Strohsäcke in den Hof tragen, reinigen und von den Wanzen befreien. Man brachte also den ganzen Sonntag in denkbar größter Ungemütlichkeit auf dem Hofe zu, bis endlich abends nach der Besichtigung durch den Kommandanten die Stuben wieder eingeräumt werden durften. Wie wenig im allgemeinen die Franzosen auf unsere Feiertage Rücksicht nehmen, zeigt das Beispiel desselben Aucher Kommandanten, der ausgerechnet am [144] 25. Dezember 1915 ein großes Detachement die Reise nach dem neuen Depot antreten ließ. In Montlucon, wo ich im Dezember 1916 war, fanden nicht nur am Sonntag mehrere Extraappelle statt, sondern die Leute, die wochentags bei Dunkelheit zur Arbeit abmarschierten und bei Dunkelheit heimkamen, mußten auch noch auf dem Hofe exerzieren, wobei dann der französische Leutnant Chouffet, von den Leuten der Schuft genannt, mit einer Liste dabei stand und jeden, der lachte oder sprach, herausgriff und mit Arrest bestrafte. Eine allgemeine Bestimmung ist die, daß die Haare ganz kurz geschoren werden müssen. Aber die Art, wie die Gefangenen dem unterworfen werden, erinnert in vielen Lägern an das Scheren der Verbrecher im Zuchthaus. Eine Abteilung deutscher Feldwebel sowie österreichisch-ungarischer Zugführer, im ganzen etwa 80 Mann, die von Chagnat nach Riom überführt wurden, wo sie sich sechs Tage aufhielten, bis über ihren weiteren Verbleib entschieden wurde, mußte es sich gefallen lassen, daß in herausfordernder Weise ein Korporal mit einer Schere unsern Raum betrat und jedem von ihnen ein großes Dreieck in das Kopfhaar schneiden wollte, um sie so zu zwingen, die Haare schneiden zu lassen. Er packte sich den etatsmäßigen Feldwebel Hansen und einen ungarischen Zugführer, die sich aber entschieden weigerten, diese unwürdige Prozedur an sich vollziehen zu lassen. Als Ältester erklärte ich dem Korporal, wir seien bereit, uns die Haare schneiden zu lassen, aber ein [145] solches Verfahren müßten wir ablehnen, wir seien weder Zuchthäusler noch dumme Jungen, und bei dem Feldwebel Hansen habe er es mit einem alten Comtable zu tun, für den sich eine solche Behandlung nicht schicke. Der Korporal bestand eigensinnig auf seinem Willen, Hansen blieb und als die übrigen Unteroffiziere, die durch die barsche und erniedrigende Art, wie man uns dauernd in Riom behandelt hatte, schon gereizt waren, entrüstet herbeieilten, verschwand der Korporal wütend von der Bildfläche, schickte dann aber einen Gendarmen herauf, dem ich jedoch in aller Ruhe und mit Entschiedenheit den Sachverhalt darlegte, worauf er sich zufriedengab. Die Arreststrafen sind in Frankreich bekanntlich sehr hoch, und da jeder höhere Vorgesetzte noch etwas darauflegt, so steht man sich in der Regel auf mindestens 15, meist aber 30, ab und zu auch 45 bis 60 Tage. Nun erhalten französische Soldaten während der Strafzeit die sonstige Verpflegung. So war es auch in der ersten Zeit bei den deutschen Kriegsgefangenen. Dann aber verband man mit dem heimischen das deutsche System, indem man ihnen verminderte Kost, bei Zellenarrest nur Wasser und Brot, auch keinen Strohsack mehr gab. In dieser Weise feierte ich in Montlucon das Weihnachtsfest 1916, mit einer Decke in einer eisig kalten Zelle, die unmittelbar gegenüber der auch bei Nacht offenen Haustür lag. Auf einigen Depots sind die Arrestlokale furchtbare Löcher. Leutnant Schreiber und Fähnrich Helm haben ihre [146] 30 Tage in Toulouse im Januar 1916 in der Kohlenkammer des dortigen Offizierslagers abgesessen. In Aulnat saßen die Leute in einem Keller, und zwar ohne Stroh. Als ein Amerikaner kam, wurde schnell vorher etwas Stroh hineingebracht. Die fürchterlichsten Höhlen aber sind aber die Zellen auf Fort du Murier, die hinter den Kasematten in den Wällen liegen, dort läuft das Wasser die Wände hinab, und da die Luft nur durch ein rundes Loch über der Tür Zutritt hat, das auf einen finsteren Gang hinter den Kasematten geht, so riecht es dort wie in einem Grabe. Ein Amerikaner ordnete bei seinem Besuche an, daß ein zugemauertes Fenster wieder aufgebrochen werden sollte; natürlich ist das nie geschehen. Die Unteroffiziere sollen nach der Vorschrift überhaupt nur mit Arrêt simple oder Arrêt du rigueur bestraft werden, doch daran hat man sich nie gekehrt. In Auch habe ich schon in Dunkelzelle gesessen, allerdings dort mit Strohsack, in Roanne saß ich 43 Tage in Zelle ohne Strohsack, und so wieder in Gerzat, Chagnat und Montluçon. In Roanne erhielten wir während der ganzen anderthalb Monate weder Seife noch Wäsche und sollten überhaupt nicht aus der Zelle herauskommen, obwohl das wider alle Vorschrift ist. Das alles genügte den Franzosen aber nicht, und so erfanden sie im Jahre 1916 die nicht nur körperlich empfindliche, sondern vor allem auch entehrende Strafe des Sandsacktragens, worauf ich besonders die Aufmerksamkeit der zuständigen Stellen lenken möchte. Die mit Prison Bestraften [147] bekommen einen schweren, mit Sand gefüllten Rucksack auf den Rücken und laufen damit vormittags und nachmittags je drei Stunden herum. Ich sah das zum erstenmal in Roanne an einem Sonntag; es war ein kläglicher Anblick, wie alte Landwehrleute mit grauen Bärten in dieser beschimpfenden Weise gequält wurden. In Montluçon war die Sache noch dadurch besonders lächerlich, daß man den Leuten ihre eigenen Holzkisten aufhängte. Während man aber in Montluçon und anderwärts bestrafte Unteroffiziere nur als Aufsichtführende an diesem Exerzieren teilnehmen ließ, entblödete man sich nicht, im Depot Aulnat-Gerzat z. B., sie selbst mit dieser entehrenden Strafe zu treffen. Offizierstellvertreter Josef Barth, Jäger-Bataillon 8, mußte auf dem Landkommando Ravel, wo er selber Lagerführer war, vor den Augen seiner Mannschaften mit dem Sandsack exerzieren, weil er den französischen Sergeanten aus Versehen nicht gegrüßt hatte. Er brach dabei zusammen und wurde in Arrest zurückgebracht; einige Tage später mußte er ins Hospital überführt werden, wo er mehrere Monate daniederlag. Mir selbst hatten die Franzosen das nämliche zugedacht. Nachdem ich, am 18. September 1916 entflohen, auf einer Loirebrücke wieder ergriffen worden war, wurde ich am 30. September nach Gerzat zurückgebracht. Ich sah dort schon die beiden Unteroffiziere Müllers und Otto, die ebenfalls ausgerissen waren, mit ihren Säcken auf dem Hof die Runde machen. Man brachte einen dritten Sack und befahl mir, so wie [148] ich war, mich den beiden anzuschließen. Natürlich wies ich dies entschieden zurück. Mittlerweile kam der Kommandant Morroux mit seinem Leutnant Jobert. Von meiner Weigerung sofort unterrichtet, erklärte er mir hämisch, ich würde den Sack schon tragen. Ich erwiderte ihm, ich würde mich unter keinen Umständen dieser Bestrafung unterziehen, die mit meiner Ehre als deutscher Offizier unvereinbar sei; ob er mich als Offizier anerkenne oder nicht, spiele dabei gar keine Rolle. Er drohte mir nun mit dem Kriegsgericht, worauf ich ihn um eine Unterredung unter vier Augen ersuchte. Dabei wiederholte ich ihm meine Weigerung und sagte ihm, ich wisse, wenn er mich vor ein Kriegsgericht brächte, daß ich dort verurteilt würde, er wisse aber auch, daß ich da verhört würde, und dann würde ich alles sagen, was ich von ihm wisse, z. B. auch – das hatte ich mittlerweile schon erfahren – daß er Unteroffiziere mit der Peitsche geschlagen habe. Daraufhin gab er klein bei, sehr zum Ärger des Leutnants "Hiesl", der behauptete, alle Unteroffiziere, und nur die in Offizierslägern befindlichen Offiziere nicht, seien dieser Strafe unterworfen. Hiesl hatte die Schamlosigkeit, mir nachher zu sagen, mit meiner Drohung würde ich nicht viel Glück gehabt haben: Ja, wenn er nicht auch bei der Geschichte anwesend gewesen wäre, aber er sei anwesend gewesen, das sei ja gar keine Mißhandlung gewesen, sondern eine Liebkosung! Der Kommandant ließ aber doch sofort die beiden Unteroffiziere holen und fragte sie begütigend, es [149] habe doch nicht sehr weh getan. Die wackeren Burschen antworteten ihm, erstens habe es wohl weh getan und zweitens komme es ihnen darauf gar nicht an, sondern auf die Beschimpfung. Eine unauslöschliche Schande für die französische Regierung ist endlich die gegen alle Sittlichkeit und gegen alles Recht verstoßende Beeinflussung der in ihrer Gewalt befindlichen deutschen Kriegsgefangenen durch Presseerzeugnisse, die die Leute gegen die heimischen Obrigkeiten und Staatseinrichtungen aufhetzen und unsern Staat und unser Heer, den Kaiser und unsere Fürsten, unsere Geschichte sowie unser Volk selber, kurz alles, was uns heilig ist, in den Schmutz ziehen. Von der seit Ende 1914 erscheinenden Zeitung für die deutschen Kriegsgefangenen werden ja genügend Nummern in den Händen unserer Regierung sein. Weit höher in bezug auf die Abfassung als dieses läppische Schmutzblatt steht das "bulletin d'alliance franâaise", nach dem Titelkopf gegründet zur Verbreitung französischer Sprache und Zivilisation, das sich aber jetzt mit den Ursachen des Krieges, den von den Deutschen verübten Grausamkeiten und mit unserer greuelvollen Kriegführung beschäftigt. Das Blatt wird zur Beeinflussung der Neutralen in sämtliche europäische Kultursprachen übersetzt, für die deutschen Kriegsgefangenen auch ins Deutsche. Seit Mitte 1916 allerdings gibt die französische Regierung ein Beiblatt zur Kriegsgefangenenzeitung heraus, bei dem die Übertreibung einen Fehlschlag zur Folge haben mußte. [150] Dieses Blatt trägt am Kopf, umgeben von den deutschen Farben, einen ins Breite verzerrten deutschen Reichsadler und rechts und links als Motto die Worte: Durchhalten! Durchleiden! Durchhungern! Durchmorden!"
 In der Denkschrift Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland. Amtliches Material. Frankreich fanden sich bei den Berichten über die Läger Roanne, Aulnat, Gerzat-Chagnat ebenfalls die Namen der Franzosen Kommandant Morroux, Leutnant Jaubert, der hier als ein ehemaliger Pariser Kriminalbeamter bezeichnet wird, Leutnant Tailletard, Adjutant Marschall und weitere, nebst einer ausführlichen Schilderung ihrer Unterschlagungen, Mißhandlungen und sonstigen Schurkereien an den deutschen Kriegsgefangenen. Wir wollen nun sehen, dem Gutachten des Geheimrats Meurer folgend, wie die Unterkunft in den anderen Lägern war, von der das Régime ja behauptete, es seien überall Kasernen gewesen und man habe auf Komfort gesehen. Cahen-Salvador, der es als ehemaliger Leiter des Kriegsgefangenenwesens in Frankreich ja wissen mußte, behauptete an einer Stelle seines Buches, daß für die Strohsäcke der Kriegsgefangenen je fünf Kilo Stroh vorgesehen gewesen seien, die alle 14 Tage erneuert wurden! Das Gutachten sagte dazu: "Ganz allgemein war der seltene Wechsel des Strohs in den Strohsäcken; es kam vor, daß das Stroh ein ganzes Jahr lang nicht erneuert wurde, häufig lagen die Strohsäcke auf dem bloßen Steinfußboden oder auf feuchtem Untergrund, so daß sie anfaulten." Wo [151] ist das Stroh geblieben? Das Geld dafür ist in die Taschen der Kommandanten und Unternehmer gewandert! In einem Detachement von Caen bei der Société Normande de Metallurgie war die Unterbringung in einer alten niedrigen Baracke so schlecht, daß eine Schweizer Kommission den Abtransport der Gefangenen anregte, wenn nicht Wandel geschaffen würde. Monate später war aber noch nichts geändert. In Carpiagne waren die Gefangenen im September 1915 noch in Zelten untergebracht. Die deutsche Regierung forderte heizbare Baracken, worauf die französische Regierung antwortete, die Gefangenen seien hier nicht in Zelten, sondern in Baracken untergebracht. Der Übelstand wurde also beseitigt und dann abgeleugnet. In der alten Kaserne in Clermont-Ferrand lagen die Gefangenen monatelang zu je 50 Mann in einer Stube auf losem Stroh, Verwundete und Gesunde in dicht gedrängten Reihen ohne Zwischenraum. Das Barackenlager bestand aus dünnen Bretterbaracken mit Zementfußboden und schadhaftem Dach. In St. Genest-Lerpt wurden die durch die neutralen Besucher gewünschten Ausbesserungsarbeiten in einer ehemaligen Besserungsanstalt nach dreieinhalbjähriger Belegung endlich vollendet. Für Le Havre wurde die Überfüllung des Lagers durch den amerikanischen Berichterstatter bestätigt. Tische und Bänke gab es hier nicht, selbstgemachte wurden weggenommen. Heizung gab es bis 5. November 1916 im Schlachthof bei Le Havre überhaupt nicht; als [152] dann geheizt wurde, war es nach Ansicht der amerikanischen Besucher durchaus ungenügend. In La Lande waren die Unterkunftsräume auf einem Heuboden so niedrig, daß man nur in gebückter Stellung gehen konnte; Wassermangel herrschte hier auch; zum Wäschewaschen mußten die Gefangenen hier Regenwasser nehmen; als dann im Sommer 1916 kein Regen fiel, konnte nicht gewaschen werden. Im November 1918 war die geforderte Pumpenanlage noch immer nicht eingetroffen. In St. Nazaire waren baufällige und wasserdurchlässige Baracken mit Holzfußboden, der überall durchgefault und morsch war. Am 18. Dezember 1915 protestierte die französische Regierung entrüstet gegen die deutsche "unwahre" Behauptung vom 1. Dezember 1915, daß die Gefangenen bei so vorgerückter Jahreszeit in La Pallice noch in Zelten wohnen müßten, protestierte auch gegen die Art, mit der sich die deutsche Regierung zum Echo falscher Behauptungen mache. Alle Kriegsgefangenen seien in Baracken untergebracht. Ein späterer Bericht des Regionskommandanten gab aber zu, daß erst im Laufe des Dezember, also nach Absendung der deutschen Note, die Mitte November bei einem Sturm fortgewehten Zelte durch Baracken ersetzt worden seien. In Monistrol sur Allier war die Unterkunft so feucht, daß die Pritschen schimmelig wurden. Die Unterbringung in allen sechs Lagern in und bei Rouen war schlecht und gab mehrfach Anlaß zu deutschen Protesten. Der Schweizer Bericht vom 9. Juli 1917 nannte die Ver- [153] hältnisse in dem Krankenlager St. Aubin-Epinay "un peu défavorables". Die Säle seien schlecht erleuchtet, feucht und kalt, die Betten sehr primitiv usw. Die Unterkunftsräume in den Kasematten von Sennecy waren dumpfig, feucht und ungesund, meist waren sie überlegt; dies fiel noch im Oktober 1918 dem Schweizer Delegierten auf. "Dieses Lager (Sennecy) war nach eigener Aussage des Lagerkommandanten ein Straflager. Der Lagerkommandant war ein französischer Leutnant, welcher infolge einer Verwundung am rechten Fuß einige Zehen verloren hatte; er äußerte sich uns gegenüber, daß er diese von den Deutschen erlittene Verwundung an den ihm unterstellten Gefangenen nunmehr rächen werde. Unsere Unterkunft bilden Holzbaracken ohne Fußboden, unsere Lagerstätten Holzpritschen mit Strohsäcken. Ende Oktober stand bereits das Lager, einschließlich der Baracken, 20 Zentimeter unter Wasser. Nach eintretendem Frost erkrankten eine große Anzahl der Gefangenen. Frostschäden an Händen und Füßen in den feuchten Baracken infolge Verweigerung von Öfen und Brennmaterial waren die täglichen Erscheinungen. Leute, die sich deshalb krank meldeten, wurden vom Arzt ständig gesund und arbeitsfähig geschrieben, obgleich die überwiegende Mehrzahl der sich krank Meldenden nicht in der Lage war, auch nur die geringste Arbeit zu verrichten." In Serres-Carpentras waren die Baracken äußerst undicht und schadhaft, sie wurden von einem [154] inspizierenden General selbst als "irréparables" bezeichnet. Bei Regen mußten die Gefangenen aufstehen und sich einen anderen Platz suchen. In Toulon waren 450 Kriegsgefangene im Zwischendeck des Kreuzers "Cécile" untergebracht. Für 500 Mann, die größtenteils schmutzige Kohlenarbeit verrichten mußten, war ein Waschtrog von 20 Meter Länge vorgesehen. Bei Villegusien erfolgte die Unterbringung anfangs auf Kähnen auf der Marne, bis die deutsche Regierung Verwahrung dagegen einlegte. Die Unterbringung erfolgte überhaupt vielfach in Laderäumen von Schiffen und Schleppkähnen, die licht- und luftlos, feucht und voll Ungeziefer waren. Die Ungezieferplage herrschte allgemein; Fenster gab es häufig überhaupt nicht und wurden dann durch Leinwand, Papier und dergleichen ersetzt oder mit Brettern vernagelt und zugeschraubt. Die Waschgelegenheiten waren oft dürftig, primitiv und unzureichend; in der alten Kaserne zu Clermont-Ferrand gab es für 1000 Mann zwei Wasserkrähne, in Candor für 13 000 Mann zwei Pumpen. Lange Zeit wurden die Gefangenen vielfach in Zelten untergebracht, in der Armeezone in offenen Pferchen. Die Aborte reichten nicht aus, waren meist äußerst primitiv eingerichtet; nachts war es fast allgemein üblich, offene Abortkübel in die Schlafräume zu stellen, ohne Rücksicht auf die Ruhrkranken. In den französischen Lägern blieb man hinter den untersten Stufen der Einfachheit zurück; in der Hygiene und Reinlichkeit vor allem waren die französischen [155] Verhältnisse vollkommen unerträglich. Für die in Deutschland großzügig durchgeführten Anlagen von Spielplätzen, Theater- und Unterhaltungsräumen hatte man in Frankreich kein Verständnis. Sie wurden erst im Jahre 1919 kurz vor der Heimkehr von den "Prisonniers" selbst eingerichtet. Ein ganzes Kapitel nahm in dem Gutachten auch die Ernährungsfrage ein. Wie ein roter Faden zogen sich durch die ganzen Berichte die Klage über den Fraß in Frankreich, über die Würmerbohnen, die Steinelinsen, den madigen Reis, das verschimmelte und harte Brot, über stinkendes Fleisch von abgetriebenen kranken Tieren, Pferden, Eseln, Rindern, denen oft der Eiter aus Geschwüren troff; über die ekelhafte Art der Zubereitung. In Candor wurden die Kartoffeln mitsamt der Schale in die Suppe gestampft. Die Verwalter von Proviantämtern freuten sich, wenn sie alte, schlecht gewordene Vorräte an Kriegsgefangenenkompanien abstoßen konnten. Eine unglaubliche Korruption herrschte gerade auf dem Gebiet der Kriegsgefangenenverwaltung in Frankreich. Unternehmer und Kommandanten, bis in hohe Stellungen hinauf, füllten sich die Taschen. Wie ein blutiger Hohn mutete es einem an, wenn man die entrüsteten Noten der französischen Regierung las, als Deutschland, durch die Blockade gezwungen, die Rationen der fremden Kriegsgefangenen ebenso wie die für die eigenen Soldaten herabsetzen mußte – als ob jemals in Frankreich nur ein einziges Lager existiert hätte, in dem die deutschen Kriegsgefan- [156] genen ihr volles Recht auf Ernährung bekommen haben! Im Lager Montauban gab es schon in den ersten Kriegswochen vereitertes Pferdefleisch! Dabei wurde auch allgemein jede willkommene Gelegenheit benutzt, um den Gefangenen das bißchen Essen noch abzuziehen; bei zu geringer Arbeitsleistung, bei Vergehen der kleinsten Arreststrafen gab es weniger oder gar kein Essen. Die deutsche Bestrafung Arrest bei Wasser und Brot wurde von den Franzosen gern übernommen, aber statt wie bei uns nur auf drei Tage gleich auf acht, vierzehn Tage, ja auf Wochen verhängt. In Candor wurde einem ganzen Arbeitszug von hundert Mann an einem Tage das Brot entzogen; das war dort an der Tagesordnung – für den Kommandanten ein guter Nebenverdienst! Das System war obendrein so, daß es nach der Gefangennahme drei Tage lang nichts zu essen und zu trinken gab, dabei aber den Gefangenen große Marschleistungen zugemutet wurden. Danach kam das sogenannte Hungerlager, in dem es eine Verpflegung ab, von der ein Mensch so eben existieren kann (in dem Hungerlager Breteuil gab es täglich ein walnußgroßes Stückchen Fleisch, dazu einen halben Trinkbecher voll Suppe und Brot so viel wie drei Kaffeebrötchen). Von dieser täglichen Hungerration mußten die Gefangenen drei, vier, fünf Wochen lang leben. Die Hungerläger waren auch meistens Pferche unter freiem Himmel; wer sie überstand, ohne krank zu werden, hatte schon etwas gewonnen. [157] Wer sich in La Pallice weigerte, seine Briefe auf Bogen zu schreiben, auf deren Kopf ein den Tatsachen nicht entsprechender Speisezettel stand, wurde eingesperrt. In Château d'Oléron wurde den Leuten drei Monate lang das Fett entzogen; es sollte nachgeliefert werden. Der Kommandant lehnte das aber dann ab mit den Worten: "Die Gefangenen leben ja noch!" Ein französischer Arzt, der sich in Clermont-Ferrand für die Erhöhung der Nahrung einsetzte, wurde abgelöst. In Carpiagne mußten sie ihre Mahlzeit stehend im Hof einnehmen. Auf deutschen Protest behauptete die französische Regierung, das täten die Gefangenen aus freien Stücken, der milden Temperatur wegen. In einem Lager gab es zweiundsiebenzigmal hintereinander Nudeln, in Poitiers vier Wochen lag täglich eine Suppe von roten Bohnen, auf der eine Schicht schwarzer Käfer schwamm, in Candor und vielen anderen Lägern kannte man überhaupt nur Reis. Skorbut, Nachtblindheit und Reiskrankheit wie auch Ruhr waren die Folge. Auch den Mangel an Stuhlgang überhaupt erwähnen viele Gefangene in ihren Berichten. Acht, zehn, zwölf Tage, ja in einem Falle drei Wochen kein Stuhlgang war nichts seltenes. Im Brot fand sich oft Sand, Unrat, Kautabak, Zigarrenasche und Stroh, im Fleisch Tieraugen, Mäuse, Darmstücke mit Kot und dergleichen.
 Ich entnehme dem Buche Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland. Amtliches Material. Frankreich noch folgende Berichte über einige Läger: [158] Le Havre: Le Havre weist in besonders augenfälliger Weise alle Mängel und Härten auf, die den französischen Hafenlagern, insbesondere denen der III. Region, eigen sind. Die drei selbständigen Läger Jemappes, Pont VII und Abattoire sind im folgenden gemeinsam behandelt. 1. Die Arbeit ist schwere Hafenarbeit. Es wird vor allem Kohle und Eisen verladen, die Leute müssen Säcke von zwei Zentner Gewicht schleppen. Dabei wird keine Rücksicht auf Stand und Körperbeschaffenheit genommen. Auch Schwerverwundete und Krüppel werden zu dieser Arbeit gezwungen. 2. Die Arbeitszeit beträgt häufig über elf Stunden, gelegentlich bis 18 Stunden. Die Kriegsgefangenen müssen zwei Stunden länger arbeiten als die Zivilisten. Als Arbeitsverweigerungen unter Berufung auf die Berner Vereinbarungen vorkamen, wurden sie vom Unterstaatssekretär verboten. Die Leute müssen oft schon zwei Stunden vor der Arbeit zum Ausrücken antreten. Besonders hart ist die Nachtarbeit, zumal den Gefangenen eine warme Mahlzeit beim Einrücken des Morgens verweigert wird. 3. Infolge mangelhafter Beleuchtung und Schutzvorrichtungen gibt es viele Unglücksfälle auf den Arbeitsstellen (folgen Beispiele). 4. Die Unterbringungsverhältnisse sind unzulänglich und gesundheitsschädlich. Überall liegen die Leute eng zusammengepfercht. Die Baracken sind undicht; die Fenster bestehen aus schmutziger [159] Leinwand. Kohlen werden nicht oder viel zu wenig geliefert. Als sich ein Mann beschwert, daß er keine Unterhose habe, antwortet der Kommandant laut Schweizer Bericht dem Beschwerdesteller: "Unterhosen werden nicht geliefert, sind aber erlaubt." Das Stroh wird einmal ein Jahr lang nicht erneuert. Der Kommandant sagt zu dem Schweizer Delegierten, die Gefangenen hätten den Inhalt ihrer Strohsäcke draußen zu lüften, wobei viel Stroh verloren ginge. Von Mitte Februar 1916 an liegen 700, später 4000 Kriegsgefangene in undichten, unerträglich kalten Zelten. Erst im Mai werden die ersten Baracken fertig. 800 Mann waren an Bord der Schiffe "Phryne" und "Lloyd" untergebracht, in licht- und luftlosen ungeheizten Räumen, die von Ratten und Mäusen wimmelten. Für 200 Mann gab es einen Abtritt. Der amerikanische Bericht betont: "Alles ist eng und schmutzig; die Gefangenen sind hier sozusagen in strenger Haft." Der Bericht über Pont VII-Jemappes gibt das bekannte Bild von den primitiven Abortverhältnissen. Dann kommen Klagen über die sanitären Verhältnisse. Deutsche Soldaten sterben durch die zynische Nachlässigkeit und die brutale Behandlung des Arztes. Verbandszeug gibts überhaupt nicht, oder es wird gebrauchtes, schon vereitertes geliefert. An der Ruhrepidemie auf dem Schiffe "Phryne" sterben viele Gefangene. In Tréfileries und Jemappes darf sich nur ein bestimmter Prozentsatz krank melden; weitere werden bestraft. [160] Mit Arreststrafen werden belegt, wer sich krank meldet und nicht für krank befunden wird, außerdem wer sich beschwert. Die geringsten Verfehlungen tragen 30tägige Arreststrafen ein. In Abbattoir werden innerhalb 84 Tagen 9910 Tage Arreststrafen verhängt. Beschwerden werden häufig beantwortet: "Geht zu eurem Kaiser!" Vizefeldwebel Franke, Berlin, erhält wegen mehrfacher Beschwerden 100 Tage Arrest. Dazu kommt das Tragen von Sandsäcken. Der Schweizer Kommission erklärt der Oberleutnant Toussard, daß die Sandsäcke schon seit acht Tagen abgeschafft seien, zwei Tage nach dem Besuch werden sie dann aber wieder gefüllt. Pakete werden oft zwei Monate zurückgehalten, der Inhalt der Pakete wurde eine Zeitlang verbrannt. Der französische Sergeant Steigelmann durchwühlt fast täglich die Sachen der Kriegsgefangenen und tritt auf ihnen herum. Der Hafenkommandant von Le Havre sagt zu den Kriegsgefangenen in einer Ansprache: "Es ist mein äußerstes Bestreben, die Kriegsgefangenen körperlich und moralisch zugrunde zu richten." Der Sergeant Steigelmann erklärte: "Wir wollen euch wie Schweine behandeln." Auch körperliche Mißhandlungen kommen vor. Wie verbitternd die Verhältnisse in Le Havre auf die deutschen Gefangenen wirkten, zeigt die Tatsache, daß sie einmal zwei Monate lang sich weigerten, Briefe und Karten nach der Heimat zu schreiben, um auf diese Weise die deutsche Regierung auf ihre Leiden aufmerksam zu machen. Unter der Einwirkung der schlechten Behandlung sind irrsinnig [161] geworden: Unteroffizier v. d. Lühe, Soldat Fritz Bergmann und Karl Stein; Soldat Bietreck machte einen Selbstmordversuch durch Erhängen. Der Kriegsgefangene August Dietrich, Inf.-Regt. 85, erhängt sich, weil er wiederholt ungerechterweise eingesperrt und geschlagen worden ist. Das Buch Deutsche Kriegsgefangene in Feindesland. Amtliches Material. Frankreich brachte dann noch weitere Berichte über andere Läger, wie Caen, Carpiagne, Chatillon le Duc, Clermont-Ferrand, Bouthéon, Dinan, Etampes, St. Gerzat-Lerpt, La Lande mit Bergerac, St. Nazaire, La Pallice, Riom, Sennecy, Serres-Carpentras, Toulon, Fort Varois, Villegusien – erschütternde Beispiele moderner Sklaverei aus einem Lande, das sich seiner humanen Gesinnung rühmt!
 Das Lager Souilly: Eines der grauenhaftesten Läger war das Lager Souilly hinter Verdun, auch "Kronprinzenlager" genannt. Hier sahen sich die deutschen Soldaten nach ihren schweren Kämpfen in der Hölle von Verdun in eine zweite Hölle versetzt, die jener anderen in nichts nachstand. Jede ritterlich denkende Nation hätte solche tapferen Krieger in der Gefangenschaft mit Ehren behandelt; die Niedertracht französischen Wesens ließ das aber nicht zu; die zu Tode erschöpften deutschen Kriegsgefangenen, die von Verdun eingebracht wurden, peinigte und marterte man hier, sperrte sie in einen Schlammpferch unter freiem Himmel, gab ihnen tagelang nichts zu essen, und wenn sie dann einen recht kläglichen Eindruck machten, kamen französische Etappenhelden und Pariser Zivilisten mit [162] ihrem weiblichen Anhang ans Lager und knipsten und filmten sie, am liebsten dann, wenn sich die Gefangenen in ihrem rasenden Hunger auf ein paar über den Zaun geworfene Brotbrocken stürzten. Souilly bleibt eine ewige Schande für die französische Nation. Man erzählte den deutschen Kriegsgefangenen vielfach, das Lager sei eingerichtet zur "Strafe" für den Angriff der Deutschen auf Verdun. Als das Lager eingerichtet wurde, erklärte ein französischer Lagerkommandant weit hinter der Front seinen Kriegsgefangenen: "Man wird euch von heute ab nur die halbe Ration geben – wegen Verdun!"
 Souilly. Von K. Wallbaum, Detmold. R.I.R., 118, I. (Aus der Artikelserie: "Lipper hinter Stacheldraht" der Lippischen Landeszeitung.) "O Souilly, dich vergeß ich nie! – Im freien Felde auf einem Stück Ackerland, von vier Drahtwänden umgeben, 10 Posten bewacht und vier Maschinengewehren in Räson gehalten und zwei Scheinwerfern beleuchtet, so lagen wir unter freiem Himmel. Es regnete unaufhörlich, unsere Lage verschlimmerte sich stündlich. Da weder Sitzgelegenheit noch solche zum Hinlegen war, mußten wir die ganze Nacht stehen. Mit großer Sehnsucht erwarteten wir den andern Tag, von dem wir uns Besserung unseres Loses versprachen. Endlich, um die fünfte Morgenstunde, ertönten die Hörner der Franzosen zur Reveille. Nach dem Appell erfolgte die Aufnahme der Personalien, das Verhör durch den französischen Offizier und die Abgabe aller Gegenstände, wie Brieftasche, Geldbehälter nebst Inhalt, Verbandpäckchen, Bleistift, [163] selbst die harmlosesten Photographien; man mußte die Taschen geradezu umwenden und wurde dann davongejagt. Was man mir ließ, war gerade ein Löffel, und von diesem brach man noch den Stiel ab... Wieder wurde es Nacht und wieder standen wir frierend, hungernd, durstend unter freiem Himmel. Wir hatten kaum noch so viel Kraft, uns auf den Beinen zu halten. Aber auch die Nacht verging. Nach dem Wecken gab es einen Viertel Liter Kaffee. Da aber keiner der Gefangenen einen Becher sein eigen nannte, bekamen die meisten keinen, nur etliche, die sich zu helfen wußten und den Trunk in der Feldmütze auffingen. Sofort gings an die Arbeit, in die Steinbrüche, an die Munitionszüge und an die Lagerschuppen. Mit Verzweiflung wurden die letzten Kräfte verausgabt, hoffte man doch auf diese Weise ein Stück Brot zu bekommen. Hin und wieder traf man auch einmal eine mitleidige Franzosenseele, aber meist lohnte die Peitsche oder ein Fußtritt die geleistete Fronarbeit. Immer wieder brach eine neue Schreckensnacht an. Das Geschrei nach Wasser war besonders groß, aber man versagte uns den Trunk. Ich bin dann dem Beispiele vieler Kameraden gefolgt und habe die Regentropfen vom Stacheldrahtzaun geleckt, um meine Zunge zu kühlen. Am vierten oder fünften Tage ließ das Denken nach, viele redeten irre. Ich sah einen Kameraden, der sich vollständig entblößte und sich dann in den Schmutz legte. Alle Vorstellungen, er würde erfrieren, nutzten nichts; er glaubte, er sei daheim, sprach im Wahn mit Vater [164] und Mutter, beantwortete ihre Fragen selbst. Am andern Morgen stand er nicht mehr auf... Ein anderer sprang mit fiebernden Worten auf einen Posten zu und rief: 'Gib mir Wasser, gib mir Wasser, oder ich verdurste!' Der Franzose verstand nicht, was er wollte, sah nur die geballten Fäuste und geriet in Angst; ein kräftiger Schlag mit dem Kolben, und unserm Kameraden war der Durst vergangen. Wir haben uns des Nachts immer mit etlichen Landsleuten von der Kompanie auf einen Haufen gestellt und uns fest umschlungen. Eine Nacht habe ich es dann auch nicht mehr ausgehalten, im Stehen zu schlafen, und habe mich in den Dreck gelegt. Eines Mittags mußten wir antreten, auch die Kranken und Verwundeten. Wir dachten, wir kämen fort. Man stellte unsere Offiziere an unsere Spitze und führte uns ab. Als wir in die Dorfstraße einbogen, wurde die uns begleitende Kavallerie noch durch Infanterie verstärkt. Die Straßen waren von Zivilisten und Soldaten eingesäumt; man veranstaltete einen Triumphzug mit uns! Auf dem Marktplatz stand nämlich ein Filmoperateur, der unseren Zug kurbelte, und wir mußten im strammen Schritt daran vorübermarschieren, konnten uns dabei kaum noch auf den Beinen halten. Ich weinte vor Wut – und wohl ich nicht allein –, als wir danach ins Lager zurückgeführt wurden. Nach acht Tagen waren wir nur noch wankende und schwankende, mit Kot und Dreck besudelte Lebewesen..."
 [165] Erich Brabant, Barby (Elbe), Gefreiter im Reserve-Infanterie-Regiment 20: "So ging es weiter bis spät abends, wo wir unser Ziel erreichten (Verfasser ist bei Verdun verwundet in Gefangenschaft geraten). Souilly, der Name, der mir und allen denen, die dort waren, nie aus dem Gedächtnis kommen wird. Auch hier nur ein großer Drahtverhau, nur der Himmel als Dach darüber. Unser Verlangen nach Brot und Wasser blieb unberücksichtigt. Nachts regnete es wieder, aber das war uns angenehm, da wir so unsern Durst stillen konnten. Vor Ermattung haben wir trotz des Regens geschlafen. Gegen Mittag am andern Tag gab es pro Kopf zwei Zwiebäcke, nachmittags mußten wir antreten, Personalaufnahme. Als ich zum Verhör dran kam, hieß es stramm stehen, da mir aber mein Koppel gestohlen war, womit ich meine Hose hielt, konnte ich die Hände nicht aus den Taschen nehmen, da ja sonst die Hose rutschte; da ich mich widersetzte, gab's einen mit der Reitpeitsche, beim Taschenuntersuchen war bei mir nichts; als ich sagte, es ist mir alles gestohlen, gab's wieder welche mit der Peitsche, und ich wurde abgeführt, vier Tage Prison. Ein starker Drahtverhau war vor dem Lager mit Brettern verkleidet, ohne Dach, etwa zwei mal zwei Meter groß, aber meinen andern Kameraden ging's auch nicht besser, lagen ja auch unter freiem Himmel. Nur die Elsässer und Polen lagen in einer Baracke. Die Verpflegung blieb so, morgens wurde Wasser in das Lager gefahren, mittags gab's zwei Zwiebäcke. Ich hatte noch zwei Kollegen bekommen, [166] so daß wir nun mit drei Mann in dem Loch lagen, wir mußten die Baracken reinigen für die Bewachung, wobei es vom Korporal welche mit der Peitsche gab, weil es ihm nicht schnell genug ging. Es waren Tage der Hölle, Hunger, daß wir uns nicht auf den Beinen halten konnten, fast jede Nacht Regen, unsere Kleidung wurde kaum trocken, an Schlaf war nicht zu denken, da man nachts vor Kälte und Nässe fror. Wir sahen aus wie die Schweine, da wir auf dem nassen Lehmboden lagen, kein Mantel, keine Decke, an Waschen war schon gar nicht zu denken, seit drei Wochen nicht rasiert, dazu halb verhungert, eine Latrine gab's hier auch nicht, aber wir hatten ja auch keinen Bedarf, hatten nichts im Magen. Meine Zeit im Prison war um, ich kam wieder zu meinen Leidensgenossen, allerdings war es ja hier auch nicht besser, alle sahen verwildert aus, schmutzig, zerrissen, die Haut wie Leder. Hunger, Hunger, Hunger. In diesem Zustand wurden wir als Schauobjekte hingestellt, seit Tagen kamen Zivilisten und Militärs, um uns anzuschauen. Zum großen Teil englische und französische Offiziere mit Anhang. Selbstverständlich durfte der Knipsapparat nicht fehlen. Eine besondere Freude machten sich diese Herren daraus, sie stellten ihren Apparat ein, nahmen Brot, auch Schokolade, zerbrachen dieses, warfen es über den Drahtverhau, und in dem Moment, wo sich alles auf diese Kostbarkeiten stürzte, wurde geknipst. Unzählige solcher Aufnahmen sind in den Tagen gemacht worden. Gegen Brot, gegen [167] Tabak oder Schokolade tauschten wir auch unsere Habseligkeiten aus, wie Koppel, Knöpfe, Achselklappen, selbst Eheringe. Die Tage verschlichen, früh mußten wir den Faßwagen füllen, einen Teil bekamen die Franzosen, den Rest wir. Am Tage lagen wir rum, trockneten unsere Klotten und lausten uns, und das Schauspiel vorm Draht ging dabei weiter, die Leute machten ihre Aufnahmen, ob wir nun entblößt dalagen oder saßen oder schliefen, es wurde geknipst. Schrecklich war es für uns, daß es jede Nacht regnete, so blieb es auch nicht aus, daß jeden Tag mehr Kameraden umklappten, selbstverständlich vor Hunger mit. Nachts wanderte immer alles von einem Ende zum andern, um sich warm zu halten. Zwar machten die Posten ständig Krach, gaben Schreckschüsse ab oder stießen mit dem Bajonett durch den Drahtverhau, aber das störte uns nicht, wir waren ja so stumpfsinnig und dickköpfig geworden, schlechter konnte es uns doch nicht mehr gehen. Die Kranken wurden täglich mehr, wurden jeden Tag herausgeschleppt, lagen dann vor dem Drahtverhau herum und wurden dann auf einigen Wagen weggeschafft. Meine Verwundung wurde jeden zweiten Tag nachgesehen, aber da sie nur mit Jodtinktur behandelt wurde, wandte ich mein bestes Mittel selber an: Nachts beim Regen hielt ich den Arm so, daß die Wunde ausgespült wurde, und am Tage ließ ich die Sonne darauf scheinen. Unter diesen Verhältnissen lebten wir etwa drei Wochen. Souilly wird mir stets im Gedächtnis bleiben..."
 [168] Offizier-Stellvertreter Mehling (Aus dem Buche In französischer Gefangenschaft, herausgegeben von R. S. Waldstätter): "Im Strafgefangenenlager Souilly... Zu essen gab es hier nichts. Ich schlief die Nacht zwischen den Offizieren auf einem Strohsack ganz gut, aber die armen Soldaten mußten die ganze Nacht unter freiem Himmel im strömenden Regen auf einem Ackerfelde zubringen, welches nach wenigen Stunden in ein Schlammfeld verwandelt war. Das Lager hatte höchstens für 800 Mann Platz, es waren aber 2308 Mann dort untergebracht. Es war geradezu haarsträubend, wie die armen Soldaten tagelang im Regen und Wind ohne jeglichen Schutz gegen Kälte und Frost in zum Teil zerrissener Kleidung, viele ohne Schuhwerk, dort zubringen mußten. Am 17. Dezember gab es zum erstenmal etwas Warmes, einen Trinkbecher Kaffee... Nach der Untersuchung wurden wir in eine andere Baracke gebracht, wo es keinen Strohsack mehr gab, auch war der Raum so eng, daß die meisten sich nicht hinlegen konnten, obwohl sich alles eng aneinanderquetschte. Das Gefangenenlager Souilly war durch eine Straße in zwei Abschnitte, von denen jeder für sich eingezäunt war, eingeteilt. In dem Gang stand bei Tage alle 30 bis 40 Meter ein Posten, nachts waren dieselben verdoppelt. Über das Hindernis hinwegzukommen, war unmöglich. An geeigneten Stellen des Lagers waren mehrere Maschinengewehre aufgestellt, daß das ganze Lager damit unter Feuer ge- [169] halten werden konnte, falls einmal eine Revolte ausbrechen sollte. Der Abschnitt rechts der Straße war durch Stacheldrahtzäune so in kleinere Vierecke eingeteilt, daß in jedem Viereck etwa 200–300 Mann eng aneinandergedrängt Platz hatten. In diesen Pferchen, wie wir sie nannten, mußten aber ungefähr 800 Mann ohne Sitz- und Liegegelegenheit 6–8 Tage unter freiem Himmel zubringen. Der Boden, ein Ackerfeld, war bereits am zweiten Tage grundlos, so daß die armen Soldaten bis zu den Knien im Wasser und Schlamm stehen mußten. Ungefähr die Hälfte dieser Leute erfroren die Füße, die meisten hatten Blutdurchfall und Fieber, und viele wurden wahnsinnig. Ein Mann wurde niedergeschossen, weil er versuchte, aus einer Wasserpfütze außerhalb des Drahtzaunes zu trinken. Dem tapferen französischen Soldaten, der diese Heldentat vollbracht hatte, drückte der Lagerkommandant die Hand und sprach ihm sein Lob aus. Ein anderer Gefangener, der infolge der ausgestandenen Leiden wahnsinnig geworden war, in seinem Wahn auf den Posten zulief und irgendetwas lallte, wurde von diesem niedergestochen. Dem Unteroffizier Bornefeld vom Funken- und Telegraphentrupp I passierte folgendes: Ein Gefangener brach infolge der ausgestandenen Leiden und Entbehrungen bewußtlos zusammen und lag, Schaum vor dem Munde, im Schlamm. Bornefeld legte den Mann, so gut es ging, aufs Trockene und ersuchte [170] den Posten, für den Bewußtlosen etwas Wasser zu besorgen. Dieser hatte als Antwort nur ein kurzes, bissiges 'Non'. Dann bat er ihn, doch wenigstens zu gestatten, daß er aus einer Pfütze, fünf Schritte vor der Baracke, etwas Eis holen dürfe. Als Antwort wieder ein kurzes 'Non'. So lag nun der arme Mensch mehrere Stunden, dann starb er. Auf ähnliche Weise sind in der Zeit vom 15. Dezember bis 5. Januar 26 Menschen buchstäblich im Dreck verreckt. In den Weihnachtstagen war ich oft nahezu am Verzweifeln. Gerade am ersten Weihnachtstage wurden wir ganz scheußlich behandelt..."
 Der Fliegerleutnant Herbert Lippe, der nach einem Luftkampf über Verdun abgeschossen wurde und, zwischen der ersten und zweiten französischen Linie niederfallend, schwer verwundet in Gefangenschaft geriet, erzählt in seinem Buche Doppelt wehrlos folgendes über Souilly: "... da trat aber aus der Tür ein General, sah mich prüfend an und rief: 'Ah voilà un officier boche, même un aviateur!' Er gab Anweisung, mich nicht in das Arbeitszimmer, sondern in den Holzverschlag auf dem Hofe zu bringen. Ich wurde dort auf einige leere Holzkisten gelegt. Ich fiel in einen kurzen, unruhigen Schlaf, aus dem ich geweckt wurde, um zum Verhör geführt zu werden. Ich beantwortete die Fragen nach Alter usw., als man dann weiter in mich drang, wurde ich ziemlich deutlich und verlor in der Erregung das Bewußtsein. [171] Als ich erwachte, lag ich draußen in der Sonne, ein Arzt fühlte meinen Puls und sagte: 'Es geht besser, man kann fortfahren, ihn zu verhören.' Ich lag in einem Kreis von mindestens 20 Offizieren, vom General bis zum Leutnant. Man wollte gesprächsweise alles Wissenswerte aus mir herauslocken, zuerst war man höflich, selbst liebenswürdig; als alles erfolglos war, wurde man unhöflich und sprach laut von dem Boche und anderes mehr. Ein Major sagte: 'Sie haben in St. Ménehould mit Ihren Fliegerbomben Frauen und Kinder getötet, pfui, schämen Sie sich!' Ich antwortete, Zivilisten gehörten nicht in das besetzte Gebiet. Da rief ein anderer Oberst aus dem ersten Stockwerk nach mir. Man stützte mich und führte mich zu ihm. Er legte mir ein Album vor: 'Sehen Sie dieses Buch mit den Fliegerphotographien. Sagen Sie ehrlich, sind die deutschen Fliegeraufnahmen besser?' Ich bat darum, mir die Antwort zu erlassen. Er drang in mich, da gab ich ehrlich zu, daß die deutschen Aufnahmen wesentlich besser seien. Der Oberst sagte: 'Sie sind der typische preußische Offizier!' – – Ein jüngerer Offizier trat zu mir und besah sich eingehend meinen Brillantring. Er sagte: 'Monsieur, Sie haben doch kein französisches Geld, dessen Sie bedürfen, geben Sie mir Ihren Ring für 50 Francs!' Meine erstaunten Augen waren dem Herrn Antwort genug... Ein Oberleutnant riß gerade von meiner Lederjacke die Achselstücke herab, ich erhob empört Widerspruch, doch er steckte sie ein und sagte hohnlächelnd: 'Sie sind [172] leidend, mein Herr, erregen Sie sich nicht unnötig, Sie sind mein Gefangener...' Nachmittags gegen 5 Uhr 30 Minuten kamen wir in Souilly an. Souilly ist ein größeres Dorf, ungefähr 11 Kilometer hinter der Verdunfront gelegen. Ein Gendarmeriesergeant, ein wahrer Hüne von Gestalt, empfing mich... sein Benehmen war noch roher wie sein Aussehen, er stieß mich in die Seite und beschimpfte mich ganz unflätig, er wollte sich sogar an mir vergreifen, doch als er meine geballten Fäuste sah, traute er sich nicht.... Ich kam in Souilly in einen regelrechten Pferdestall, ein Becher Wasser und ein Stück trocknes Brot waren meine Labung. Die Tür zu diesem Stall wurde aufgelassen, die Zivilisten kamen und bewarfen mich mit Steinen, beschimpften mich, den Kaiser, den Kronprinzen und die deutschen Frauen. Dann wurde ich in das sogenannte 'Interogatoire' geschleppt, eine elende Bretterbude, neben der sich ein paar Kojen befanden; in eine dieser Kojen, einem regelrechten Schweinestall, warf man mich hinein und erquickte mich mit einer Rinde trocknen Brotes... ich biß ins Stroh, ich krampfte meine durch die Kälte erstarrten Finger an meinem Halstuch zusammen, ich hatte wieder den süßlichen Geschmack von Blut im Munde, da packten mich schon vier Fäuste und zerrten mich in die Höhe, schleppten mich zum Verhör.... Das alles war ja schwer zu ertragen, aber was war das gegen das grenzenlose Elend der armen deutschen Soldaten, die auf der bloßen Erde lagen, [173] keinen Strohhalm, kein Bündel Heu, nichts unter sich. Es regnete damals Tage hindurch, fußhoch sank man in Schlamm und Dreck ein. Nicht eine Stunde Ruhe fanden die armen gequälten Mannschaften, aufeinander haben sie sich gelegt. Dauernd stampften sie auf und ab, um die steifen Glieder zu erwärmen. Wie elend sahen die Leute aus! Oft keinen einzigen Knopf mehr am Waffenrock, die Achselklappen heruntergerissen, französische Käppis auf – ein jämmerliches Bild! Die Leute wurden vom Ungeziefer fast aufgefressen. Ich selbst habe einen bedauernswerten alten Landwehrmann, einen Lehrer, gesehen, dem die Läuse ganze Löcher in das Schienbein gefressen hatten. Allemal, wenn der Arme zum Arzt kam, verrieten seine Augen schon den kommenden Schmerz, denn der französische Stabsarzt brannte die Löcher mit einem glühenden Platinstift aus. Das Lächeln dieses Arztes barg eine ganze Hölle von Verwerflichkeit. Die Leute brachen hochfiebernd unter Ruhr und ähnlichen Erscheinungen zusammen. Heimlich haben wir uns manchmal nachts einen oder den anderen zu uns hereingeholt. An den einen erinnere ich mich besonders. Ein junges Kerlchen von 20 Jahren. Die Zähne schlugen ihm vor Fieberfrost. Der Kleine phantasierte von seiner Mutter und Schwester. Gewann er für kurze Zeit das Bewußtsein zurück, so versuchte er noch, militärisch zu danken. Ich war damals dem Wahnsinn nahe. Dieses tiefe, schamlose Elend mit ansehen müssen, ohne helfen zu können. Das [174] schmerzte mehr als körperliches Leiden. Fast jeden Morgen kam ein ganz junger französischer Offizier zu uns herein und erging sich mit wahrer Wollust darin, ganz laut unsern Kaiser, das deutsche Volk und den Kronprinzen zu beschimpfen. Aufreizend war auch die Einrichtung, daß früh um 6 Uhr ein französischer farbiger Sergeant, der richtige Marokkaner, auf einer Trillerpfeife zum Appell pfiff. So pfiff man einem Hunde. Die deutschen Offiziere und Mannschaften mußten antreten. Ich sehe noch die lässige Handbewegung des Marokkaners, wenn er, die Trillerpfeife im Munde, die einzelnen Offiziere bezeichnete und uns dann gnädig entließ. Nach dem Appell wurden die armen deutschen Soldaten zu vierzig und fünfzig in Lastautos mit Anhängern verladen und zur Arbeit in Steinbrüche oder zum Straßenbau gefahren. Bis sechs Uhr abends mußten die Ärmsten arbeiten. Ein Bild schmerzenden Elends zog jedesmal an uns vorüber, wenn sie abends zurückkehrten. Mit Schweiß, mit gelblich-weißem Staub bedeckt, mit eingefallenen Wangen, nach vorn überhängenden Schultern und rot entzündeten Augenrändern... Und zählten wir, so fehlten einmal drei oder vier. Stellten wir dann die Frage: 'Ja, Leute, da fehlen ja drei oder vier!' dann kam die furchtbar niederschmetternde Antwort: 'Ja, Herr Leutnant, wir lagen im deutschen Artilleriefeuer!' Nachts kroch oft einmal der oder jener von den Ärmsten zu uns heran, und dann reichten wir ihm die Hälfte des Essens, das wir uns abgespart [175] hatten – da jene durch Arbeit hungerten. Schamlos war die Art und Weise, wie dagegen die Polen und Elsässer geradezu gehätschelt wurden..."
 Ein französisches Flugblatt (über den deutschen Linien abgeworfen): "Deutsche Kameraden! Im Kampfe sind die Franzosen, ihr wißt es ja, gefährliche und unerbittliche Gegner. Sobald aber der Kampf vorüber ist, zeigen sie sich als gutherzige Menschen. Sollte Euch Euer Weg nach unseren Linien führen, weil Ihr Euch vielleicht auf Patrouille verirrt habt oder aus Ekel vor dem endlosen Blutvergießen, so fürchtet Euch nicht! Es wird Euch bei uns kein Leid angetan! Es sind in dieser Beziehung den französischen Truppen strenge Befehle erteilt worden!" Ein Lagerkommandant von Orleans sagte zu seinen neueingetroffenen Kriegsgefangenen: "Man wird euch in Frankreich nichts tun, man wird euch nur langsam zu Tode bringen!" Der Kommandant von La Pallice: "Ich will, daß die deutschen Kriegsgefangenen als Kadaver zurückkehren, die Hunde sollen arbeiten, daß sie bei ihrer Rückkehr nicht mehr imstande sind, ihre Familie zu ernähren!" Der Dolmetscher des Lagers Sennecy:
"Frankreichs Sinnen und Trachten geht dahin, die deutschen Soldaten systematisch zugrunde zu richten!" |