  |
Friedland
Bericht Nr. 187
Behandlung von Juden:
Wiedererwerb der eigenen Kanzlei
verhindert
Berichter: Dr. Rudolf Fernegg  Bericht vom 21. 6. 1951 Bericht vom 21. 6. 1951
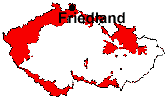 Mein Bundesbruder,
Rechtsanwalt Dr. Bermann aus Friedland war während der Zeit des
"Dritten Reiches" in der kleinen Festung Theresienstadt untergebracht. Er ist nach dem 9. 5.
1945
zu mir gekommen und hat mir berichtet, er wolle versuchen, seine Anwaltskanzlei und sein Haus
in Friedland wieder zu erwerben. Seine Frau hatte das Haus inzwischen verkaufen müssen
und war nach Prag gegangen. Bermann ist einige Tage nachher nochmals zu mir gekommen und
hat berichtet, daß er zunächst nach Prag gehe, weil seine Versuche in Friedland
gescheitert sind. Mein Bundesbruder,
Rechtsanwalt Dr. Bermann aus Friedland war während der Zeit des
"Dritten Reiches" in der kleinen Festung Theresienstadt untergebracht. Er ist nach dem 9. 5.
1945
zu mir gekommen und hat mir berichtet, er wolle versuchen, seine Anwaltskanzlei und sein Haus
in Friedland wieder zu erwerben. Seine Frau hatte das Haus inzwischen verkaufen müssen
und war nach Prag gegangen. Bermann ist einige Tage nachher nochmals zu mir gekommen und
hat berichtet, daß er zunächst nach Prag gehe, weil seine Versuche in Friedland
gescheitert sind.

Friedrichswald
(bei Gablonz)
Bericht Nr. 188
Verhaftung, Lager, Bauernarbeit
Berichter: Franz Simon  Bericht vom 4. 7. 1950 Bericht vom 4. 7. 1950
 Zu Beginn
möchte ich feststellen, daß ich i. J. 1945 im 67. Lebensjahre stand und der
NSDAP nicht angehörte, während des Krieges war ich Luftschutzwart. Zu Beginn
möchte ich feststellen, daß ich i. J. 1945 im 67. Lebensjahre stand und der
NSDAP nicht angehörte, während des Krieges war ich Luftschutzwart.
Am 12. Juni 1945, um 5 Uhr morgens, wurde an unsere Haustür gepocht und zum
Öffnen
aufgefordert. Ich machte auf und sah mich gleich von einer Rotte Partisanen umringt, die mir
befahl, mich sofort anzuziehen und mitzugehen. Während einige, ich kann die Zahl nicht
genau nennen, Kasten und Schränke durchstöberten und alles durcheinander
wühlten, ließ mich ein weiterer nicht aus den Augen und trieb mich mit zynischen
Bemerkungen zur Eile an. Meine Frau, die mir doch etwas zu Essen geben wollte, wurde beiseite
geschoben, "ich brauche nichts". Auf der Straße stand ein Autobus, der uns aufnahm, es
waren schon einige Leidensgenossen drin und etliche wurden noch zusammengeholt. Von den
Partisanen waren einige betrunken. Sie warfen Bilder von Hitler im Wagen herum, um dann zu
behaupten, wir hätten uns dieser entledigen wollen. Unsere erste Station war die
Realschule
in Reichenberg, dort mußten wir uns in einem Zimmer im dritten Stock mit dem Gesicht
an
die Wand stellen. Nach einer Weile ging einer mit einer Peitsche durch und hieb in uns hinein.
Wir mußten "Heil Hitler" sagen. Dann kamen wir einzeln in ein Zimmer, wo wir aussagen
sollten. Als ich sagte, daß ich nicht bei der NSDAP gewesen sei, erhielt ich eine
kräftige Ohrfeige von meinem Verhörer, darauf noch viele Peitschenhiebe. Mit
teuflischer Verschlagenheit hatte man mir einen Schlagring in den Ausweis gesteckt. Nach
dieser
"Protokollaufnahme" mußten wir im Vorhaus ½ Stunde die Hände vorn hoch
halten, bzw. nach vorn strecken. Bei wem sie sich senkten, der wurde geschlagen. Dann
mußte ich mit einem Schicksalsgenossen eine Stube und ein Vorhaus waschen, worauf wir
dann in ein dunkles Loch, das scheinbar ein Geräteschuppen oder dgl. gewesen war,
eingesperrt wurden. Dort befanden sich schon Opfer vom Vortage. Nachmittags wurden wir in
die
Laufergasse geschafft (Polizeigefängnis), das war aber überfüllt, sodaß
wir zurück in die Baracken am Langen Weg kamen. Rohes Gelächter, Schimpfen,
Fußtritte in den Rücken waren stete Begleiter. Auf der Stiege des
Polizeigefängnisses machten sich die Fußtritte in den Rücken besonders gut,
denn wer nicht darauf gefaßt war und sich am Geländer nicht festhielt, fiel die
Stiege
herunter. In der Baracke am Langen Weg mußten wir mit dem Gesicht gegen die Wand
stehen und die Hände hoch halten u. zw. eine ganze Stunde lang. Wem sie sich nur im
geringsten senkten, oder wer den Kopf ein bißchen drehte, der erhielt von den den Gang
auf-
und abmarschierenden Partisanen Kolbenstöße in den Rücken und Ohrfeigen.
Darnach gab es wieder Einzelverhöre, bei denen alles, außer den
Augengläsern, weggenommen wurde, jedes Stückchen Brot, was man etwa in der
Tasche hatte und jede etwaige Zigarette. Mich fragte der Verhörer zuerst, woher ich
wäre. "Von Friedrichswald", war meine Antwort. Mit den Worten "weißt Du nicht,
daß das Bedrichov heißt", gab er mir eine Ohrfeige, daß es mir wie Feuer vor
den Augen flackerte. Von hinten haute der Lagerverwalter in mich hinein. Nachdem nun alle
Leidensgenossen auf so humane Art ihrer Sachen entledigt waren, mußten wir antreten
und
in tiefer Kniebeuge einmal um die Baracke herumhüpfen, anschließend auf allen
Vieren herumkriechen. So neigte sich der erste Tag dem Ende zu. Bisher hatten wir noch gar
nichts zu essen bekommen, jetzt wurden wir in die Baracken eingeteilt und bekamen eine Schale
schwarzen, bitteren Kaffee und von einem normalen länglichen Brot ½ Schnitte,
gewichtsmäßig etwa 20 bis 30 Gramm, das war aber für uns die ganze
Tagesration gewesen. Dieses Quantum gab es weiterhin früh und abends und zu Mittag
eine Schale leere Suppe. An einem Tage in der Woche konnten unsere Angehörigen die
Wäsche zum waschen abholen und bei dieser Gelegenheit wurden auch
Lebensmittelpakete
übermittelt, die nach Kontrolle an uns weitergereicht wurden, allerdings meist nicht
vollständig. Wir mußten Schränke fortfahren, Fußboden waschen u.
dgl.
Arbeiten verrichten. Der Lagerverwalter, ein Tscheche, der zwischen Reichenberg und Gablonz
eine Wirtschaft (einen deutschen Bauernhof) haben sollte und im Kriege Gastwirt in
Reichenberg
war, hatte es sich scheinbar zur Pflicht gemacht, dafür zu sorgen, daß seine
Lagerinsassen immer in Bewegung blieben. Wer seinen abgemagerten Körper nur
mühsam zur "Essenausgabe" schleppen konnte, dem wurde mit der Peitsche
nachgeholfen,
denn er war für "Tempo". Einer aus meinem Heimatdorfe war nach erhaschter
Gelegenheit
ausgerissen, das war an einem Mittwoch. Dafür wurden uns allen das Brot, was die Frauen
am Freitag hereingebracht hatten, weggenommen. Den Ausreißer hatte man wieder
eingebracht und ich will es unterlassen zu beschreiben, wie man ihn gequält hat.
Gegen Ende Juli wurden wir zu einem Transport ins Tschechische zusammengestellt. Stehend,
in
Viehwaggons, ging die Reise, wer sich setzte, wurde vom Wächter zusammengerammelt.
In Jungbunzlau mußten wir aussteigen. Um "Zusammenstöße" zu verhindern,
mußten wir mit dem Gesicht zur Wand stehen und auf den anderen Zug warten. In
Schumbor, einem Maierhofe im Kreise Nymburk, endete meine Reise. Ausgehungert bis aufs
Letzte, völlig kraftlos und voller blauen Flecke, sollten wir nun dort die Arbeiten eines
tüchtigen Knechtes übernehmen. Meine Hoffnung, sich hier wenigstens satt essen
zu
können, war trügerisch gewesen. Gleich am ersten Tage wurde uns gesagt,
daß
es sehr wenig zu essen gäbe, es gäbe für uns nur Erbsen. Den ersten Tag
mußte ich Holz hacken, während meine Schicksalsgenossen Aborte waschen
mußten. Vom 2. Tage ab sollte ich mit 2 Pferden fahren, was ich aber ablehnte, da ich
noch
nie in meinem Leben mit einem Fuhrwerke gefahren bin. So mußte ich dem Kutscher die
Pferde versorgen und tagsüber auf dem Felde arbeiten. Früh um 4 Uhr mußte
ich füttern. Ein Pferd war mir derart an mein Krampfaderbein gesprungen, daß ich
nur sehr schlecht laufen konnte. Da ich der Aufforderung des Schaffers, schneller zu laufen,
nicht
folgen konnte, hieb er mit seinem Stock meinen Rücken blau. Seine Beschwerde bei den
täglich inspizierenden Partisanen trugen mir links und rechts Ohrfeigen ein.
Ende September hatte ich die erste Schreibgelegenheit, da konnte ich erst meine Frau
verständigen, daß ich noch lebte und wo ich war. Zum Baden war keine
Gelegenheit.
Die einzige Wanne wurde von den Frauen mit Beschlag belegt, die viel durch die Russen zu
leiden hatten. Es gab wahre Verzweiflungsszenen, wir waren verlaust, hungrig und
heruntergerissen. In dieser Lage fand mich meine Tochter, als sie eines schönen
Sonntagvormittags plötzlich vor mir stand. So erfuhr ich, daß meine beiden
Töchter auch im Tschechischen arbeiten mußten, die eine davon im Kreise
Nymburk,
und auch, daß meine Frau krank war. Sie konnte die seelischen Depressionen nicht
aushalten und wurde immer schwächer. Mein offenes Krampfaderbein hatte sich derart
verschlimmert, daß ich früh nicht immer zur Arbeit gehen konnte. Der Verwalter
drohte mir mit der Peitsche, hatte auch einigemale Gebrauch davon gemacht. In meiner
Verzweiflung schrieb ich eine Karte in das Lager nach Nymburk, daß ich meines offenen
Beines wegen nicht arbeiten kann. Von dort erhielt der Verwalter eine Aufforderung, mich in
das
Lager nach Nymburk zu bringen. Von dort kam ich ins Krankenhaus. Dort war die Behandlung
menschlich. In meinem Zimmer lag ein deutscher Schicksalsgenosse, dem man hatte ein Bein
abnehmen müssen (64 Jahre alt), er hatte es sich erfroren. Am 3. Feber 1946 kamen wir
wieder ins Lager nach Reichenberg, bzw. ins Aussiedlungslager nach Habendorf. Ich
möchte aber nicht unerwähnt lassen, daß es meinen 2 Töchtern
möglich gewesen ist, mir dann, als sie wußten, wo ich war, zu Essen zu schicken.
Ich
sage das deshalb, um nicht unbeachtet zu lassen, daß es auch dort Menschen gab, die ihr
Herz nicht verschlossen hatten. Meine Angehörigen haben das möglichste versucht,
beim örtlichen Národní Výbor zu erwirken, daß ich
wenigstens für einen einzigen Tag nach Hause kommen könnte. Ich hätte
halt
gern meine Heimat noch einmal gesehen, war ich doch nur zwei Fußstunden von zu Hause
weg. Alles Bitten war aber vergebens. Als meine Frau zu mir ins Lager kam, war sie seelisch und
körperlich fertig, am 7. 7. 1947 starb sie in Kaufbeuren, sie hatte sich nicht mehr erholen
können.

Gießhübl-Sauerbrunn
(bei Karlsbad)
Bericht Nr. 189
Enteignung, Raub
Berichterin: Maria Pichl  Bericht vom 22. 6. 1950 Bericht vom 22. 6. 1950
 Bei der Austreibung der
Deutschen aus der CSR wurden auch solche vertrieben, die nach
Benesch's Dekret ein Recht gehabt hätten, im Lande zu verbleiben. Wie mit solchen
verfahren wurde, will ich an Beispielen beleuchten. Zuerst mag ich meinen Fall
erzählen: Bei der Austreibung der
Deutschen aus der CSR wurden auch solche vertrieben, die nach
Benesch's Dekret ein Recht gehabt hätten, im Lande zu verbleiben. Wie mit solchen
verfahren wurde, will ich an Beispielen beleuchten. Zuerst mag ich meinen Fall
erzählen:
Ich wurde im alten Österreich geboren, bildete mich zur Lehrerin in einem katholischen
Institut
aus, diente als Lehrkraft in Österreich, hernach in der Tschechei und ging 1923 nach USA
(Chicago, Ill.) In Amerika erwarb ich das 1. Bürgerpapier, in welchem ich erklärte:
"It is my bona fide intention to renounce forever all allegiance and fidelity to any foreign prince,
potentate, state or sovereignty and particularly to the Czechoslovak Republic of whom I am now
subject; and it is my intention in good faith to become a citizen of the United States of America
and to permanently reside therein: So help me God". Beweis: das Bürgerpapier vom 13.
Oktober 1923.
Da 1932 in Amerika große Depression auf dem Arbeitsmarkte herrschte und ich immer
wieder Stellungen wechseln mußte, ging ich in die CSR zurück und arbeitete wieder
als deutsche Lehrerin im deutschen Gebiet. Ich war also bei der Volkszählung 1929 gar
nicht in der CSR, konnte mich daher nicht als Deutsche bekennen, sondern hatte damals ein
Bekenntnis zum amerikanischen Volke abgelegt. Dieses Bürgerpapier habe ich heute noch
im Original im Besitz und dieses Papier zeigte ich bei der Revolution 1945 dem Schwedischen
Konsul Harden in Karlsbad, welcher die Interessen der Amerikaner vertrat. Er erklärte
mir,
daß durch dieses Papier ich, die Familie und mein Besitz bei der Revolution
geschützt sei und ich den tschechischen Kommissaren dies melden solle, welches ich tat.
Damals kam ein Sokol in mein Haus und erklärte mir, daß ich keine Angst zu haben
brauche, da die Tschechei so ausgerichtet werde, wie sie früher war. Da das
amerikanische
Dokument nach 7 Jahren ungültig war, so war ich eigentlich ein Bürger der
Tschechei geblieben und konnte nicht nach Amerika zurückkehren. Nun kamen die
Partisanen und forderten mich auf, nochmals um die tschechische Staatsbürgerschaft
anzusuchen. Man wollte mich als Englisch-Lehrerin verwenden. Aber man knüpfte die
Bedingung daran, daß ich der Kommunistischen Partei beitrete. Ich stellte die
Gegenfragen:
"Kann ich meine Besitztümer behalten?" (Ich besaß mit meiner Familie 2
schöne Häuser). Man antwortete mir, daß ich diesen Besitz aufgeben
müsse und ich dorthin zu gehen habe, wohin ich Weisung bekomme. Meine Frage: "Was
geschieht mit meiner 84 Jahre alten Mutter, meinem hilflosen invaliden Bruder und meiner
pensionierten Schwester?" (Bis jetzt hatte ich für Mutter und Bruder gesorgt). Die
Partisanen
(Gendarmen) antworteten mir: "Die werden alle nach Deutschland ausgesiedelt!" Ich empfand
dies ganze Vorgehen als große Unmenschlichkeit und wandte mich mit einem Ansuchen
an
das Prager Innenministerium, bittend, daß mein Fall entschieden werde und erhielt
Antwort,
daß man Erhebungen anstellen werde. Aber bald darauf kamen die Partisanen,
durchsuchten mein Haus, raubten, was sie wollten und sagten: "Laufen Sie endlich über
die
Grenze, daß wir Sie los sind." Als ich sah, daß schon damals, 1946, das Land
völlig kommunistisch ausgerichtet war, erklärte ich schließlich den
Partisanen,
daß ich gewillt bin, das Los aller Deutschen zu teilen und man mich als Deutsche
aussiedeln möge. Ende August wurde ich mit Mutter, Bruder und Schwester nach Bayern
ausgesiedelt.
Ähnlich erging es der
Baronin Nina Riedl-Riedenstein, Dallwitz-Karlsbad, Schloß. Sie war geborene Griechin,
ihr
Mann Österreicher, sie hatte großen Landbesitz und galt als sehr vermögend.
Ihre Schwiegermutter war Amerikanerin. Russische Offiziere quartierten sich in ihr
Schloß
ein, schleppten davon, was sie wollten, zerschlugen, was ihnen in den Weg kam, wenn sie
betrunken waren. Da sie wußten, daß die Frau ihren Besitz erhalten wollte (ihr Gatte
war bereits tot), stahlen sie in der Nacht alle Dokumente, die den Beweis erbracht hätten
und verschwanden damit. Einmal sprach ich beim schwedischen Konsul in Karlsbad vor. Er war
Direktor einer Bank in Karlsbad. Er sagte damals: "Nun haben die Tschechen die Bank
übernommen, meine Kündigung ausgesprochen, meiner Frau, sie war geborene
Deutsche, die Häuser konfisziert". "Mir ist dadurch die Lebensgrundlage genommen und
ich muß auch in ein anderes Land und wieder von vorn anfangen."
Auf dem Kommissariat in Gießhübl-Sauerbrunn war eine Slowakin
beschäftigt, deren Mann deutscher Arzt gewesen war. Mit ihr besprach ich oft die
verschiedenen Fälle und auch meine persönliche Angelegenheit. Eines Morgens
eröffnete sie mir: "Es ist traurig, wir werden nur von Kommunisten regiert, sie
bestimmen,
wer zu enteignen ist, die fragen nicht, ob Ausländer oder Deutscher, die wollen den
Besitz,
das ist alles!"
Alle Angaben sind Wahrheit und kann ich zum Teil mit Originalpapieren belegen.

Graslitz
Bericht Nr. 190
Gepäckkontrolle
Berichterin: Margarete Poppa  Bericht vom 7. 7. 1946 Bericht vom 7. 7. 1946
 Bei der Gepäckkontrolle in
Graslitz im Aussiedlungslager wurde mir das gesamte
Handgepäck und eine Rolle mit 2 Decken und Kopfpolster abgenommen. Als ich dagegen
Einspruch erhob, drohte mir der Kontrollbeamte mit Verschickung ins tschechische Gebiet zum
Arbeitseinsatz. Ich bin 73 Jahre alt und habe nun während des ganzen tagelangen
Transportes keine Decke zum zudecken. Bei der Gepäckkontrolle in
Graslitz im Aussiedlungslager wurde mir das gesamte
Handgepäck und eine Rolle mit 2 Decken und Kopfpolster abgenommen. Als ich dagegen
Einspruch erhob, drohte mir der Kontrollbeamte mit Verschickung ins tschechische Gebiet zum
Arbeitseinsatz. Ich bin 73 Jahre alt und habe nun während des ganzen tagelangen
Transportes keine Decke zum zudecken.
|
|