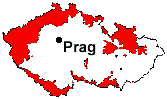|
 Prag
(Seite 4 von 6)
Bericht Nr. 74Prag-Raudnitz Berichterin: A. W.
Endlich waren auch die Barrikaden abgeräumt. Wir wurden zusammengetrieben, wir mußten uns paarweise anstellen, ein großes Hitlerbild lag auf der Erde und ein jeder mußte darauf treten und darauf spucken. Dann mußten wir niederknien und für die gefallenen Tschechen beten.
Nun ist es geradezu unmöglich, in der oben geschilderten Stellung auf den Knieen und mit erhobenen Armen sich vorwärts zu bewegen. Bald war nichts mehr zu sehen als übereinander rollende Menschenleiber, ein breiter langer Blutstreifen längs der ganzen Straße, wild dreinhauende Bestien. Die Schreie der Gequälten vermischten sich mit dem Gebrüll der Aufseher, dem Jubel der Menge. Jemand begann laut zu beten. Einmal kam ein Ehepaar neben mir ins Rutschen. Der Mann benutzte einen Augenblick, wo er sich unbeobachtet glaubte, um von den Knieen aufzuspringen und schnell ein paar Schritte zu machen. Ein fürchterlicher Hieb belehrte ihn eines Besseren. Er brach zusammen, die Frau aber mußte weiterrutschen. Sie hat nie erfahren, ob er lebend davon gekommen ist. Ein alter Mann bat flehentlich, man möchte mit seinen 83 Jahren Erbarmen haben. Auch ihn streckte ein Hieb nieder, von einer gräßlichen Beschimpfung begleitet. Beim Anstellen, am Anfang, war uns gnädig erlaubt worden, unsere Schuhe wieder zu nehmen, nicht aber sie anzuziehen. Wir mußten sie also in den erhobenen Händen halten und da entfiel mir plötzlich der eine. Ich wollte mich schnell darnach bücken, da traf mich ein entsetzlicher Hieb auf den Hinterkopf. Mir wurde schwarz vor den Augen, doch ich verlor nicht die Besinnung, aber von diesem Augenblick an hatte ich ununterbrochen ein Zischen in den Ohren, Tag und Nacht, das mich fast wahnsinnig machte. Außerdem, sobald ich zu sprechen begann, legte sich mir etwas vor die Ohren. Ich war fast taub. Das Sprechen machte mir große Mühe. Dieser qualvolle Zustand hat sich erst verloren, als ich schon in Deutschland war. Den zweiten Schuh ließ ich natürlich auch fallen. Plötzlich wurde Halt befohlen. Nun traten eine Anzahl Frauen auf, jede mit einer Schere bewaffnet, packten uns Frauen an den Haaren und schnitten uns einseitig die Haare ab. Das abgeschnittene Haar wurde uns gewaltsam in den Mund gestopft. Dann erscholl der Ruf "Wasser". Auffallenderweise verstand die Bevölkerung sofort die Bedeutung dieses Rufes. Aus allen Häusern traten eimerbewehrte Frauen und Männer und übergossen uns mit eiskaltem Leitungswasser oder mit scheußlichem Schmutzwasser. Während dieses Aufenthaltes kam aus der entgegengesetzten Richtung eine lange Kolonne von Motorradfahrern. Da wir auf den Knien waren und da ich den Blick nicht erhob, sah ich nur lauter Füße, vielleicht zwanzig Paar kräftig beschuhter Männerfüße. Die Kolonne fuhr ganz langsam an uns vorbei, wohl um sich an dem Schauspiel zu weiden, das wir boten. Sie benützten die günstige Gelegenheit, um uns Knieenden kräftige Fußtritte ins Gesicht zu versetzen. Schließlich kam noch eine andere Gruppe von Megären, die uns unseres Schmuckes entledigte. Endlich waren wir am Ziel, dem Kino Slavia in der Reifstraße (Ripská ulice), das als KZ-Lager bestimmt war. Vor dem Kino selbst war noch ein großes Hindernis aufgerichtet, das wir überspringen mußten, mit unseren wehen, blutenden Füßen und unseren gepeinigten, zerschlagenen Körpern, vor Nässe triefend. Das Kino Slavia ist eines der wenigen Kinos zu ebener Erde, nicht wie die anderen Prager Kinos unterirdisch. An einer Seite des Saales sind 3 große Tore, die auf einen Hof führen, auf den sich in normalen Zeiten die Kinobesucher in den Pausen begeben konnten. Wir wurden in diesen Hof getrieben und mußten uns mit erhobenen Armen aufstellen. So ließ man uns lange stehen. Dann kamen wir in den Kinosaal und mußten uns in die Reihen setzen. Wir wurden von einigen R.K.-Schwestern und 2 Ärzten, Dr. Günther und Dr. Lacher und einer Ärztin, Dr. Lang empfangen. Sie alle waren Deutsche und Gefangene wie wir. Unsere zerschundenen Knie und Fußsohlen wurden gewaschen und mit irgend einem antiseptischen Mittel bestrichen, auch wurde Trinkwasser herumgereicht, das war alles, was sie für uns tun konnten, denn sie hatten fast gar keine Medikamente oder andere Hilfsmittel, außerdem wurden sie selbst sehr streng gehalten und durften nur die allerschlimmsten Fälle behandeln. Wir hatten nur eine große Sorge. Man möchte uns nicht vor der Dunkelheit nach Hause schicken, da wir uns vor der Bevölkerung fürchteten. Mit unseren zerschlagenen Gliedern, unseren blutigen Füßen, unseren verschnittenen Haaren und unseren schmutzigen, vor Nässe triefenden, zerrissenen Kleidern wären wir sofort als Deutsche erkannt worden und das ganze Grauen hätte von Neuem begonnen. Diese Sorge war jedoch recht überflüssig. Als keinerlei Anstalten gemacht wurden, uns nach Hause zu entlassen, dachten wir, man wolle uns einen Propagandafilm vorführen. Es wurde jedoch Abend, es wurde Nacht, wir bebten vor Kälte in unseren nassen Kleidern, mit den bloßen Füßen, in diesem dumpfen, kalten Kinosaal. Nun hatten wir begriffen: wir waren gefangen, wir waren im Konzentrationslager. Zu essen bekamen wir an diesem Tage nichts, dafür aber umsomehr Wasser. Auf der Bühne vor der Leinwand saß ein Rotgardist, den Lauf seines Revolvers ununterbrochen drohend auf uns gerichtet. Wir durften weder nach links noch nach rechts schauen, immer nur still sitzen, den Blick geradeaus auf die Leinwand gerichtet. Da begann der unheimliche Geselle in einem monotonen, aber darum um so grausigeren Tonfall und mit halblauter zischender Stimme die fürchterlichsten Drohungen gegen uns auszustoßen. Es gibt kein Verbrechen, dessen wir nicht angeklagt, keine Folter, die uns nicht angekündigt wurde. Er unterbrach sich nur einigemale, um von der Bühne zu springen und einen Unseligen, der es gewagt hatte, sich nach einem Nachbarn umzuwenden, von seinem Sitze zu zerren und zu beschimpfen und zu mißhandeln. Dann ging die furchtbare Predigt weiter, bis ein neuer Peiniger zur Ablösung erschien; der machte es genau so wie sein Vorgänger, sodaß die Absicht und das Vorgehen unverkennbar war. Das dauerte die halbe Nacht. Ich bekam Gänsehaut vor Entsetzen. Das mußte unfehlbar zum Irrsinn führen. Tatsächlich, schon nach 2 Tagen dieser Behandlung, im Verein mit dem Hunger, hatten wir die ersten Fälle von Irrsinn. Meine Wohnungsnachbarin, die ich hier wiederfand, eine schwache, etwas hysterische Frau, war die erste. Sechs oder sieben andere kamen bald dazu. Sie stand auf und begann irre Reden zu führen, indem sie den Aufsehern drohte, sie würden uns nicht mehr lange peinigen, wir bekämen Hilfe von den Amerikanern, dann wehe ihnen usw. Eine andere sprang auf ihren Sitz und schaute mit irren Augen um sich. Eine allgemeine Panik brach aus, viele schrien, andere warfen sich auf den Boden, denn die Aufseher machten Miene zu schießen. Da sprangen zwei Besonnenere von ihnen auf die beiden Frauen zu, zerrten sie in den Vorraum und schleuderten die noch immer Redenden und Schreienden aus einem Winkel in den anderen, solange bis sie verstummten. Niemand hat die beiden je wieder gesehen. Ich komme auf jene erste Nacht zurück. Endlich ließ man uns in Ruhe, aber nach einem Nachtlager sahen wir uns vergebens um. Wir mußten den Rest der Nacht auf den Klappsesseln zubringen oder auch darunter, denn wir sanken vor Erschöpfung von den Sitzen und durften dann dort liegen bleiben, in dem Schmutz und den Abfällen von der letzten Kinovorstellung, soweit von einem Liegen zwischen dem Gestänge der Sitze und den Füßen der Sitzenden die Rede sein konnte. Es ist selbstverständlich, daß an ein Auskleiden nicht zu denken war. Ich habe mein Kleid 5 Wochen nicht ausgezogen. Am nächsten Tage und an den folgenden Tagen bekamen wir etwas bitteren, schwarzen Kaffee und einige Scheiben Brot, weiter nichts. Etwas später kam ein wenig Suppe dazu, eine kleine Kaffeetasse voll mit einer Scheibe Brot. Dabei blieb es schon für immer. Nie haben wir außer dem bißchen Brot etwas Festes zu essen bekommen. Diese Suppe bestand anscheinend aus den von den Tellern der Soldaten und Aufseher abgekratzten Resten, denn es fand sich darin das Unvereinbarste zusammen. Gleichwohl versuchten wir uns durch alle möglichen Listen eine zweite Portion zu erschleichen. Die Suppentasse wurde herumgereicht, es waren deren vielleicht 5-6 im Ganzen vorhanden, sodaß mindestens 100 Menschen aus derselben Tasse schlürfen mußten, die natürlich nicht gewaschen wurde. Wir waren mindestens 500, vielleicht mehr, keinesfalls weniger Personen. Das Kino hatte jedoch nur ein einziges W.C., 2 Kabinen für Männer und 2 für Frauen, vor denen immer lange Schlangen standen, umsomehr als bald viele an schweren Durchfällen litten, die nicht behandelt wurden. Täglich wurden dort neue Selbstmorde verübt. Obzwar niemand mehr eine Waffe besaß, so war doch mancher noch im Besitz einer Rasierklinge oder einer kleinen Schere, mit der er sich die Pulsadern durchschnitt. Bald nahm die Sache so überhand, daß man sich veranlaßt sah, die Türen auszuhängen, denn diese Art von Selbsthilfe war nicht im Sinne der Lagerleitung. Nun gab es endlich kein einziges Fleckchen mehr, wo man auch nur 2 Minuten mit sich allein gewesen wäre. Die schrecklichsten Mißhandlungen, der Hunger, die Überfülle grauenvoller, sich überstürzender Eindrücke, mein qualvoller, schon erwähnter Zustand als Folge des Schlages auf den Hinterkopf, das alles hatte bei mir einen seltsamen Zustand hervorgebracht. Ich schlief nie wirklich und war auch nie wirklich wach. Ich nahm alles wahr wie aus weiter Ferne und doch ganz deutlich. Es schien mir wie ein Traum aus der Hölle. Ich fiel oft in Ohnmacht, was mir in meinem ganzen Leben sonst nie passiert war. So entsinne ich mich, wie ich einmal gefallen sein mußte, als ich mit anderen den Saal kehrte. Man hatte anscheinend eine von unseren RK.-Schwestern geholt, denn ich erwachte von ihren Bemühungen, meine krampfhaft geschlossene Hand zu öffnen, mit der ich eine im Kehrricht gefundene Brotkruste umklammerte, die ich mir auf keinen Fall nehmen lassen wollte. Ein anderesmal hatte ich ein besonderes Glück. Ich fand ein Stück einer Speckschwarte, die ich mir mit dem Kleide reinigte - ein Taschentuch oder sonst etwas besaß ich ja nicht - und dann stundenlang im Munde behielt. Es verschaffte mir die Illusion gegessen zu haben. Jeden Morgen wurden wir zur Arbeit geholt. Wir Frauen mußten Straßen pflastern und den Schutt von ausgebombten Häusern fortschaffen, dabei immer von den Aufsehern geschlagen und beschimpft, wenn es ihnen nicht schnell genug ging, von der Bevölkerung verhöhnt, weh dem, der auf dem Weg zur Arbeit es wagte, den Fuß auf den Gehsteig zu setzen. Die Ungeheuerlichkeit passierte mir auch einmal. Ich wurde von einer brutalen Hand heruntergezerrt und in die Mitte der Straße geschleudert. "Deutsche Sau, du wagst es, den Gehsteig zu betreten, wie ein normaler Mensch." Jeder Tscheche, der irgendeine Arbeitskraft brauchte, konnte sich im Lager Deutsche für diese Arbeit holen. In jenen Revolutionstagen kam Prag nicht aus den Feiern heraus und am nächsten Morgen mußten dann die Spuren davon wieder beseitigt werden. Es müssen manchmal die unbeschreiblichsten Orgien gewesen sein, nach dem was unseren Frauen an ekelhaften Reinigungsarbeiten zugemutet wurde. Das Entsetzlichste war es immer, in den ersten Tagen, wenn der Befehl kam, 15, 20, 25 Männer zum Gräber graben. In jenen Tagen gab es tatsächlich in Prag noch eine Unmenge unbeerdigter Toter von den letzten Kämpfen. Von diesen Männern fehlten jedoch bei der Heimkehr immer einige, manchmal die Hälfte, manchmal noch mehr. Man hatte sie gleich mitbeerdigt, zuweilen noch ehe sie ganz tot waren. So erzählten zumindest die Heimkehrenden, fast irrsinnig vor Grauen. Jeden Abend wurden einige Männer in den Vorraum geholt, dann wurden die Türen geschlossen, niemand durfte während dieser Zeit auf das W.C. gehen. Nicht lange darauf hörten wir gräßliche Schreie und dumpfe Schläge. Bald darauf brachte man die Unglücklichen zurück. Es waren meist jüngere Männer, von gutem Aussehen und guter Haltung. Was da zurückkam, das waren Bilder des Jammers, in einer Viertelstunde um 20 Jahre gealtert, die sich mit ihren verrenkten Gliedern und ihren von den Knochen geschlagenen Muskeln mühsam schleppten. Wieviele diese Behandlung überlebt haben, weiß ich nicht. Es dürften nicht sehr viele gewesen sein. Mit der Zeit hatte sich die ganz starre Disziplin ein wenig gelockert und wir durften uns manchmal auf dem Hofe aufhalten. Welche Erholung das aber war, kann man sich vorstellen, wenn man bedenkt, daß wir 5-700 Personen waren und daß es sich um einen kleinen, rings von hohen Häusern eingeschlossenen Großstadthof handelte. Des Nachts war dieser Hof der Schauplatz von Tragödien, von denen wohl nie jemand etwas erfahren wird. Dann war es bei Todesstrafe verboten, den Hof zu betreten. Jede Nacht gab es Schießereien auf dem Hofe. Jeden Morgen fehlten einige von unseren Leuten. Es kamen aber täglich Neue und so fiel das nicht weiter auf. Bei dem ungeheuren Gedränge und dem ewigen Durcheinanderwogen war es nur den Zunächstsitzenden möglich, festzustellen, wenn wieder einer fehlte. In der Reihe vor mir saß eine Frau, die unter ihrem Sitze ein Paar Gummistiefel stehen hatte. Es waren ja nicht alle so ganz von allem entblößt, wie die Gruppe, mit der ich hergekommen war. Manche hatten etwas mitnehmen können. Sie wurden aber ihre Sachen später doch noch los. Da ich, wie schon erwähnt, bloßfüßig war, hatte mir diese Frau manchmal ihre Gummistiefel geliehen, wenn ich zur Arbeit mußte. Eines Nachts wurde auch sie geholt - die meisten wurden nachts abgeholt - und da es in einer solchen Nacht war, wo auf dem Hof viel geschossen wurde, und da sie nicht wiederkam, waren wir alle überzeugt, daß auch sie den Weg über den Hof genommen hatte. Die Gummistiefel habe ich heute noch. Da die Aufseher fast immer betrunken waren, waren wir in ständiger Lebensgefahr, denn sie spielten dann wie Kinder mit ihren scharfgeladenen Waffen. Sie lachten wie toll und wollten einen Extraspaß haben. Dazu holten sie sich, wenn es Abend war, unsere zu Tode erschöpften Männer, die von schwerer Arbeit kamen und fast nichts gegessen hatten und ließen sie auf dem Hofe Kniebeugen machen. Sie amüsierten sich köstlich, wenn die Unglücklichen zusammenbrachen. Eine Anzahl von Frauen aus meiner Nähe wurden jeden Tag in die ehemalige SS-Kaserne auf dem Lobkowitzplatz befohlen, wo jetzt russische Soldaten hausten. Trotz ganz unerhörter Arbeitslasten, die man diesen Frauen aufbürdete, wurden sie doch von uns allen beneidet, da sie dort nicht zusätzlich gequält und gedemütigt wurden und vor allem, da sie dort zu essen bekamen. Sie brachten auch meist etwas mit, das sie sich für uns aufgespart hatten und wir warteten mit Ungeduld auf ihre Heimkehr am Abend. Da wir viele waren, die zur unmittelbaren Umgebung dieser Vielbeneideten gehörten, so entfiel auf jeden von uns nicht mehr als ein Löffel voll, doch selbst das bedeutete für uns schon eine schätzenswerte Aufbesserung. Leider war man der Sache bald auf die Spur gekommen, die Frauen wurden von nun ab jeden Abend bei ihrer Heimkehr untersucht und es wurde ihnen weggenommen, was sie mitgebracht hatten. Eine Gruppe von Männern hatte einmal irgend eine Arbeit auf einem Neubau hinter einem großen Gitter zu leisten. Draußen standen einige Gaffer und verhöhnten sie. Das brachte den Aufseher auf die Idee, den Leuten eine Vorstellung zu geben. Die deutschen Männer mußten einander gegenseitig anspucken, ohrfeigen, schließlich mußten sie Straßenkot essen und dergleichen. Das wiederholte sich einige Tage lang mit verschiedenen Variationen und es fand sich kein Tscheche, der gegen diese schmachvolle Schaustellung Protest erhoben hätte. Einmal kamen einige von unseren Frauen in maßloser Erregung von der Arbeit. Das Entsetzen saß ihnen noch in den Gliedern und das Weinen schüttelte sie. Sie hatten in einem Depot der deutschen Wehrmacht Pullover und dergleichen, die sich die Tschechen jetzt angeeignet hatten, dutzendweise bündeln, aber auch gleichzeitig eine Menge blutgetränkter Uniformstücke aussortieren müssen, die dort herumlagen. Dabei hatten sie buchstäblich stellenweise im Blut gewatet und hatten auf hunderten von Eisernen Kreuzen und anderen Distinktionen herumtrampeln müssen, die dort im Blute lagen. Wahrscheinlich hatte sich dort einer dieser letzten Kämpfe abgespielt, eine dieser unheimlichen Tragödien, von denen nie jemand erfahren wird. Man hatte den Unseligen die Uniformen ausgezogen und sie selbst nackt, oft noch lebend, in die Massengräber geworfen. Dies ist nicht bloß meine Vermutung, sondern es wurde allgemein behauptet und ist auch bestimmt geschehen. Wie mancher, der vermißt ist, mag in einem Prager Massengrab erstickt sein. Täglich wurde uns mit dem Erschießen gedroht. Diese Drohungen hörten plötzlich auf, als wir flehentlich immer wieder baten, sie doch wahr zu machen und uns von diesem Martyrium zu befreien. Eines Tages wurde bekanntgegeben, alle Österreicher möchten sich melden, sie würden sofort freigelassen. Da war auch eine junge Frau, die sich sofort meldete und sich vor Freude nicht zu fassen wußte. Als sie aus der Wohnung getrieben worden war, war ihr sechsjähriges Töchterchen gerade nicht zuhause gewesen und die Arme hatte die ganze Zeit um das Kind gebangt. Ihr Mann war gefallen, die Frau war also reichlich heimgesucht und wir gönnten ihr die Befreiung. Es fehlten indessen noch einige Dokumente, die sie natürlich nicht bei sich hatte und so wurde sie, von einer Wache begleitet, in die Wohnung geschickt. Leider fand der Mann mehr als er gesucht hatte, nämlich verschiedene Belege, daß sie in einer Kanzlei der Gestapo als Maschinenschreiberin tätig gewesen war. Von da ab war ihr Schicksal besiegelt. Der Traum von der Freilassung war natürlich ausgeträumt. Was die Unglückliche aber von diesem Tage an zu erdulden hatte, war einfach unvorstellbar. Sie mußte entsetzlich verunreinigte Latrinen reinigen, mit bloßen Händen, ohne irgendein Gerät, ohne Wasser, man sperrte sie Tage und Nächte lang in einen finsteren Keller, ohne Nahrung, man schleuderte sie mit dem Kopf gegen die Wand. Als wir endlich einige Wochen später unseren Todesmarsch zum Bahnhof antraten - von dem noch die Rede sein wird - um nach Raudnitz zum Sklavenmarkt geschafft zu werden, wollten wir sie retten, indem wir sie, die nur noch mit Mühe gehen konnte, nach Möglichkeit in die Mitte nahmen. Jemand hatte ihr ein großes Tuch geliehen damit sie sich unkenntlich machen konnte. Dennoch wurde sie von einem der Henkersknechte erkannt und vor unseren Augen erschlagen. Ich habe bereits von meinem sonderbaren halbwachen Zustand gesprochen. So erinnere ich mich auch wie eines Traumbildes eines Winkels bei einem Tore, den wir den Selbstmörderwinkel genannt hatten. Ich sehe vor mir ein großes Becken voll Wasser und rund herum hockten eine ganze Anzahl Jammergestalten, wachsbleich im Gesicht, mit schmerzverzerrten Zügen und irren Blicken, die Hände in das Becken getaucht. Es waren die, die sich die Pulsadern geöffnet hatten. Man gab sich wirklich alle Mühe, Selbstmorde zu verhindern. So weiß ich von einem Mann, der Gift genommen hatte. Er war in einem fürchterlichen Zustande und es war keine Kleinigkeit, ihn wieder auf die Beine zu bringen. Als es endlich so weit war, wurde er erschossen. Jede Nacht gab es eine andere Aufregung, ich entsinne mich nicht einer einzigen ruhigen Nacht. Nach Mitternacht kamen gewöhnlich einige "Delegierte", um junge Frauen und Mädchen für die Offiziere zu holen. Wir versuchten sie nach Möglichkeit zu verstecken, aber es half wenig. Was überhaupt in dieser Beziehung alles geschah, fällt mir schwer zu erzählen. Man stelle sich das Schlimmste vor und es bleibt bestimmt noch weit hinter der Wahrheit zurück. Eine beliebte Unterhaltung waren auch die nächtlichen Plünderungen. Ich und die mit mir Gekommenen hatten diesbezüglich nichts zu befürchten, da wir nichts besaßen, die anderen aber mußten jeden Augenblick gefaßt sein, daß ihnen das wenige genommen wurde, das ihnen noch verblieben war. Das erste, was ausnahmslos allen gestohlen wurde, waren die Uhren. Am beliebtesten waren die Armbanduhren. Ein Asiate hatte deren ungefähr 20 um den Arm. Mit einer bestialischen Grimasse entriß er den hilflos Daliegenden ihr letztes Stück. Schrecklich anzusehen waren die Leiden der Kranken, die in Behandlung gewesen waren und jetzt ohne ihre gewohnten Medikamente und ihre Diät hier elend zugrunde gehen mußten. Man hatte ja sogar die meisten deutschen Kranken aus den Spitalbetten gejagt. Ein ganz besonderes Vergnügen fanden unsere sadistischen Peiniger darin, uns stundenlang anstellen zu lassen, sei es, um uns zur Arbeit zu führen, sei es, um uns ganz einfach nach einigen Stunden wieder in den Saal zu jagen. Ob es regnete, ob die Sonne brannte, wir durften uns dann nicht von der Stelle bewegen, nicht umdrehen, nicht sprechen. Von der eigenen Qual abgesehen, mußte ich dann manchmal meine ganze Vernunft zu Hilfe rufen und mich beherrschen, um nicht so einem Untier an die Gurgel zu springen, wenn wir zusehen mußten, wie es einen armen kranken, alten Mann schlug, an den Haaren zerrte oder ihn zu irgend einer lächerliche Pose zwang, weil dieser vielleicht nach rechts geschaut hatte anstatt nach links. Eines Tages verbreitete sich die Nachricht, daß wir in ein anderes Lager kommen sollten. Ein lähmendes Entsetzen erfaßte uns, denn so jammervoll unser Dasein in diesem Lager war, so kannten wir unser Elend schon, wir wußten ungefähr, welches Maß an Qualen jeder Tag uns brachte. Wo anders war es womöglich noch schlimmer, vielleicht war es der sichere Tod. Warum ließ man uns nicht gleich hier verhungern? Denn daß wir langsam verhungern mußten, daran zweifelten wir nicht. Theresienstadt wurde genannt, dann war die Rede von einem GPU Lager im Reich, aber etwas Genaues wußte niemand. Endlich, eines Tages wurde es Ernst, es begann wie immer, nämlich mit einem stundenlangen Anstehen, diesmal auf der Treppe, dann ging es endlich ein Stockwerk tiefer, dann wieder zwei Stockwerke höher, schließlich waren wir wieder auf dem riesigen Hofe, wo wir uns in vier bis sechs Reihen hintereinander, mit dem Gesicht gegen die Wand anstellen mußten, um nicht zu sehen, was sich hinter uns abspielte, zeitweilig auch mit erhobenen Armen. Endlich nach mehreren qualvollen Stunden kam auch die Reihe an mich und die mir zunächst Stehenden. Wir durften uns umwenden und da sahen wir einige Tische, die man im Hofe aufgestellt hatte, hinter denen junge Mädchen saßen. Auf den Tischen befanden sich offene Kästchen und Schachteln, die einen gefüllt mit Markscheinen, die anderen mit Eheringen, wieder andere enthielten Dokumente. Man hatte anscheinend inzwischen erfahren, daß die Mark nicht außer Kurs gesetzt war und ihren Wert behalten hatte, daher hatte man beschlossen, die ausgeteilten Mark wieder abzufordern. Bei jener oben erwähnten Plünderung hatte man in einigen Zimmern noch die Eheringe respektiert. Auch dieses Versäumnis wurde jetzt nachgeholt. Auch eventuell noch vorhandene Personaldokumente wurden abgenommen. Nun hatten die meisten nichts mehr, wie ich schon lange nichts hatte. Über all diesen abstoßenden Vorgängen war schließlich der Abend herangekommen. Zu essen hatten wir an diesem Tage nichts bekommen, denn eigentlich hätten wir längst fort sein sollen. Angeblich hatte man nichts mehr für uns gefaßt. Nun war es zu spät zur Abreise und man begnügte sich nach dieser, wie wir meinten, letzten Plünderung, uns wieder hinaufzutreiben. Die oberen Räume waren inzwischen schon abgesperrt worden und wir mußten uns auf noch engerem Raum im I. Stock zusammendrängen. Plötzlich erschien einer der Aufseher, es war der, den wir alle am meisten fürchteten. Ich habe ihn nie anders als brüllend, wütend und betrunken gesehen. Er hatte aus irgend einem Grunde die Plünderung verpaßt, er kam zu spät, was seine Wut noch erhöhte. Er hoffte gleichwohl, daß noch hin und wieder ein Ring übersehen worden war und brüllte "Pfoten zeigen" indem er uns mit einem eigens zu diesem Zwecke mitgebrachten Stock dermaßen über die Finger schlug, daß einem Hören und Sehen verging. Da er nichts mehr fand, brüllte er immer mehr, sämtliche Kinder begannen vor Angst zu schreien, das steigerte noch seine Wut und er brüllte sie an, wie ich noch nie einen Menschen habe brüllen hören. Ich glaubte, das Trommelfell müsse mir zerspringen in dem Höllenlärm. Endlich, als er fort war, brachte man uns noch etwas Knäckebrot, 2 Scheiben für jeden mit der Bemerkung, nicht alles auf einmal zu essen, da wir morgen nichts mehr bekämen und den ganzen Tag auf der Reise sein würden. Endlich wollten wir uns zur Ruhe begeben, so gut das in diesem Gedränge möglich war, da hörten wir plötzlich einen ganz eigenartigen, beängstigenden Lärm, der immer anschwoll und sich immer mehr näherte. Im Hause begann ein Rufen, ein Rennen, Kommandos ertönten, es war eine ganz außergewöhnliche Aufregung zu spüren. Da schrie plötzlich jemand, der am Fenster gestanden hatte, "um Gottes Willen". Wir stürzten hin und erblickten in der beginnenden Dämmerung eine unabsehbare Menschenmenge, die näher und näher kam und die wild mit Stöcken und Knüppeln herumgestikulierte und drohende Rufe ausstieß. Das galt uns. Man hatte erfahren, daß wir am nächsten Morgen Prag verlassen und somit ihrem Machtbereich entrückt werden sollten und so kamen sie, um sich noch schnell ihr Mütchen an uns zu kühlen. Man wollte uns ganz einfach lynchen. Ich glaubte, mein Herz stehe still vor Entsetzen. Eine unbeschreibliche Panik brach aus. Einige heulten auf wie wilde Tiere, manche schmiegten sich eng aneinander, wie um sich gegenseitig zu schützen, wieder andere standen stumm, zu Bildsäulen erstarrt, blaß wie die Wand und zitterten heftig an allen Gliedern. Es war eine der gräßlichsten Szenen, die ich je erlebt habe. Wir waren uns klar darüber, daß wir rettungslos verloren waren. Was hätten wir Unseligen, von Hunger und Mißhandlung zu Tode geschwächt, ohne Waffen vermocht, gegen die rasende, aufgehetzte Menge? Es gab anscheinend Unterhandlungen zwischen den Aufsehern und den Rädelsführern, dadurch ging wertvolle Zeit verloren und inzwischen geschah ein Wunder, ein wirkliches, wahrhaftiges Wunder. Niemandem war es aufgefallen, daß sich etwa ein besonderes Unwetter vorbereitete und doch war es plötzlich da. Mit einem Schlage brach ein Wolkenbruch los, mit Sturm und Hagel, Blitz und Donner folgten einander Schlag auf Schlag. Da verzog sich der Mob schreiend und rennend, einer von den vernünftigeren unter unseren Wächtern hatte schnell alle Tore verschlossen, wir waren gerettet. Am nächsten Morgen oder besser Mittag, wieder nach stundenlangem Anstellen in Treppen und Gängen, als wir vor Hunger schon fast ohnmächtig waren, denn jeder hatte selbstverständlich sein Scheibchen Knäckebrot schon längst verzehrt, gegen Mittag also begann der Abmarsch, jener grauenhafte "Todesmarsch". Auch die Rotgardisten, unsere Aufseher, wußten, daß dies endgültig die letzte Gelegenheit war, ihre sadistischen Gelüste an uns auszulassen und sie hatten sich anscheinend das Wort gegeben, diese Gelegenheit noch ein letztes Mal bis auf die Neige auszukosten. Wir mußten uns in Dreierreihen aufstellen, kaum aber war dies geschehen, behaupteten die Aufseher, sie hätten befohlen, uns in Viererreihen aufzustellen und sie schlugen und schlugen. Dann wieder sollten es Fünferreihen oder sogar Sechserreihen sein, dann plötzlich wieder Dreierreihen und so ging es fort Es entstand ein unbeschreibliches Durcheinander, umsomehr als jeder Aufseher in seinem Bereich andere Befehle erteilte. Man kam kaum von der Stelle und die Aufseher brüllten und fluchten und schlugen und stießen blind darauf los. Ich erhielt einen fürchterlichen Rippenstoß mit einem Gewehrkolben und einen Hieb über die Schulter, weil ich bei dem Gewimmel plötzlich außer der Reihe stand. Endlich hatten sie von diesem Spiel genug und um die verlorene Zeit einzubringen, mußten wir nun rennen, immer schneller, immer schneller. Ich kann mich erinnern, daß ich ein Stoßgebet zum Himmel sandte, ich möchte doch das Glück haben, tot niederzusinken, um von dieser nicht mehr zu ertragenden Qual erlöst zu sein. Andere mögen es auch getan haben. Es war das auch der letzte Tag unserer armen Österreicherin, von der ich weiter oben gesprochen habe. Auch viele andere überlebten ihn nicht. Jeder Schritt barg eine Lebensgefahr. Ich glaube, daß auch ein ganzer Zug aus einem anderen Lager zu uns gestoßen war und da gab es noch viele, die sich mit Koffern und dergl. abschleppten. Als nun dieses fürchterliche Rennen begann, blieb den Armen nichts übrig, als das schwere, sie behindernde Gepäck wegzuwerfen, um nicht erschlagen zu werden. Und andauernd, längs des ganzen Weges, diese Beschimpfungen seitens der Bevölkerung, diese andauernden Drohungen. Jeder versuchte in die Mitte zu gelangen, da die Gefahr am äußersten Rande am schlimmsten war. Viele kamen zu Fall, was aus ihnen geworden ist, weiß ich natürlich nicht, wir mußten weiter, immer schneller, immer schneller, über die Gestürzten hinweg. Hätten wir uns ihrer angenommen, wären wir selbst erschlagen worden. Endlich waren wir auf dem Hyberner-Bahnhof (jetzt wieder Masarykbahnhof) angelangt. Man führte uns von rückwärts in das Bahnhofsgelände, von der Florenzerstraße, da wurde plötzlich Halt geboten. Ein Aufseher rief in einem seltsam freundlichen Tone: "Wir suchen eine Frau mit höherer Bildung, Kenntnis fremder Sprachen und doppelter Buchführung erwünscht. Wer meldet sich?" Ein paar Bedauernswerte, die das Spiel noch immer nicht begriffen hatten, meldeten sich. Sie glaubten wohl, sie könnten ihre Lage verbessern und in Prag bleiben, vielleicht gar in einem Büro arbeiten. Da packte der Aufseher eine davon am Kragen, riß sie aus der Reihe und brüllte: "Also komm, du Sau, du wirst jetzt alle Aborte des Bahnhofes reinigen." Die Arme mußte ihm folgen, unter dem Geschrei, dem Gelächter und dem Beifallsklatschen der Menge, die draußen vor dem Gitter, wodurch das Bahnhofsgelände abgeschlossen war, sich Kopf an Kopf drängte. Der Befehl kam, den Kopf zu senken, nicht rechts und nicht links schauen und sich nicht zu bewegen. Es ist zwecklos, beschreiben zu wollen, was sich hier abspielte, das kann man einfach nicht beschreiben. Eine Kopfwendung um Haaresbreite konnte den Tod bedeuten und hat ihn wohl auch für viele bedeutet. Unter der gesenkten Stirn hervorschielend, sah ich dennoch, wie in entgegengesetzter Richtung ein Elendszug an uns vorüberzog, alle blutüberströmt, unter ihnen auch unser Dr. Günther. Was man ihnen getan hatte, woher sie kamen, weiß ich nicht. Dazwischen immer wieder ein Karren, auf dem ein Sterbender oder ein Schwerverletzter lag, mehrere auch vom Herzschlag getroffen, wie ich annehme. Die johlende Menge draußen verfolgte das Schauspiel mit steigendem Interesse und brach jedesmal bei einem besonders gelungenen Streich in lauten Jubel aus, z. B. wenn einer fiel und sich nicht mehr erhob. Mein Blickfeld war unter den geschilderten Umständen natürlich sehr eingeschränkt und von all den Greueln, die dort geschahen, konnte ich mehr ahnen als sehen. War ich doch selbst dem Tode näher als dem Leben. Ich entsinne mich nur eines Höllenlärms, gemischt aus Gelächter, Gejohle, Beifallsklatschen, den Schmerzschreien der Gepeinigten, dem Gewimmer der Sterbenden, dem Getrampel unzähliger Füße. Endlich trieb man uns, immer mit Kolbenhieben, über viele Schienen hinweg, einem Eisenbahnwaggon zu, der für uns bestimmt war. Es sah aus, als ob die Aufseher Korn mähten, mit ihren Gewehrkolben, denn sie hatten es diesmal auf die Beine der Laufenden abgesehen, um sie zu Fall zu bringen. Ich hatte das "Glück", daß gerade vor mir eine Frau auf die Schienen stürzte und bevor er zum neuen Schlage ausgeholt hatte, war ich durchgeschlüpft. Der Waggon war natürlich ein Kohlenwagen und wir mußten uns auf den Boden hocken, den eine mehrere Zentimeter dicke Schicht von Kohlenstaub bedeckte. Er war natürlich viel zu klein d. h. es waren deren mehrere, aber es wird wohl überall dasselbe gewesen sein. In meinem seit Wochen nicht abgelegten Kleide drückte ich mich in eine schmutzige Ecke, für den Augenblick froh, der unmittelbaren Todesgefahr entrückt zu sein. Wir wurden hineingestopft wie Vieh oder irgend eine leblose Ware. Kaum aber waren wir verladen, erschienen noch einmal die Rotgardisten, diesmal in Begleitung ihrer Freundinnen und luden sie ein, sich zu bedienen, wenn ihnen etwas gefiele, was wir noch auf dem Leibe hatten. "Genier dich nicht, nimm dir was dir gefällt. Schau, dieser Pullover ist doch ganz hübsch," usw. Die meisten Mädchen machten geringschätzige Grimassen und beteuerten, daß ihnen nichts gefiele. Ich glaube jedoch, sie schämten sich, uns die Kleider vom Leibe zu reißen und stellten sich deshalb so, als gefiele ihnen nichts. Einige indessen waren weniger zartfühlend und so manche Wollweste, mancher Pullover wurde seiner Besitzerin ausgezogen. Eine junge Frau trug ein Paar Männerhosen, die einem der Aufseher in die Augen stachen. Sie mußte sie auf der Stelle ausziehen und blieb in ihrer Unterwäsche zurück. Es war wirklich nichts mehr da, was man uns hätte nehmen können, wenn man uns nicht nackt ausziehen wollte und so setzte sich der Zug endlich in Bewegung. Eine Wache mit aufgepflanztem Bajonett saß auf einem erhöhten Sitze. Uns war es strengstens verboten, uns zu erheben und so kauerten wir so gut es ging in dem dicken Kohlenstaub. Wenn jemand sich nur ein einzigesmal aufzurichten versuchte um sich ein wenig von der unbequemen Stellung zu erholen, fiel sofort ein Schuß in nächster Nähe, ohne daß wir je den Schützen entdeckten. In einigen Stationen hielt der Zug, dann erschienen immer ein paar asiatische Gesichter über der Wagenwand und fragten grinsend: "Wohin schaffst du das?" "Dorthin, wo sie hingehören, in die Leibeigenschaft" (do roboty) war die unabänderliche Antwort. In meinem Besitz befand sich ein schmutziges zerrissenes Kleid, eine ebensolche Garnitur Unterwäsche und ein Paar Gummistiefel, welche ich von einer Erschossenen geerbt hatte. Sonst nichts!
Ich versichere an Eidesstatt, daß vorstehender Bericht in allen Punkten der Wahrheit
entspricht.
|