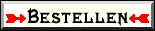|
 Kapitel 16: Die Thorner Verschleppten: durch die Hölle von Warschau in die Freiheit Am gleichen Morgen ist der Thorner Zug von Blonie aufgebrochen, um nun in einem letzten Marsche bis nach Warschau zu gelangen. Sein ursprüngliches Ziel war die Festung Modlin, hier gerieten sie jedoch schon zwischen zwei Fronten, so bogen sie in wilder Hast nach Norden aus, während die Granaten ihre heulenden Bogen über sie zogen. Um zwei Uhr tauchten  im Dunst des
Mittags Warschaus Türme auf, um vier Uhr landeten sie im
Park des Klosters Ojzow Marianny. im Dunst des
Mittags Warschaus Türme auf, um vier Uhr landeten sie im
Park des Klosters Ojzow Marianny.Unter den Bäumen gibt es eine letzte kurze Rast, dann biegen sie in die erste Vorstadtstraße ein, marschieren zur nördlichsten Brücke in Praga. Als sie sich der Vorstadt Praga jedoch nähern, erkennt der Kommandant gerade noch rechtzeitig, daß man in seinen Straßen schon heftig kämpft, deutlich hallt das Bellen der Panzerkanonen herüber. Durch schon zerstörte Straßenzüge geht es nochmals zurück, schließlich erreichen sie das eigentliche Warschau im Judenviertel Nalewki. Hier sind die Straßen schwarz vor Kaftanjuden, die auch sehr bald erkennen, daß es sich um einen Zug Verschleppter handelt. Alsbald schlagen sie wütend mit ihren Regenschirmen auf sie ein, speien sie wie in ihren rituellen Gebeten voller Abscheu an, dennoch wirkt ihr Gebaren auf [159] diese Leidgewohnten fast komisch. "Da haben wir andere Sachen hinter uns!" meint der alte Rausch. Er macht den heutigen Marsch neben einem Manne, der nicht weniger alt als er sein kann, aber gleich ihm auffällig rüstig fürbaß schreitet. "Ich habe in Thorn einen Mann gut gekannt", sagt der Alte, "der das gleiche schon mal in Sibirien durchmachte. Er soll auch in diesem Zuge sein, ob der's wohl durchhielt?" "Wer ist das?" fragt ihn Rausch. "Der alte Rausch", sagt der Fremde. "Aber das bin ja ich!" ruft der Sibirier. "Und wer sind Sie?" setzt er hinzu. "Ich bin Bruck!" sagt der Alte. "Aber du bist der Rausch?" wiederholt er dann staunend. "Und da laufen wir nebeneinander her - erkennen uns nicht einmal - wo wir eigentlich die besten Freunde sind?" "Du bist der Bruck?" Rausch schüttelt nur den Kopf, kann es auch nicht recht glauben. "Das ist ein gutes Beispiel", sagt er nach einer Weile, "so sehen wir armen Hunde also aus, daß sich die besten Freunde nicht erkennen!" Er räuspert sich, fährt dann fort: "Aber daß wir uns gerade jetzt noch fanden, das ist zu allem hin 'ne schöne Sache - denn ich werde das verdammte Gefühl nicht los, als ob uns zum Schluß noch was Besonderes erwarte! Aber zusammen, meinst du nicht auch, zusammen schaffen wir auch das..." Er hat nicht falsch gedacht, eine Weile geht es noch durch die Juden, ihre kreischenden Belästigungen beach- [160] ten sie aber kaum, einzelne lachen sogar innerlich über ihr Gehaben. Die Nacktfüßigen genießen vor allen Dingen erst einmal den Asphalt, den sie seit kurzem unter ihren müden Beinen spüren. Mein Gott im Himmel, wie gut der ihren Wunden tut, kein mahlender Staub mehr, sondern eine wunderbar glatte Masse, die sich wie eine kühlende Kompresse an die Sohlen legt. Sie schreiten trotz ihrer völligen Erschöpfung mit einem Male neubelebt dahin, nach dieser seltsamen Erfrischung werden sie auch den letzten Sturm heil überstehen. Das Judenviertel ist zu Ende, die ersten Barrikaden zeigen sich, damit beginnt das letzte Kapitel...
 Auf den Barrikaden, von allen möglichen Fahrzeugen gebildet, teilweise aus umgestürzten Straßenbahnwagen, oft auch nur aus riesigen Kisten aufgestapelt, stehen nicht nur polnische Soldaten, steht auch in dichten Knäueln Zivilbevölkerung. Schon als der Zug den ersten Durchlaß passiert, den man in der Mitte der Barrikaden zur Passage freiließ, erhebt sich bei seiner Besatzung ein ohrenbetäubendes Geschrei. Im gleichen Augenblick prasselt es schon von allen Seiten auf sie nieder, fliegen in dichtem Wirbel Steine auf sie herab, werden sie von tausend scharfkantigen Holzstücken überschüttet. An den Durchlässen hat sich unglaublich rasch eine Spießrutengasse gebildet, aus der man mit irgendwelchen aus den Barrikaden herausgegriffenen Brettern auf sie einschlägt. Die gefährlichsten Schläge von allen sind dabei jene, die von den [161] auf den Barrikaden Stehenden auf ihre Köpfe geführt werden. "Gib deinen Arm, Bruck!" ruft Rausch hastig. "Eingehängt geht es besser, stützt einer den anderen! Um den anderen Elbogen die Jacke gewickelt, den Arm damit über den Kopf gehalten..." Die beiden Alten können sich gerade noch ein wenig herrichten, dann schwemmt es auch sie schon durch den engen Durchlaß. Ein vor ihnen gehender jüngerer Mann erhält von einem Soldaten einen Schlag mit dem Kochgeschirr ins Gesicht, daß ihm das Blut in breitem Strom über die Brust läuft, aber auch ihn hält ein Kamerad über den Moment des Zusammenbrechens auf den Beinen. Die beiden Alten kommen an dieser Barrikade ziemlich heil vorbei, erst an der dritten, mitten in der Stadt, erst in dem Augenblick, als sie schon die offenen Gefängnistore sehen, erhält der alte Bruck einen Schlag über den Kopf. "Auf, Mensch, auf!" ruft der Sibirier. "Wir sind am Ziel, nur jetzt noch halt dich, nur zwanzig Schritte noch..." Schon wollen dem Alten die Knie sinken, als dieser Ruf in seine Ohren stößt, er gleichzeitig den Arm des Kameraden fühlt, der ihn mit letzten Kräften weiterschleift... "Laufschritt!" schreit jemand schrill. Da beginnen sie sogar noch einmal zu laufen, laufen die letzten Fünfhundert keuchend dem Tore zu, werfen sie ihre müden Beine noch einmal angstgepeitscht über den Asphalt - [162] eine ganze Anzahl aber ist zu diesem letzten Laufe nicht mehr fähig, sie bricht trotz aller Hilfe der Kameraden noch hier unter den Schlägen zusammen, ihnen verlöscht noch angesichts des rettenden Gefängnistores das letzte Fünkchen Leben. Im Gefängnishofe der Dzielna sinkt erst mal alles auf die Erde, wischt sich das Blut von den zerschlagenen Gesichtern, sucht durch ruhiges Atmen allmählich wieder Luft zu bekommen. "Hier ist jedenfalls das Ende unseres Marschierens!" sagt der alte Rausch schwer atmend. "Heraus bringen sie uns hier nicht mehr, denn anscheinend ist Warschau schon völlig umzingelt..." Dieses Gefühl haben auch die meisten anderen, so hebt sich ihre Stimmung verwunderlich rasch. Nur nicht mehr marschieren müssen, alles andere ist hundertmal leichter zu ertragen! Mögen sie ihnen nichts zu essen geben, mögen sie alle in Dunkelzellen stecken, nur nicht mehr laufen müssen mit den offenen Füßen... Nach einer Weile werden sie zu je zehn Mann abgezählt, werden alle in Gruppen ins Frauengefängnis gebracht. Die Zellen sind zwar nur jeweils für drei berechnet, aber sie haben deswegen nicht weniger Platz als bisher. Und als es abends sogar ein richtiges Essen gibt, einen Liter Suppe für jeden Mann, in der anscheinend Fleisch gekocht war, man sie schließlich sogar zum Waschen hinausführt, scheint ihnen die Nacht die beste seit ihrem Auszug. Am nächsten Morgen holt man sie wiederum heraus, [163] führt man sie wahrhaftig unter eine Brause. Zum ersten Male seit Wochen dürfen sie die Kleider vom Leibe tun, solch ein Glück kann jemand nur ermessen, der in seinem Leben schon einmal eine gleiche Lust empfand! Mancher zieht hier zum ersten Male auch seine Schuhe aus, denn durch die plötzlichen Aufbrüche wagte es niemand, sie auf den Marschpausen einmal herunter zu tun, nachdem viele sie im Anfang durch die überstürzten Abmärsche im Dunklen oft nicht wiederfanden. So kehren sie denn zum ersten Male gesäubert in ihre Zellen zurück, sogar die Wäsche hat man ihnen zum Waschen abgenommen, auch diese erhalten sie zu aller Überraschung nach zwei Tagen sauber zurück. Die alten Marschkameraden haben sich schon bei der Einteilung geschickt zusammengestellt, so sitzen sie auch jetzt wieder in einer Zelle beisammen. Dr. Raapke besitzt sogar noch ein paar Zigaretten, aber leider nur mehr eine winzige Anzahl Streichhölzer. Als sich aber eine Stecknadel findet, weiß ein alter Häftling sofort Rat: Er teilt damit jedes Streichholz in vier Teile, so sind sie auch hiermit für manchen Tag versorgt. Dieser alte volksdeutsche Vorkämpfer ist es auch, der ihnen an den langen Tagen von anderen Gefängnissen erzählt, in denen er mit Unterbrechung immer wieder längere Zeit zubrachte. "Wir können froh sein, daß wir hierher kamen", sagt er einmal. "Denn wenn wir nach Bereza-Kartuska gekommen wären, in das berüchtigte polnische Konzen- [164] trationslager, dort gibt es noch Strafen wie bei uns im Mittelalter... Wenn einer zum Beispiel Dunkelarrest kriegt, so wird seine unterirdische Zelle einen Fuß hoch mit Wasser gefüllt, so daß er sich tagelang nicht hinlegen kann... Hat sich einer gegen einen Vorgesetzten vergangen, bindet man ihm Arme wie Beine so im Winkel zusammen, daß man durch Kniekehlen wie Elbogen einen Besenstiel schieben kann, dieser wird dann auf ein hohes Gestell getan, daß er daran mit dem Kopf nach unten umgekippt hängt. Nun bindet man ihm den Mund zu, läßt durch einen Schlauch so lange Wasser in seine Nase, bis er vor Schmerzen ohnmächtig wird, worauf man ihn auf die erhobenen Fußsohlen schlägt, bis er vor Schmerzen wieder zu sich kommt, alsdann beginnt die Prozedur von neuem... Bei den Verhören haben sie einen Elektrisierapparat, einen seiner Pole halten sie dem Häftling an die Nase, den anderen aber ans Kinn, dann schicken sie schwere Stromstöße durch den Apparat, so daß es ihm jedesmal die Kiefer mit Urgewalt aufeinanderschlägt, viele haben sich dabei schon die Zuge abgebissen..." Die Internierten schütteln sich, manchem läuft es kalt über den Rücken. "Eine wahre Kulturnation!" sagt Dr. Raapke schließlich. "Dabei weiß ich genau, daß viele von uns dort waren, auch jetzt sicher Hunderte dort sind, denen es nicht anders ergehen wird..." Der alte Rausch springt erregt auf, stößt dann in seiner überstürzten Weise aus: "Wer will nach diesem Ge- [165] schehen den Deutschen der Grenzprovinzen noch zumuten, jemals wieder mit den Polen in enger Nachbarschaft zu leben? Ist dort nicht jeder Pole mindestens der Verwandte eines jener Mörder, denen in jedem Fall ein Glied unserer Familien zum Opfer fiel? Und waren nicht zum mindesten alle geistig daran beteiligt, wenn auch vielleicht nicht gerade mit eigenen Händen?" "Sie haben völlig recht!" sagt Dr. Raapke entschieden. "Das kann niemand uns Deutschen jemals wieder zumuten, das müssen nicht nur unsere eigenen Leute, das müßten sogar die anderen Völker einsehen! Mit dem Bromberger Blutsonntag, mit den Hungermärschen, mit Bereza-Kartuska - mit diesen dreien hat Polen das Tischtuch zerschnitten, hat es selbst jedes nachbarliche Zusammenleben unmöglich gemacht..." "Werden wir denn überhaupt siegen?" fragt ein alter Mann kleingläubig. Da lächelt Dr. Raapke nur, sagt mit ruhiger Sicherheit: "Wer soll denn siegen? Die Polen vielleicht? Aber eine Nation, die das tun konnte, was man uns allen angetan, kann niemals ehrlich siegen, das dürfen Sie mir glauben... Im übrigen siegen wir noch aus ganz anderen Gründen, sie liegen jenseits alles militärischen Potentials, jenseits aller Strategie, aller Blockadetheorien: Es gibt nur ein Gesetz, das lückenlos gilt, sich immer bewahrheitet, das ist das biologische! England ist alt, Frankreich ist alt, Rußland ist jung, Deutschland ist jung - es siegen aber auf die Dauer immer die jungen [166] Nationen, die revolutionären Völker! Wir sind der revolutionäre Teil der Welt, er wird in jedem Falle siegen, weil er damit nur das Naturgesetz erfüllt - Polen hat sich unklugerweise der alten Hälfte der Welt angeschlossen, aus diesem Grunde wird es vernichtet werden, denn Feudalstaaten müssen sozialistischen immer unterliegen! Dieser Kampf ist ja auch kein Kampf um Macht im früheren Sinne, ist viel eher ein Kampf der armen Nationen gegen die reichen, ist als Aufstand der Völker dasselbe für die Welt, was die sozialen Revolutionen der Stände für die Einzelvölker waren, ist wie ihr Ringen um die gerechtere Verteilung der Güter innerhalb ihrer völkischen Grenzen, der Kampf um die Neuordnung der Besitzverhältnisse des ganzen Erdballs! 1918 siegten noch einmal die reaktionären, die saturierten Besitzenden, auf die Dauer siegen immer die revolutionären, mögen sie es nun im geistigen wie materiellen Sinne sein - so ist dieser zweite Weltkrieg auch im Grunde gar kein Krieg, sondern in viel entscheidenderem Maße eine große Revolution!" Sie schwiegen alle lang, endlich sagte jemand leise: "Sie haben völlig recht mit Ihrer These, erfüllte sie sich nicht, verlöre die Weltgeschichte ihren Sinn!" Nachdem die ersten Tage schnell vorübergingen, beginnen sich die nächsten schleppend hinzuziehen. Zuweilen erhalten sie durch einen Kalfaktor auch Frontnachrichten, aber diese sind meist so widerspruchsvoll, daß man ihren wahren Kern nur durch geschickte Auslegun- [167] gen herausschälen kann. Zu ihrem Glück bleibt das Artilleriefeuer auch weiterhin dauernd hörbar, so wissen sie wenigstens, daß die deutschen Truppen immer noch ihre alten Stellungen haben. Ganz in der Nähe des Gefängnisses steht eine schwere polnische Flakbatterie, sie wird fast jede Stunde einmal alarmiert, daraus schließen sie wieder freudig auf ununterbrochene Fliegerangriffe. Diese Batterie hat allerdings gleichzeitig den Nachteil für sie, daß auch die deutsche Artillerie fleißig nach ihrem Mündungsfeuer sucht, so schlägt denn alle Augenblick eine schwere Fünfzehnergranate in ihrer Nähe ein. Die Frauen haben es in der Dzielna im Anfang weniger gut als die Männer, aber auch sie dürfen gleich nach dem Einzug an eine große Wäsche gehen. Als erstes macht sich die gütige Frau, deren Kleidung gerade noch die Diakonissin verrät, wieder an ihre oft getane Arbeit, die wundgelaufenen Füße zu verbinden. Vor allem ist es die Tochter eines Schlossermeisters, die mit ihren Füßen fast am Ende ist, die ganzen Sohlen sind voller wässeriger Blasen. Die Diakonissin wäscht sie sorglich ab, allmählich tauchen die Zehen wieder aus dem Schmutz. "Aber was ist denn das", fragt sie plötzlich erschrocken, starrt verwundert auf die Zehennägel, die ein giftiges Rot zeigen, "vielleicht eine Blutvergiftung?" Aber das Mädchen errötet jählings, sagt schließlich mit verräterischer Eile: "Oh, nichts, nein..." In diesem Augenblick kommt gerade Trudchen vorbei, [168] das aber alle das "Sonnenscheinchen" nennen, ein stadtbekanntes Mädchen leichter Art, das man gleichfalls in den Zug steckte, das aber bei allen aufrichtig beliebt wurde, da es keinen Augenblick den Mut verlor. "Soll ich dir noch etwas Lack zum Nachfärben geben?" lacht sie nur. "Ich hab mein Fläschchen trotz allem noch bei mir..." Ob dieses Mädchen sich in seinem Leben, denkt lächelnd eine ganze Reihe, wohl einmal noch die Zehennägel färbt? Am nächsten Tage kommandiert man jedoch schon alle in die Waschküche, um ungeheuere Mengen von Sträflingswäsche sauber zu machen. Hier müssen sie nun täglich zwölf Stunden im Dampfe stehen, in der Wäsche kriechen teilweise schon Würmer herum, andere kommt wieder aus den Lazaretten, sie ist oftmals ganz steif von altem Blut. Aber auch diese Arbeit hat ihre kleinen Freuden, finden sie nicht zuweilen ein Hemd von einem Kriegsgefangenen, in dem auf sauberem Bändchen geschrieben ist: Schütze Meier...? Nach einer Woche hört jedoch auch diese Arbeit auf, da die Wasserleitung plötzlich den Dienst versagt. In der gleichen Nacht hören sie auf der Straße wildes Geschrei, das trotz mancher Pistolenschüsse nicht mehr zur Ruhe kommt. Am anderen Tage erzählt ihnen ein Kalfaktor, daß es bereits zu Hungerrevolten gekommen sei, da es in ganz Warschau schon kein Brot mehr gäbe. In diesen Tagen wird das Essen in schnellem Maße schlechter, als erstes bleibt die Suppe aus, dann fallen [169] auch die Kartoffel fort, schließlich gibt es nur mehr eine Art Bohnentee, eine schwach gefärbte Flüssigkeit mit ein paar darin herumschwimmenden Bohnen. Um diese Zeit sterben auch noch ein paar ältere Leute, sie werden von der Nahrungsverschlechterung gleichsam sofort umgeworfen, einer davon geht an jäh ausbrechender Ruhr zugrunde. Es runden sich allmählich vierzehn Tage, die sie hier verbringen, zu Anfang ging es ja noch, auf diese Weise aber hält es niemand lange aus. Wieder beginnt der Hunger, beginnt auch wiederum der Durst - es kommt keinerlei Nahrung mehr herein, die Wasserleitungen bleiben zerschollen... Sie wollen schon allmählich alle Hoffnung fahren lassen, als plötzlich ringsum ein ungeheures Bombardement beginnt. "Das ist der Schlußakkord!" schreit Rausch begeistert. "Nun müssen wir nur noch den überstehen, dann ist auch Warschau in deutscher Hand!" Er hat richtig kombiniert, der alte sibirische Gefangene. Zwei Tage lang donnert es um sie her, als ob die Erde sich berstend neugebären wolle, fast alle Scheiben platzen an den Fenstern, die schweren Mauern geraten in immer härtere Schwingungen. Zuweilen schlägt auch eine Granate im Gefängnis ein, wiederum wird jedoch gerade der Trakt, in dem die ganzen Volksdeutschen sitzen, von keiner einzigen der tausend Einschläge ernsthaft getroffen. Allmählich singen alle Trommelfelle so, daß niemand mehr ein Wort versteht, ein paar beginnen wieder irre zu werden, einer von ihnen beginnt zu [170] predigen: "Ich bin der Herr dein Gott, ich werde euch erretten, so steht es geschrieben..." Mit einem Male verstummt das ungeheure Bombardement, wird es nach einem letzten Höllenwirbel wieder totenstill. "Jetzt sind sie niedergekämpft, jetzt zeigen sie die weiße Fahne!" denken die Gefangenen. Eine brennende Spannung ergreift alle, was wird die nächste Stunde bringen? Aber ein paar Stunden lang geschieht noch nichts, am späten Abend erst öffnet sich plötzlich die Zellentür, auf der Schwelle steht mit weißem Gesicht ein Oberst. "Sie sind frei", sagt er nur, "Sie können gehen..." Wer könnte wohl beschreiben, was auf dieses Wort geschah? Aber Dr. Raapke mahnt bald zu Vernunft, rät den Übereifrigen, doch besser bis zum Morgen zu bleiben. So liegen sie noch eine Nacht in den Zellen, werden am anderen Morgen auch ordnungsgemäß entlassen. Der Pfarrer Dietrich begibt sich derweil auf die Kommandantur, kommt auch endlich gegen Mittag mit einem Major zurück, der den Zug durch die polnische Frontlinie bringen soll. So marschieren sie denn endlich ab, durch das zerschossene Warschau hindurch. Alle Straßen liegen voller Schutthaufen, manche Häuser sind förmlich wie von innen ausgeblasen, bei ihnen stehen nur noch die Umfassungsmauern. Zuweilen sehen sie halb aufgefressene Pferdekadaver, darüber heruntergerissene Straßenbahnleitungen, an den alten Batteriestellungen liegen Haufen von Gefallenen. Gegen vier [171] Uhr nachmittags nähern sie sich der Front bei Mokotow, in der Nähe liegen Dutzende ausgebrannter Tanks, dazwischen reihenweise die Bespannungen von Batterien. Mitten auf dem Schlachtfeld müssen sie warten, während der Pfarrer Dietrich mit dem Major zur deutschen Front vorgeht. Es vergeht eine Stunde, es vergehen drei, allmählich wird es Nacht. Die Verschleppten drängen sich wie eine Schafherde zusammen, in ihrer Mitte hocken sich die Frauen nieder, die Nacht beginnt für ihre dünnen Hemden eisig zu werden. In stiller Klarheit geht der Mond auf, in seinem Scheine ziehen hunderte polnischer Flüchtlinge zurück, die man an der Front anscheinend nicht durchließ. Da sie auf einem kleinen Hügel liegen, können sie weit ins polnische Land blicken: Es zieht sich in seiner traurigen Schönheit bis zum nächsten Horizont, zuweilen nur ragt auf der weiten Ebene eine fahlweiße Birke auf. In der Ferne legt sich leiser Nebel über ein Dorf, seine ärmlichen Holzkaten sitzen am Boden, als duckten sie sich ängstlich in den Schoß der Erde - über die Schauenden aber wie über dies Dorf spannt sich der gleiche nächtliche Himmel, still rudert der gelbe Mond durch seine endlosen Räume, wie silberne Tränen hängen in ihm mit leisem Glitzern die Sterne. Um Mitternacht endlich kommt der Pfarrer zurück, alles ist vorbereitet, nun können sie auch den letzten Weg beginnen. Das Schlachtfeld wird mit jeden hundert [172] Metern furchtbarer, zu Dutzenden liegen die weißen Pferdekadaver umher, dazwischen mit gähnenden Mäulern umgestürzte Kanonen, zum Teil auf diesen wieder Protzenwagen, die ihre Granaten weit umher verstreuten. Von den Häusern ringsum stehen nur mehr die Schornsteinstümpfe, auf den Höfen liegen zahllose verbrannte Lastwagen, dazu ist alles von einem solch schauerlichen Leichengeruch erfüllt, daß viele Frauen ob dieser grausigen Zerstörung leise vor sich hinstöhnen. "Woina na woina!" sagt der führende Major, zuckt müde die Achseln. "C'est la guerre!" würde der Franzose sagen - "Das ist der Krieg!" sagen wir Deutsche. Ja, das war er, genau so war er wohl, wie sie ihn hier schaudernd sahen, bei ihrem letzten Nachtmarsch in die Freiheit... Aber dieser Anblick erfüllt sie nicht nur mit Grauen, er verkündet ihnen auch den überwältigenden Sieg, den deutschen Sieg über Polen in einem Ausmaß, wie sie es nicht einmal in ihren Träumen zu hoffen wagten. Endlich sieht die Spitze vor einem Dorf einen Soldatentrupp, ist das nicht eine Truppe deutscher Offiziere? Da sprengt es jählings alle Ordnung, zerspringen alle Glieder in hundert Stücke, beginnt der ganze Zug mit einem Mal zu laufen... Dann stehen die ersten vor ihnen, schauen sie mit starren Augen an: Die grauen Uniformen, das braune Lederzeug, die alten Stahlhelme! Und ein paar junge Mädchen... werfen sich ihnen an die Brust - weinen [173] an ihnen so haltlos auf... als ob sie niemals wieder enden könnten.
 Als Pfarrer Dietrich aber dann die erste Zählung machte, mußte er feststellen, daß jeder fünfte seines Zuges auf Polens Straßen blieb. Das war für sich genommen keine übergroße Zahl, aber zogen nicht neben diesem Zug noch zahllose andere durchs Land? Und blieben nicht von jedem hunderte liegen, nachdem zuvor schon tausende in den Städten gefallen? Erschoß man nicht sogar im Heere tausende, obwohl sie dort als Soldaten untadelig ihre Pflicht getan? Fielen nicht Bauern an ihren Pflügen, Mütter beim Stillen ihrer Säuglinge, fielen nicht Kinder selbst bei kindlichem Spiel? Das Schicksal einiger weniger wurde bekannt, das Schicksal Zehntausender wird man niemals erfahren. An unzähligen Stätten wurden die weiten Ebenen dieses Landes zu einem deutschen Friedhof - an den Straßen Polens aber stehen für alle Zeiten seine unsichtbaren Kreuze...
|