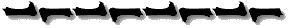|
Die Leiden der Kolonialdeutschen Auf der Geschichte Frankreichs wird die Behandlung der wehrlosen Deutschen in Nord- und Westafrika stets als einer der schwärzesten Punkte haften bleiben. "Erschwerend fällt vor allem ins Gewicht, daß es sich um fernes Tropenland handelte, daß also eine Entschuldigung für Kriegsnotwendigkeiten nicht vorlag", schrieb der Schweizer Arzt und Forscher Prof. Dr. Forel in seinen Einführungsworten zu einem Buche über dieses traurigste Kapitel französischer Gewaltherrschaft in Afrika. Die Gemeinheit der Franzosen lag aber vor allem darin, daß sie im Augenblick der Kriegserklärung bei allen Deutschen den Diener zum Herrn machten, die Schwarzen bewaffneten und sie gegen ihre früheren Herren aufhetzten. Natürlich hatte das den Zweck, den Einfluß der Deutschen in diesem Gebiet für alle Zeiten zu untergraben. [256] Im Sultanat Marokko, wo Frankreich nur ein Protektorat hatte, mußte es nach dem Pakt der "offenen Tür" den Deutschen volle Freiheit lassen, allerhöchstens konnten die Deutschen des Landes verwiesen oder nach einem neutralen Hafen geschafft werden. Der Generalresident Liauthey, von Poincaré als der "heimliche König von Marokko" bezeichnet, hatte auch verschiedentlich Deutschen gegenüber sein Ehrenwort gegeben, daß das letztere geschehen würde. Dieses "Ehrenwort" galt nicht mehr als die ganze französische "Humanität", wie die erschütternden Berichte der Marokkodeutschen beweisen.
 Ich gebe zuerst den Erlebnisbericht von Fräulein Else Ficke in seinen wesentlichsten Teilen wieder, wie er 1918 im fünften Heft der Zeitschrift Meereskunde veröffentlicht wurde, nachdem der Vater Fräulein Fickes, der Konsul und bekannte deutsche Großkaufmann Heinrich Ficke aus Marokko, an den die Bitte gelangt war, einen Vortrag über seine Gefangenschaft zu halten, inzwischen an den Folgen der barbarischen Behandlung verstorben war. "Am 26. Juli 1914 fand sich ein großer Teil der deutschen Kolonie von Casablanca zum Tennis im Garten eines Landsmanns ein. Die Stimmung war recht fröhlich, und niemand ahnte den kommenden Schrecken. Der nächste Tag, der 27. Juli, brachte dem österreichischen Konsul die telegraphische Nachricht von der Mobilmachung Österreich-Ungarns gegen Serbien.... Die am Sonnabend nach und nach veröffentlichten Depeschen veranlaßten [257] den Verweser des Kaiserlichen Konsulats, auf Grund der aus Berlin drahtlos vorliegenden Nachrichten, daß die Mobilmachung bevorstände, die auf der Reede liegenden deutschen Dampfer 'Tetuan', 'Picador' und 'Energie' mit etwa dreißig wehrfähigen Deutschen nach Cadiz zu senden. Die Bestürzung im internationalen 'Anfa-Club', dem Treffpunkt der angesehen Kaufleute und Beamten Casablancas, war groß, als diese Maßnahmen langsam bekannt wurden. Für die noch zurückgebliebenen Wehrpflichtigen hatte das Konsulat den Dampfer 'Oldenburg' zurückbehalten. Alle diese Dampfer haben glücklicherweise ihre Bestimmungshäfen noch erreicht. Weniger glücklich war der deutsche Dampfer 'Gibraltar', der sich zur Zeit des Kriegsausbruchs in Magador befand. Er wurde von den französischen Behörden genommen und in 'Mogador' umgetauft. Er mußte dann einen Teil der deutschen Kolonie in die Gefangenschaft nach Oran bringen. Sonntag, den 2. August, morgens um 11 Uhr, wird im Depeschensaal der 'Vigie' eine Mobilmachungsordre Frankreichs angekündigt. Nachmittags wird den versammelten Konsuln mitgeteilt, daß die Polizeigewalt auf die Militärbehörden übergegangen sei, einige Augenblicke später erhält das deutsche Konsulat die amtliche Depesche aus Berlin über die deutsche Mobilmachung. In der Stadt herrscht lebhafte Bewegung. Am Dienstag, dem 4. August, morgens, wird von den französischen Behörden die deutsche Dampfmühle mit ihren Getreidevorräten [258] mit Beschlag belegt. Am Nachmittag erscheint der französische Konsul, begleitet von dem 'Chef du service diplomatique' von der Generalresidentur in Rabat, im deutschen Konsulat, um die Kriegserklärung zu überbringen. Die deutsche Flagge mußte eingezogen werden, und wir mußten uns 'zwecks unserer persönlichen Sicherheit' bis sieben Uhr abends im Privathause von Carl Ficke versammeln. Die französische Regierung forderte uns gleichzeitig auf, innerhalb 24 Stunden Marokko zu verlassen. Solange mußten wir in dem erwähnten Hause meines Onkels verbleiben. Nach und nach stellten sich die noch etwa hundert Köpfe zählenden Mitglieder unserer deutschen Kolonie im Hause meines Onkels ein, der auf eine Beköstigung und Unterbringung so vieler Menschen nicht vorbereitet war. Wir richteten uns für die Nacht ein, die Damen und Kinder möglichst in den Zimmern, die Herren in der Halle und auf den Korridoren, wo sie auf den Teppichen schliefen. Die Wache aus Senegalesen, unter einem Leutnant, zieht auf und besetzt die Gartentore, wird auch an die Umfassungsmauer gestellt mit dem Befehl, jeden niederzuschießen, der sich der Mauer nähere. Hiermit beginnt eine endlose Kette von Gemeinheiten, der empörendsten Behandlung, die uns auferlegt wurde, und von Beschimpfungen. Was die raffinierteste Bosheit nur ersinnen konnte, wurde an uns ausgeübt. Am nächsten Tage, am 5. August, verbrennt das Kaiserliche Konsulat seine Codes und übergibt das [259] Archiv dem italienischen Konsul. Während des Tages treffen verschiedene Herren aus Marrakesch ein. Am 6. August, nachmittags, kommt der französische Konsul mit einem Artilleriehauptmann zu uns und erklärt, daß wir alle als Kriegsgefangene betrachtet würden und sämtliche Waffen an den Hauptmann zu übergeben seien. Wer nach 6 Uhr in der Stadt angetroffen würde, würde vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Am 7. August erhalten wir zum erstenmal von der Militärbehörde etwas Verpflegung, rohes Fleisch, Trinkwasser und Soldatenbrot. Bis dahin hatte mein Onkel die Beköstigung aus seinen Vorräten liefern müssen. Die von den Franzosen gelieferten Nahrungsmittel reichten aber nicht aus. In den Zimmern, namentlich da, wo kleine Kinder schliefen, war in der Nacht wiederholt das elektrische Licht angedreht worden, was als Lichtsignale ausgelegt wurde. Abends um neun Uhr mußte in der Folge alles Licht gelöscht sein, sonst würde auf die betreffenden Fenster geschossen. Am nächsten Tag treffen drei höhere Offiziere ein und teilen mit, daß mein Onkel, weil er nachts Lichtsignale gegeben habe, auf Befehl des Generalresidenten verhaftet und in das Militärgefängnis abgeführt werden würde. Unsere Klarstellungen über den Sachverhalt wurden schroff zurückgewiesen und mein Onkel abgeführt. Allmählich trifft die deutsche Kolonie aus Fez und Rabat ein, die über die ihr widerfahrende Behandlung entsetzlich klagt. Endlich, am 12. August, [260] wird uns mitgeteilt, daß von uns 50 Herren mit dem auf der Reede liegenden Dampfer 'Mogador' eingeschifft werden sollten, während die übrigen, etwa 150, an Bord des französischen Viehtransportdampfers 'Turenne' gehen sollten, um nach einem neutralen Hafen befördert zu werden; dazu würde sich mein Onkel ebenfalls anschließen. Jeglicher Verkehr mit Außenstehenden auf dem Wege zum Hafen sei streng untersagt. Kurze Zeit darauf kommt mein Onkel zu uns. Gleich nach Mittag wird nochmals alles Gepäck untersucht, dabei wieder alles aus Kisten und Koffern herausgeworfen. Notdürftig zusammengepackt, wird es auf die unmittelbar vor dem Garten haltenden Eisenbahnwagen verladen. Bald darauf besteigen wir den Zug. Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett begleiten uns. Wir werden bei dicht verhangenen Fenstern und fest verschlossenen Türen zum Bahnhof gefahren. Dieser ist zum Teil durch Truppen abgesperrt, hinter denen eine große Volksmasse, meistens aus Eingeborenen bestehend, lautlos verharrt. Mit welchen Gefühlen wir Marokko, das Feld unserer langjährigen Tätigkeit, das vielen von uns eine zweite Heimat geworden war, verließen, wo uns Haus, Hof und aller Besitz brutal entrissen wurde, läßt sich nicht beschreiben. In Leichterfahrzeugen, die für den Gütertransport benutzt werden, wurden wir, ohne Rücksicht auf die Kranken, zusammengepfercht und an den Dampfer befördert. Hier war in keiner Weise für uns gesorgt. Lebensmittel wurden uns [261] nicht verabreicht, man stellte uns aber frei, uns auf unsere eigenen Kosten zu enormen Preisen zu verpflegen. In der einzigen kleinen Kajüte wurden die kleinsten Kinder und die Mütter untergebracht. Die größeren Kinder und die Erwachsenen mußten sich in den vor Schmutz starrenden Laderäumen, die Damen hinten, die Herren vorne, Platz suchen. Den Damen wurden einige schmutzige Strohsäcke hinuntergeworfen. Decken gab es überhaupt nicht. Am nächsten Morgen liegen wir noch auf derselben Ankerstelle. Erst gegen 12 Uhr setzte sich der Dampfer in Bewegung, Dampfer 'Mogador' mit den übrigen Gefangenen folgt, ferner ein Truppentransportdampfer und zwei französische Kreuzer. Gegen sechs Uhr desselben Tages treffen wir in Rabat ein und fahren nach kurzem Aufenthalt mit Kurs nach Norden weiter. Am 14. August passieren wir frühmorgens Tanger und beobachten mit banger Erwartung den Kurs, der uns nach einem neutralen Hafen führen sollte. Aber schon bald, indem wir Gibraltar passieren, wird uns klar, daß man uns wieder einmal schändlich betrogen hat, und daß man uns, allen Versprechungen zuwider, nach Oran oder Algier transportiert. Der Dampfer nimmt Kurs auf die afrikanische Küste. Früh am Morgen des 15. August treffen wir in Oran ein, ohne zu ahnen, welche Ereignisse uns noch am selben Tage bevorstehen. Nachdem unser Schiff am Kai festgemacht hat, müssen wir mit unserm Handgepäck an Deck antreten. Den glühenden Sonnenstrahlen ausgesetzt, ohne Nahrung, ja [262] selbst ohne Wasser, müssen wir bis drei Uhr daselbst ausharren. Zuerst wird unseren Herren befohlen, an Land zu gehen. Sie sollen zu Fuß durch die Stadt zum Bahnhof gehen, die Damen, Kinder und Kranken den Weg dahin mittels Wagen zurücklegen. Ich lasse hier den Bericht eines unserer Herren, namens Gustav Fock, ziemlich wörtlich folgen. (Nach dem Buche: Gustav Fock: Wir Marokkodeutsche in der Gewalt der Franzosen. Herausgegeben von Ludwig Brinkmann, Berlin 1916.) »Wir Männer ergriffen das Handgepäck und begaben uns zum Kai hinab, wo wir zu vieren, etwa sechzig Mann, aufgestellt wurden. Der Oberleutnant, der den Transport von Casablanca nach Oran begleitet hatte, zählte uns und gab uns dann an einen Sergeanten ab, der uns zum Bahnhof zu geleiten hatte. 16 Zuaven mit aufgepflanztem Bajonett gaben uns das Geleit; je vier wurden hinten, vorne und an die Seiten des Zuges verteilt. Der Sergeant, der auffälligerweise überhaupt nicht umgeschnallt hatte, keinen Dienstanzug trug und mit einem marokkanischen Ehrensäbel, als einziger Waffe herumfuchtelte, den er aus dem Handgepäck eines unserer Mitgefangenen, des Legationsrats Moraht, entwendet hatte, erhielt von dem erwähnten Oberleutnant den Befehl, uns nicht durch die Hauptstraßen der Stadt direkt zum Bahnhofe, wie es doch das Natürlichste gewesen wäre, und auf welchem Wege man nachher auch die Gefangenen der 'Mogada' geleitete, zu führen, sondern durch die elen- [263] den und verrufenen Vororte Orans. Mit satanischem Lächeln machte der Oberleutnant ihn dafür verantwortlich, daß wir 'richtig' ankämen. Dabei zwinkerte er dem Sergeanten zu, und dieser nickte verständnisvoll. Der Zug setzte sich in Bewegung. Zuerst liefen nur einige Kinder neugierig hinter uns her, dann schlossen sich auch Erwachsene an, und es wurden immer mehr, je weiter wir kamen; Neugierige, Nichtstuer, die in jeder Stadt der Welt einem so seltsamen Zuge gefolgt wären, um zu gaffen, die aber ganz friedfertig erschienen. Da fühlte sich unser Sergeant, der ganz zweifellos ein agent provocateur und gedungener Mörder war, berufen, die Leute einmal richtig in hetzerischer Weise über uns aufzuklären, und seine Belehrungen fielen auf keinen unfruchtbaren Boden. Besonders ein frecher Bursche von etwa zwanzig Jahren, der barhäuptig nebenher lief und dessen Maulwerk nicht einen Augenblick zum Stillstehen kam, bedachte uns mit ehrenden Zurufen, wie: 'Verfluchte Boches, Hunnen, Kinder- und Frauenmörder!' Und behauptete schreiend, wir wären alle gefangengenommen, weil wir deutsche Spione seien, weil wir versucht hätten, in Marokko Brunnen und Mehlvorräte zu vergiften, um die französischen Soldaten zu töten. Der Lümmel ist ebenfalls ein gedungener und gestellter Provokateur gewesen. Die nebenherlaufende Menge blieb noch ziemlich friedlich. Da brachte der Sergeant Schwung in die Sache. 'Wenn ihr Männer wäret', rief er den Leuten zu, 'und keine feigen Memmen, [264] so dürfte nicht einer von diesen deutschen Hunden lebendig zum Bahnhof kommen! Alle müssen totgeschlagen werden.' Und uns schrie er ins Gesicht: 'Ihr müßt nicht glauben, daß ihr lebendig zum Bahnhof kommt! Heute sollt ihr das französische Volk in seinem Hasse kennenlernen! Und wenn ihr jetzt davon kommt, morgen werdet ihr doch alle erschossen! Ich bin dazu kommandiert, ich bin derjenige, der morgen 'Feuer' kommandieren wird.' Da bestand für uns kein Zweifel mehr, daß unsere Aufseher mit unserer Ermordung beauftragt waren. Aber die Menge blieb immer noch ruhig. Da sahen wir von der Stadt her eine Droschke auf uns zukommen, in der mehrere Herren saßen. Kurz vor uns hielt der Wagen an und der Kutscher fragte den Sergeanten, was wir für Leute wären. Seine Antwort war: 'Gefangene Boches, die versucht haben, französische Soldaten zu vergiften und morgen erschossen werden!' Da nahm der Kutscher seine Peitsche und schlug sie weit ausholend dem nächsten Gefangenen über den Kopf. Dieser hielt zum Schutze seinen Arm hoch und versuchte dem Schlage auszuweichen. Ein Leidensgefährte, der rechts neben mir ging, ein Mechaniker aus Rabat, namens Kuppler, rief ihm zu: 'Mensch, seien Sie doch kein Feigling, warum weichen Sie aus! Zeigen Sie ihm, daß wir Deutsche sind, die keine Angst haben, aber auch gar keine! Sie dürfen nicht mit der Wimper zucken, und wenn Sie in Stücke gehauen werden!' Der schurkische Sergeant schrie jetzt: 'Habt ihr eben gehört, was der da von euch gesagt hat? Ich kann [265] deutsch und habe es verstanden! Ihr wäret alle Schweinehunde! Chiens de cochons hat er gesagt, und das laßt ihr euch bieten?' Der Kutscher, der vermutlich auch bestellte Arbeit leistete, hatte das Zeichen und Beispiel gegeben, der Sergeant ihn gedeckt; nun gab es für die Menge kein Halten mehr. Ich sah, wie plötzlich ein baumlanger Kerl an Kuppler heransprang, und, ehe ich es verhindern konnte, weit ausholend ihm mit der geballten Faust einen fürchterlichen Schlag zwischen die Augen versetzte. Taumelnd, die Arme weit ausstreckend, ließ Kuppler seine Handtasche fallen und brach zusammen. Ich griff ihm von rechts unter die Schulter; ein Leidensgefährte unterstützte ihn von der anderen Seite, und so schleppten wir ihn mit uns, damit er nicht auf der Straße liegenblieb. Jetzt faßten auch andere Mut, als sie sahen, daß wir uns nicht wehren konnten und für sie keine Gefahr dabei war, und von rechts und links setzte es Faustschläge und Fußtritte. Wir kamen an ein paar Haufen Steine vorbei, mit denen die Straße ausgebessert werden sollte. Mit lautem Jubel stürzte sich die Menge darüber her, und faustdicke Kiesel regneten von allen Seiten auf uns hernieder. Die Situation wurde kritisch; die Soldaten taten nichts, den Ausschreitungen des Pöbels Einhalt zu gebieten. Das Gebrüll um uns wurde immer stärker und unheimlicher; die Menge schwoll immer mehr an. Da tauchten, durch den Lärm angelockt, aus einer Seitengasse drei französische Sanitätssoldaten auf, die das Rote-Kreuz-Abzeichen auf dem [266] Ärmel trugen; ein paar Augenblicke gingen sie ruhig in der Reihe der Soldaten neben dem Zuge her und betrachteten uns, so daß wir schon zu hoffen anfingen, daß sie gekommen wären, um uns zu helfen. Da sprangen plötzlich, erst der eine, dann auch die beiden anderen in unsere Reihen hinein und entrissen den Gefangenen Spazierstöcke. Erbarmungslos schlugen sie damit auf uns ein, auf Kopf und Rücken und ins Gesicht, wohin es traf. Ihr Beispiel erweckte Nacheiferung. Wir verließen die steile Chaussee, und umjohlt von der brüllenden Menge, wälzte sich unser Häufchen von mißhandelten Gefangenen durch die Straßen und Gäßchen der verrufensten Stadtteile Orans. Hier war die Hölle los. Ein derartiger Lärm setzte ein, daß man sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Pfeifen, Johlen, Hohnrufe wie Espions! Assassiens! A la guillotine! Allemagne kaput! Mort à Guillaume le fou! Ein französischer Offizier, auch einer der Helden der Grande Nation, eilte herbei, reizte die Menge zu immer bestialischeren Greueltaten auf und schlug mit seiner Reitgerte immerfort auf die Gefangenen ein. Er stellte sich dann sogar persönlich an die Spitze des Zuges. An jeder Straßenecke ließ er halten, damit möglichst viel Pöbel herbeiströmen konnte und hielt an das Volk aufreizende Ansprachen, währenddem das Gesindel von allen Seiten mit Fäusten, Knüppeln und Flaschen auf uns eindrosch. Unsere Lage wurde immer ernster. Verschiedene [267] von uns waren schon von Schmerzen und Ermattung so von Kräften, daß sie sich nicht mehr auf den Füßen zu halten vermochten und von den Leidensgefährten, die selbst meist am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angelangt waren, weitergeschleppt werden mußten. Von den am Ende des Zuges Marschierenden waren schon drei Herren, Krake, Habermehl und Carl Ficke, liegengeblieben. Sie waren von der Menge rücklings niedergerissen worden, ohne daß wir es bemerkt hatten. Erbarmungslos trampelten die Nachdrängenden den am Boden Liegenden mit ihren schweren Stiefeln ins Gesicht, während die uns begleitenden Soldaten die Unglücklichen mit dem Kolben in die Rippen schlugen und mit dem Bajonett in die Seiten stachen, was freilich nicht das geeignetste Mittel war, ihre entschwindenden Lebensgeister wieder zu wecken. Habermehl wurde endlich von einem mitleidigen Spanier unauffällig in einen Hausflur gezogen und so vor der wütenden Menge gerettet, Ficke und Krake wurden zum Bahnhof hinaufgetragen; ersterem waren sämtliche Vorderzähne aus dem Munde getreten worden. Inzwischen hatte die Wut der Menge ihren Höhepunkt erreicht. Wir verloren immer mehr die Kraft; von der furchtbaren Glut, dem langen Weg, den steilen Berg hinan, dem Lärm, den schmerzenden Wunden und dem Staube versagten unsere Nerven. Kaum konnte einer noch aufrecht gehen; wir wankten und schleppten uns nur mühsam weiter mit dem Gefühl, wir werden einfach so lange in den Gassen herumgeführt, bis der Pöbel uns umgebracht hat. [268] Da ertönt plötzlich von vorne der Ruf: Aushalten, der Bahnhof ist da! Jeder rafft aufatmend seine letzten Kräfte zusammen, um auch diese kleine Strecke noch zu überwinden. Das Gesindel fürchtet jetzt, wir könnten ihm entrinnen. Alles verläßt uns plötzlich und eilt zum Bahnhof, wo die Treppen besetzt werden. Dort erwarten uns die Bestien in Menschengestalt und nochmals geht es über uns her. Taumelnd schleppten wir uns in die Bahnhofshalle, wo wir ermattet auf die Steinfliesen niedersanken. Draußen johlte noch immer die Menge, die die Eingänge zu stürmen suchte, aber von Soldaten, die endlich, vielleicht auf höhere Weisung, wahrscheinlicher aber aus eigener Initiative ihre Pflicht zu tun anfingen, und vom Bahnhofspersonal zurückgedrängt wurde. Wer weiß, ob es ihr nicht doch noch gelungen wäre, einzudringen, wenn nicht gerade noch zu rechter Zeit weitere Soldaten, ebenfalls Zuaven, angerückt wären, die uns ins Innere begleiten sollten. Die griffen endlich energisch ein, besetzten die Eingänge und schafften Ruhe. Erst jetzt, wo die größte Gefahr vorüber schien, trat bei den meisten ein gänzliches Versagen aller Kräfte ein. Die Nerven, die aufs äußerste angespannt waren, brachen auf einmal zusammen. Viele hatten die Augen geschlossen, lagen langgestreckt auf dem Boden und kümmerten sich um gar nichts mehr. Mochte kommen, was da wollte, viel schlimmer konnte es doch nicht werden. Andere blickten mit starren Augen vor sich hin, ich selbst gehörte zu den wenigen, die verhältnismäßig gut davongekommen [269] waren und erhob mich, um zu sehen, ob ich irgend jemand helfen könnte. Ein junger Mann aus Marrakesch lag stöhnend da und hielt sich jammernd den Kopf. Er hätte so gräßliche Schmerzen, es sei sicher etwas entzwei. Ich gab ihm Wasser zu trinken und legte ihm meine Handtasche unter den Kopf. Leider war dem armen Menschen nicht mehr zu helfen. Er fiel bald darauf in Ohnmacht und mußte in Oran zurückgelassen werden, wo er bereits am nächsten Tag an seinen Wunden gestorben ist. Drei andere Leidensgefährten fielen in Krämpfe und bekamen Tobsuchtsanfälle, schauerlich erklang ihr Geschrei in der weiten Halle. Der erstere wurde von mehreren mitleidigen Soldaten gehalten, die vergebens versuchten, ihn zu beruhigen und ihm Wasser einflößten. Mit Händen und Füßen wehrte er sich dagegen und schlug wie wild um sich. 'Ich will nichts von euch, ihr seid Mörder, ihr wollt mich vergiften!' schrie er. Auch die zwei anderen konnten nur mit äußerster Mühe durch kräftige Fäuste niedergehalten werden; immer gellender wurde ihr Geschrei. – Am Eingang des Bahnhofs legte man Ficke, Krake und Habermehl nieder, die, wie ich schon erzählte, von uns in den Straßen blutüberströmt zurückgelassen waren. Alle drei lagen bewußtlos da. Da ertönte plötzlich draußen wiederum lautes Geschrei und Gejohle; schon fürchteten wir, daß der Pöbel noch einmal versuchen würde, in die Halle einzudringen, und über uns herzufallen, als wir Frauenstimmen und Kindergeschrei am Ein- [270] gang des Bahnhofes vernahmen. Unsere Angehörigen waren angekommen. Aber zu uns durfte keine von ihnen. Sie wurden in einen Wartesaal geführt, wo sie uns nicht mehr sahen. Daß es ihnen unterwegs nicht ebenso ergangen war wie den Männern, hatten sie nur dem Umstande zu verdanken, daß sie nicht zu Fuß, sondern im Wagen den Weg zurücklegten. Auch sie wurden bald von einer schreienden Menge umringt und die gemeinsten Schimpfworte wurden ihnen zugerufen. In den Straßen schlugen einige ganz brutale Gesellen mit Peitschen und Knüppeln in die Wagen hinein. Die Frauen versuchten, die Fenster zu schließen; jedoch machten die Soldaten, als die Menge dagegen protestierte, die Fenster wieder auf und befahlen den Frauen, sie geöffnet zu lassen. Am gemeinsten führte sich auch diesmal die weibliche Bevölkerung auf; sie versuchten die Männer beiseite zu drängen und an die Wagen zu gelangen, um hineinzuschlagen und zu spucken. Einige riefen: 'Reißt ihnen die bébés weg, diese deutschen bébés, und zerreißt sie vor ihren Augen!' Ein Trupp Sanitätssoldaten kam an unter Führung eines Sergeanten und eines Unterarztes. Lachend und höhnend betrachtete letzterer, die Hände in den Taschen seiner weiten Hose, das armselige Häufchen der am Boden Liegenden und begrüßte es mit den Worten: 'Das habt ihr Boches verdient! Man hat euch zu gut behandelt! Viel schlimmer hätte es kommen müssen!' So brachten wir von Anfang an dieser Bestie in Menschengestalt wenig [271] Vertrauen entgegen. Während die Soldaten den Verwundeten ihre Wunden abwuschen und das Blut vom Gesicht entfernten, indem sie der Einfachheit halber jedem von uns so lange Eimer Wasser über den Kopf gossen, bis das Blut einigermaßen beseitigt war, nahm der Arzt selbst die drei in Krämpfen Liegenden in 'Behandlung'. Der eine beruhigte sich bald wieder und hörte zu schreien auf, der zweite schlug wie toll um sich und konnte nicht gehalten werden. Da ließ ihm der Arzt von vorne seinen Mantel als Zwangsjacke überziehen und ihn mit einem dicken Strick einschnüren. 'Den wollen wir schon ruhig bekommen', meinte er höhnisch und ließ dem armen Kranken, der wie ein Bündel wehrlos jetzt am Boden lag, Eimer um Eimer über den Kopf gießen. Als er trotzdem nicht zu schreien aufhörte, rief er ihm höhnisch zu: 'Du hast eine solch prächtige Stimme. Ich habe nie gedacht, daß ein Boche so schreien kann! Jetzt singst du sofort die 'Marseillaise', sonst lasse ich dich verprügeln!' Und richtig fing der Kranke in seinem Irresein an: 'Allons enfants, de la Patrie, le jour de gloire est arrivè!' War er mit dem Liede fertig, fing er sofort wieder von vorne an, ohne aufzuhören, ohne eine Pause zu machen, sang er mit lauter Stimme immer wieder die Strophe. Ein gräßlicher Anblick. Und der Arzt stand dabei und schüttete sich vor Lachen aus. Auch so ein Musterexemplar der 'Großen Nation'. Auch den armen dritten nahm er sich auf ähnliche Weise vor. Er ließ ihn mit Stricken fesseln [272] und mit Wasser überschütten. Als alles nichts half und er nicht zu schreien aufhörte, wurde der Arzt wütend, er ließ den Kranken zu Boden sinken, hielt ihm seinen Fuß übers Gesicht und rief: 'Wenn du jetzt nicht gleich stille bist, zertrete ich dir den Kopf mit meinem Stiefel.' Ruhig hatte der deutsche Arzt, Dr. Küppers, den Franzosen bisher gewähren lassen. Dies schien ihm aber zu viel zu sein; er stellte sich als Kollege vor und bat um die Erlaubnis, daß er versuchen dürfe, den Kranken zur Ruhe zu bringen. Der Franzose erlaubte es. Nach kurzer Zeit gelang es denn auch dem deutschen Arzt, die beiden Unglücklichen zu beruhigen und das Schreien hörte auf. Dann ertönte der Befehl: Aufstehen und wieder in Reih und Glied stellen! Wir nahmen das wenige Gepäck, das wir noch besaßen, zur Hand und begaben uns auf den Bahnsteig, wo unser Zug hielt. Wiederum rief man uns mit Namen auf und die Aufgerufenen mußten in einen Viehwagen einsteigen. Als niemand mehr hineinging, wurde abgeschlossen und ein zweiter Wagen gefüllt, dann noch ein dritter.« Soweit dieser Bericht. Die Damen und Kinder wurden in Personenwagen, unter Bedeckung, eingepfercht. Nach sechs Stunden kamen wir in Tlemcen an. Hier wurden wir in einer Kavalleriereitbahn untergebracht, wo wir auf dem Boden, bestehend aus Lohe, Erde und Pferdemist, schlafen mußten; als Nahrungsmittel erhielten wir vor- und nach- [273] mittags eine Wassersuppe, worin etwas Gemüse schwamm und etwas Soldatenbrot. Bei unserer Ankunft im Reitstall bot sich uns ein schrecklicher Anblick. Unsere Herren, welche etwa zwei Stunden vor uns dort angekommen waren, lagen blutüberströmt, mit zerfetzten Kleidern auf dem Boden umher, teils schlafend, teils teilnahmslos vor sich hinstarrend und völlig erschöpft. Und nun folgten herzzerreißende Szenen des Wiedersehens unter den verschiedenen Familienmitgliedern. Kaum waren wir in der Reitbahn, erschien ein höherer Offizier und teilte uns mit, daß bis auf weiteres die Türen geschlossen würden. Selbst, wenn Feuer ausbräche, würden sie nicht geöffnet. Trotz aller Aufregung und Strapazen fanden wir keinen Schlaf, die Kinder weinten, die Verwundeten stöhnten und wir Frauen waren der Verzweiflung nahe. Gegen vier Uhr morgens wurde der 'Turenne'-Transport alarmiert, um, auf Lastautos eingezwängt, nach Sebdou weiterbefördert zu werden; der 'Mogador'-Transport folgte nachmittags. Sebdou liegt 920 Meter über dem Meeresspiegel. Der Ort ist ein Dorf von 400 Einwohnern, Spanier, Araber und Hebräer, und nur zehn Franzosen als Behörden, sowie ein Fort mit geräumigen Kasernen, Ställen, Magazinen, ein Hospital, eine Apotheke und so weiter. Unmittelbar neben dem Dorfe befindet sich ein großer viereckiger Platz, eingeschlossen von einem Graben und einem Erdwall, der mit einem Gitter aus jungen Baumstämmen gekrönt ist. Inmitten befinden sich 15 ein- [274] stöckige Steinbaracken mit Steinfußböden und Pfannensatteldächern. Ohne Unterschied des Geschlechts wurden wir in diesen Baracken zusammengepfercht; Räume, die für 18 Mann Militär vorgesehen waren, wurden mit 32 von uns belegt. Aus Stoff haben wir uns dann schleunigst getrennte Abteilungen gemacht. Unterstellt waren wir einem Unterleutnant, zwei Sergeanten und etwa 60 Zuaven, letztere fast alle Hebräer. Die Küche besorgten in der ersten Zeit die Zuaven, die Speisen waren schmutzig und ungenießbar; in der Suppe schwammen Kaffeebohnen, im Kaffee Kohlblätter. An Nahrung wurde uns verabreicht: Morgens ganz früh sehr dünner, etwas angesüßter Kaffee, gegen elf Uhr eine Wassersuppe mit Gemüse, oder Linsen, Erbsen, Bohnen; um diese Hülsenfrüchte weich zu kochen, wurden große Stücke Soda hineingeworfen, was bei sehr vielen von uns Ausschlag hervorrief. Nachmittags gegen fünf Uhr dieselbe Suppe, dazu täglich ein halbes Soldatenbrot. Bei unserer Ankunft in Sebdou war mein Vater infolge seiner Krankheit, der Strapazen und der nichtswürdigen Behandlung bewußtlos. Der erbetene Arzt stellte sich erst am nächsten Tage ein; dieser ließ meinen Vater sofort in das Hospital tragen. Auf meine Bitten erhielt ich die Erlaubnis, täglich einige Stunden bei ihm verweilen zu dürfen. Sein Zustand war äußerst bedenklich; es war fast keine Hoffnung vorhanden, ihn am Leben zu er- [275] halten. Er ist noch weitere 13 Tage bewußtlos gewesen und wurde nach 40 Tagen, noch sehr schwach, aus dem Hospital entlassen. Die Behandlung seitens der Hospitalangestellten war äußerst nichtswürdig; in seinen Fieberphantasien hatte mein Vater das Bestreben, aufzustehen, dann wurde er mit Faustschlägen und Schimpfworten bedacht. Die Pflege war sehr minderwertig und es war nur gut, daß ich ihn etwas pflegen durfte; sonst wäre er sicher dem Tode verfallen gewesen. Nach acht Tagen wurde uns erlaubt, unser Gepäck, das bis dahin inmitten des Lagers auf einem freien Platz, von Militär bewacht, der heißen Sonne ausgesetzt war, in Empfang zu nehmen. Sehr viel war auf dem Transport durch die rohe Behandlung verlorengegangen oder auch gestohlen. Die Empfangnahme war aber nicht leicht; jedes Gepäckstück mußte in ein Zimmer des Leutnants gebracht und geöffnet werden. Dann wurde der Eigentümer hinausgeschickt. Der Leutnant durchsuchte selbst und ließ alles, was ihm gefiel, auch Geld und Wertsachen, unter einem großen Sofa verschwinden. Darauf wurde der Inhaber des Gepäcks wieder hereingerufen, ihm ein Schriftstück zum Unterzeichnen vorgelegt des Inhalts, daß er seine Sachen richtig erhalten habe. Er hat sich auf diese Weise so viel zusammengehamstert, daß er damit gut einen Laden hätte eröffnen können. Einige Monate später ist die Sache ruchbar geworden, und die französischen Behörden konnten nicht umhin, die Sachlage zu untersuchen, worauf der [276] Leutnant bestraft wurde. Damit haben wir unser Eigentum allerdings nicht zurückerhalten. Eine schreckliche Quälerei war das Zählen. In den ersten acht Tagen wurden wir fast jeden Morgen zusammengerufen, auf einem freien Platz. Hier mußten wir stundenlang in der größten Hitze stehen, einerlei, ob gesund oder krank, und dann fingen der Leutnant und die beiden Sergeanten an uns zu zählen. Aber jedesmal, wenn sie am Ende ankamen, stimmte die Rechnung nicht, immer waren einer oder zwei zu viel oder zu wenig. Alles Bitten der Kranken, wenigstens in den Schatten treten zu dürfen, wurde schroff abgewiesen, erst wenn sie ohnmächtig hinfielen, durften sie in die Baracken getragen werden. Eine nicht geringe Aufregung und Unruhe verursachte es jedesmal, wenn der Kommandant von Tlemcen seinen Besuch angesagt hatte, wozu er gewöhnlich den Sonntag wählte. Dieser, ein ganz ungebildeter brutaler Deutschenfresser, traf eines Sonntags wieder ein. Wie gewöhnlich, ließ er auch diesmal zum Appell zusammenblasen. Und er erklärte uns, daß wir alle genötigt seien, sämtliche Gelder bis auf 200 Francs für die Person abzuliefern und das sogleich. Wenn nach der Ablieferung und der darauf folgenden Untersuchung sich bei irgend jemand eine weitere Summe finden sollte, so würde der Betreffende füsiliert werden. Die Gelder würden in Tlemcen deponiert und erst dann wieder ausgeliefert, wenn wir Algerien verließen. Das ist dann auch geschehen. Aber wo wir [277] Gold, Silber und Noten der Bank von Frankreich abgeliefert haben, sind uns minderwertige algerische Banknoten zurückgegeben worden. – Während meine Leidensgefährten ihre Gelder abliefern mußten, befand ich mich im Hospital bei meinem Vater. So kam ich um die Ablieferung unserer Banknoten herum, die ich stets in einem Säckchen bei mir trug. Damit bei einer etwaigen Untersuchung kein Geld bei mir gefunden würde, kamen wir beide auf den Einfall, die Banknoten unter dem Futter meines Hutes zu verbergen. Wir unterstanden den Militärbehörden, die Herren wurden ganz, die Damen teilweise als Kriegsgefangene behandelt. Für die Herren wurde im Sommer um halb fünf, im Winter um sechs zum Aufstehen geblasen. Eine halbe Stunde nach dem Wecken wurde zum Appell geblasen. Hier wurden die verschiedenen Kolonnen zu den verschiedenen Arbeiten zusammengestellt: Reinigen und Fegen des großen Lagers, Fegen der Dorfstraßen, manchmal zusammen mit eingeborenen Sträflingen, Fällen von jungen Bäumen und Tragen bis zu sechs Stück zum Lager von den umliegenden Bergen, Fällen von abgestorbenen Bäumen, Roden der Wurzeln und Zerkleinern für Feuerholz, Bearbeiten des Offiziergartens und des Küchengartens. Strafen, und schwere Strafen, in den meisten Fällen ganz willkürlich, wurden für jede Kleinigkeit verhängt, so daß die Zellen fast nie leer wurden. Im Winter wurden diese natürlich nicht [278] geheizt, die Pritsche war aus Stein, dabei wurde nur eine dünne Decke erlaubt. Die unwürdige und unmenschliche Behandlung sowie der Mangel eines einigermaßen befähigten Arztes hatte verschiedene Todesfälle zur Folge. Eine etwa drei Monate verheiratete junge Frau mußte bereits während unseres Aufenthaltes in Tlemcen ins Hospital gebracht werden, wo sie nach wenigen Tagen starb. Ihr Mann mußte mit uns nach Sebdou weiterfahren; er wurde nach einigen Tagen nach Tlemcen zurückberufen, wo seine Frau im Fieberwahn im Hospital umherlief; sie erkannte ihn nicht mehr und verschied einige Stunden später. Das zweite Opfer war ein junger, hoffnungsvoller Mann. Er litt bereits seit längerer Zeit; da sein Fieber aber noch nicht 40 Grad erreicht hatte, so nahm ihn noch nicht einmal der Militärarzt in Behandlung. Erst nachdem das Fieber 40 Grad überschritten hatte, fand er Aufnahme im Hospital. Selbstverständlich erkannte der Arzt die Krankheit nicht, verschrieb indes große Dosen Chinin sowie Chinineinspritzungen, bekümmerte sich auch ebensowenig um ihn wie um seine übrigen Kranken. Er lebte nur noch wenige Wochen. Ein drittes Opfer war unser langjähriger Arzt in Casablanca, der indes keine Praxis mehr ausübte. Man hatte ihn auf eine lächerliche Anklage hin vor das Kriegsgericht in Casablanca geschleppt. Die barbarische Behandlung während dieser Zeit, der Aufenthalt in unterirdischen Kerkern, die Anstrengungen der Reise und alle ausgestandenen Leiden [279] haben den Einundsechzigjährigen bald nach seiner Freisprechung und Rückkehr nach Sebdou dahingerafft. Wir begruben ihn am Tage vor unserer Abreise. Außerdem starb das Kind eines Österreichers, das sehr leicht hätte am Leben erhalten werden können. Auch hier hatte der Arzt die Krankheit verkannt und gar nicht weiter beachtet. Unter uns befand sich ein zweiter Arzt aus Casablanca, der sich erst vor kurzem da ansässig gemacht hatte. Dieser durfte uns nicht behandeln; wo er es getan hatte und es bekannt wurde, wurde er mit 14 Tagen Arrest bestraft. Am 27. September, morgens in aller Frühe, wurden die Herren durch Blasen zum Appell gerufen. Nachdem alles versammelt war, erschien der Leutnant mit einer Abteilung Zuaven mit aufgepflanztem Bajonett. Er benannte dann elf mit Namen, die vor die Zuaven treten mußten. Nun erklärte der Leutnant, daß die elf nach Oran transportiert werden würden, um sich einem Verhör zu unterwerfen. Es wurde ihnen erlaubt, das Notwendigste zu packen und mitzunehmen, wozu ihnen etwa zehn Minuten unter Begleitung eines Soldaten Zeit gegeben wurde. Den Älteren und Schwächlichen wurde erlaubt, auf einem Karren Platz zu nehmen. Die anderen mußten den Weg bis Tlemcen in der Sonnenglut zu Fuß zurücklegen. Mit der Bahn sind sie von da weiter nach Oran befördert und haben einige Tage in unterirdischen Gefängniszellen schmachten müssen. Der Sergeant vom Lager, der die elf begleitet hatte, erzählte bei seiner Rückkehr [280] triumphierend, daß die Männer zu zweien und dreien gefesselt zusammen mit drei unserer Leidensgefährten, die bereits derzeit in Oran gehalten waren, an Bord eines französischen Dampfers gebracht wären, um in Casablanca vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Einige Zeit nach unserer Ankunft in Sebdou wurde uns erlaubt, unseren Angehörigen in der Heimat Mitteilung über unseren Verbleib zu machen. Selbstverständlich waren diese Mitteilungen einer strengen Zensur unterworfen, und zwar in Sebdou, Oran und Frankreich, und so mußten wir uns jedesmal auf wenige Schilderungen beschränken. Unsere ersten Briefe, die frankiert werden mußten, fanden wir nach einiger Zeit zerrissen, der Marken beraubt, im Wallgraben unseres Lagers liegen. Die ersten Nachrichten erreichten die Unseren gegen Ende September. Man kann sich denken, welche Angst und Sorge diese bis zum ersten Lebenszeichen von uns durchlebt haben. Im Verlauf unserer Gefangenschaft sind verschiedentlich unsere Briefe wochenlang zurückgehalten worden oder, wie Telegramme, unterschlagen worden. Auch Briefe aus der Heimat wurden zurückgehalten. So kamen am Tage vor unserer Abreise etwa 800 Briefe zur Verteilung. In der zweiten Hälfte des Oktobers traf ganz unerwartet die Erlaubnis zur Abreise ein. Gleichzeitig wurde uns gesagt, daß die Rückreise in Gruppen zu je fünf Personen anzutreten und aus [281] eigenen Mitteln zu bestreiten sei, die Reihenfolge habe der Leutnant zu bestimmen. Am 28. war die Reihe an uns; meine Tante, zwei Dienstmädchen, mein Vater und ich sollten am nächsten Morgen um fünf Uhr abreisen. Abends hatten wir unser Gepäck bereits aufgegeben und von unseren Leidensgenossen Abschied genommen. Dann spät aber lief vom Kommandanten in Tlemcen eine Depesche ein, des Inhalts, alle weiteren Abreisen zu verbieten. Dieser Schlag traf uns schwer, denn wir hatten unsere Abreise in der Heimat bereits angekündigt. Vor allem aber wurde es uns nun unmöglich, für unsere Angehörigen, die vor das Kriegsgericht gestellt werden sollten und in Casablanca im Kerker schmachteten, in der Heimat einzutreten, um sie vor dem Schlimmsten zu bewahren. Seitdem lastete auf uns ein Druck, und die Tage flossen langsam und in Betrübnis dahin, als uns gegen Mitte November die Schreckensnachricht von der am 5. November in Casablanca erfolgten Erschießung unseres Schicksalsgenossen, des Postbeamten Seyfert, erreichte, die uns wie ein Keulenschlag traf, harrten doch weitere dreizehn der Unglücklichen des Urteils durch das Kriegsgericht. Endlich, in den ersten Tagen des Dezembers, wurde bekanntgegeben, daß die in den Listen Angeführten sich zur Abreise bereitzuhalten hätten. Diejenigen, die im Besitz von Mitteln seien, hätten die Reisekosten selbst zu bestreiten, für die Mittellosen würden die Behörden eintreten. Einige Frauen [282] mit Kindern wollten ihre Männer nicht verlassen; sie blieben und haben es später bitter bereut. Am 8. Dezember, früh sieben Uhr, fing man mit dem Verladen des Gepäcks an, um neun Uhr wurden wir, fast siebzig Gefangene, wie die Heringe eingepökelt, abtransportiert. Abends fuhren wir in Tlemcen ein. Der Hafen war mit Truppen angefüllt, die betrunken lärmten und wüste Szenen aufführten. An Bord unseres Dampfers wurden 800 von ihnen untergebracht, die vorläufig auf Deck blieben. Ein Teil stellte sich an die offenen Salonfenster, verhöhnte und beschimpfte uns in der gemeinsten Weise. Seit früh hatten wir nichts genossen, bekamen aber erst auf wiederholtes Bitten eine Tasse Tee zu ein Francs das Stück. Essen sollten wir erst bekommen, sobald der Dampfer um sechs Uhr in See ginge. Man spekulierte dabei auf die Seekrankheit, und mit Erfolg, denn eben in die freie See gelangt, spürten wir die Wucht des Unwetters; der Dampfer rollte und stampfte gleichzeitig und arbeitete schwer in dem Sturm. Eine See schlug eine Eingangstür neben dem Salon ein und das Wasser schoß die Treppe hinab, die zu den Kabinen führte, so daß in diesen und in den Gängen über ein Fuß hoch Wasser stand. Wir hatten alle die Seekrankheit und konnten uns nicht erheben, ergaben uns in unser Schicksal. Unsere vielen Bitten um etwas Tee oder Suppe blieben unbeachtet. In dieser Verfassung blieben wir 48 Stunden, bis wir unter Land [283] kamen, die See sich etwas beruhigte und wir aufstehen konnten. Kurze Zeit darauf liefen wir in Marseille ein; dort wieder Aufstellen und Namen verlesen, dann wurden wir den Landbehörden übergeben. Diese führten uns an Land und in ein – wie der betreffende Beamte sich ausdrückte – 'anständig und gleichzeitig billiges Hotel' in der Nähe des Hafens. Wir fanden aber eine berüchtigte Spelunke vor, wo erst einmal eine ganze Anzahl zweifelhafter Kerle aus den Betten geholt werden mußten, und diese uns dann übergeben wurden, so wie sie waren. Einige von uns fanden keinen Platz, mein Vater darunter, meine Tante und ich. Wir fanden dann Unterkunft in einem Gasthof, der in der Nähe gelegen war und wenigstens reinlich und anständig war, auch keine allzu teuren Preise nahm. Wir sind dann über die Schweiz, wo wir gut aufgenommen und bewirtet wurden, nach Deutschland gefahren. An der Grenze hatten sich Kinder mit der deutschen Fahne aufgestellt, die Häuser waren beflaggt und alles winkte uns Willkommensgrüße zu. Dann lief unser Zug in Singen ein. O himmlische Freiheit, nach vier Monaten, nach all den ausgestandenen Drangsalen! Damit endete unsere Leidensgeschichte, ein Wort aber noch über unsere Angehörigen in Casablanca. Trotz aller Anstrengungen und Bemühungen war es nicht möglich, meinen Onkel zu retten; am 11. Januar wurde er vom Kriegsgericht mit seinem Geschäftsteilhaber, Herrn Gründler, zum Tode verurteilt, an- [284] geblich wegen Aufreizung der Eingeborenen gegen die französischen Behörden, obwohl keinerlei Beweise dafür vorlagen und die beiden Verteidiger daher Freisprechung beantragten. Am 28. Januar fand die Vollstreckung unter dem Aufgebot aller Truppen von Casablanca statt. Man hatte ein großes Schaugepräge von der Erschießung dieser beiden Unschuldigen gemacht. Als ein ganzer Deutscher, fest, ohne mit der Wimper zu zucken, ist mein Onkel in den Tod gegangen. In dem stolzen Gedanken an unsere deutschen Helden, die sich für das Vaterland opfern, ist er gestorben. 'Tausend Unschuldige sterben in diesem Augenblick; ich werde ein Opfer mehr sein!' So waren seine letzten Worte."
 Über die Läger Tlemcen und Sebdou brachte das Meurersche Gutachten Einzelheiten, die ein noch schwärzeres Bild ergeben. "Die Gefangenen wurden wie das gemeinste Volk behandelt. Die Räume in Sebdou waren schmutzig und voller Wanzen. Für 350 Gefangene wurden täglich nur 1¾ Hammel als Fleisch verwandt. Der Sergeant Charnot war unverschämt; er beschimpfte die Frauen mit den unflätigsten Ausdrücken und redete selbst die Konsuln mit "Du" an, machte sich ein Vergnügen daraus, gerade diese zu den schmutzigsten Arbeiten heranzuziehen. Visitierende Offiziere brachten vielfach ihre Damen mit. – Das Lazarett war schmutzig und verwahrlost. Es kamen mehrere Geburten vor, bei denen keine weibliche Hilfe zugelassen wurde. Der Kommandant zog Soldaten mit zur Hilfe heran. Dem [285] deutschen Arzt Dr. Küppers wurde die Behandlung der Kranken bei Strafe verboten; er erhielt Gefängnis, als er einmal nur einen Rat erteilt hatte und mußte die Aborte reinigen."  In dem Bericht von Fräulein Ficke wurde unter anderem auch der österreichische Konsul Brandt erwähnt, der auf Grund einer erfundenen Anklage (ein Kabyle, der in seiner Firma angestellt war, sollte ihn der Spionage verdächtigt haben) in Oran zum Tode verurteilt wurde. Das Urteil wurde nicht sofort vollstreckt, weil ein Gnadengesuch an den Präsidenten der Republik auf Veranlassung des amerikanischen Konsuls die Strafe zu mildern suchte. Sie wurde dann in eine zehnjährige Zuchthausstrafe umgewandelt. Brandt kam nach Berrouaghia, obwohl man ihm versprochen hatte, ihn wegen seines schlechten Gesundheitszustandes in ein Militärlazarett zu schaffen. Er selbst gab nach seiner Rückkehr nach Deutschland vor der Militäruntersuchungsstelle des Berliner Kriegsministeriums über seine Erlebnisse einen beeidigten Bericht, aus dem wir den Teil, der Berrouaghia betrifft, hier wiedergeben. "Endlich gelangte ich am 17. März nach Berrouaghia, wo ich meine zehnjährige Zuchthausstrafe verbüßen sollte. Es gilt dieses als das schrecklichste Gefängnis in Nordafrika, das Klima ist im Sommer glühend und im Winter sehr kalt; Schnee und Eis gab es bis Ende April, dabei ungeheizte Baracken, einfach mit Pfannen bedeckt und in einem Raume lagen 70 Gefangene. Wasser war schlecht und die hygienischen Verhältnisse ganz unglaublich. Es gab [286] in der Ecke einen offenen Abort, der natürlich fürchterlichen Geruch verbreitete, was bei dem Fehlen jeden Luftzuges ziemlich unerträglich war. Baden war nie, zum Waschen kaum Gelegenheit gegeben, da in jedem Barackenraum nur ein Faß mit Wasser stand, das zwar täglich gefüllt wurde, aber zum Trinken und Waschen für 70 Menschen absolut unzureichend war. Man denke sich, wenn 70 Gefangene mit ihren Bechern das Wasser herausschöpfen, in welchem Zustande das wenige Wasser und wie schnell es verbraucht war. Hier, wo Europäer mit Eingeborenen (Arabern und Negern) zusammengebracht waren, darunter das gräßlichste Gesindel, Räuber, Mörder, wörtlich genommen, spottete das Ungeziefer jeder Beschreibung. Ich lag mit Tuberkulosen- und Syphiliskranken nebeneinander. Unter diesem Auswurf der Gesellschaft, Franzosen und Arabern, herrschten alle Laster, die ohne alle Scham betrieben wurden. Als ich am Mittag des 17. März ankam, wurden wir mit Stockschlägen empfangen und im Hof zusammengetrieben, unsere Zivilkleider uns entrissen, und wir einen Moment unter die Dusche getrieben, dann wurde mir der Strafanzug, Hemd und Stiefel zugeworfen, und mit Stockschlägen wurden wir wieder zum schnellen Anziehen gezwungen, was mir bei der Gebrauchsunfähigkeit meines linken Armes besonders schwierig wurde. Hier möchte ich noch bemerken, daß ich das Hemd oftmals drei Wochen lang tragen mußte, beim Wechseln war das neue Hemd meist noch feucht und voll Ungeziefer. [287] Jetzt wurde mir mein Strohsack und meine Decke zugewiesen im Raum und ich erhielt meine Nummer. Am folgenden Tage fand die ärztliche Untersuchung zwecks Arbeitsbestimmung statt. Die Arbeitseinteilung ist nach Klassen 1, 2 und 3, je nach Gesundheitszustand. Die Zuteilung wurde auf Grund der Untersuchung des Arztes vorgenommen und ich wurde infolge meines steifen Armes und des übrigen schlechten Gesundheitszustandes zu Abteilung Nr. 4 erklärt, welche von der Arbeit befreit sein soll. Die Verpflegung bestand um halb elf in heißem Wasser mit Brotstückchen darin und 600 Gramm Brot pro Tag. Am Donnerstag und Sonntag war ein Stückchen Fleisch in der Suppe. Am Abend um etwa fünf Uhr eine Gamelle mit zweimal wöchentlich Pferdebohnen, dreimal Kichererbsen und zweimal Reis, stets steinhart, oft wurmig und ungenießbar. Ich habe selten etwas hinunterwürgen können, besonders wirkten die Bohnen entsetzlich und verursachten die größten Verdauungsstörungen. Diese Penitentiaire Agricole ist ein landwirtschaftliches Unternehmen, das vom Staat an einen Unternehmer, namens Gay, verpachtet ist: derselbe sucht durch Ausnutzung der Gefangenen, durch minderwertiges Essen und ungenügende Bekleidung möglichst großen Gewinn zu erzielen; unterstützt wird er durch die gewissenlosen Wärter, größtenteils Korsen, welche durch eine Geldgratifikation von seiten des Richters die Gefangenen durch Prügel, Mißhandlungen zu unmenschlichen Leistungen antreiben, [288] und ist diese Wirtschaft eine schlimmere, als sie zur Zeit der trübsten Sklavenwirtschaft geherrscht hat. Nachdem ich bei der ärztlichen Untersuchung zur Nichtarbeit bestimmt war, wurde ich doch sofort zum Matten- und Körbeflechten bestimmt, obgleich mir diese Arbeit mit meinem linken Arm unmöglich war. Diese Arbeit mußten wir in einem unterkellerten Raum sitzend auf Steinboden verrichten. Täglich elf bis zwölf Stunden bei der Kälte im Raum stillsitzend, da erfroren einem die Glieder, und Rheumatismus und Durchfälle waren die Folge. In den Sommermonaten wurde ich dann zum Ausbreiten des Mistes gebraucht, zum Ährensammeln, wo man mich mit besonderer Freude von einem Ende zum andern jagte und hier eine Ähre, da eine Ähre schleunigst aufsammeln ließ; bei dem Sonnenbrand eine schwere Qual für mein Alter (60 Jahre). Ebenso wurde ich zum Steineklopfen geholt. Auf meine Beschwerde beim Arzt erklärte er manchmal, ich könne leichtere Arbeiten tun, dies war immer im Beisein des Chefs der Fall; ein andermal sagte er, Kategorie 4 brauche nicht zu arbeiten, was mir aber wenig half. Bald nach meiner Einlieferung kam Mr. Hasseltine mit zwei anderen Herren der amerikanischen Botschaft aus Paris, um mich zu sehen. Er versprach mir, daß ich mein Unterzeug erhalten sollte, ebenso die Erlaubnis zur Benutzung der Kantine, was mir noch nicht erlaubt war, das heißt, sechs Sous pro Tag. Beides wurde mir dann ungefähr einen Monat später zusammen mit den anderen mit mir eingelie- [289] ferten Gefangenen erlaubt. So hatte dieser Besuch, wie auch ein späterer von Mr. Mason, amerikanischer Konsul von Algier, dem größte Rücksichtsnahme auf meinen Gesundheitszustand versprochen war, wenig Erfolg. So blieb meine Behandlung abwechselnd, je nach Laune des Chefs, arbeitend, gehetzt, beschimpft, geschlagen, und dann wieder einmal kurze Zeit in Ruhe gelassen, das heißt, man ließ mich auf der Straße elf bis zwölf Stunden sitzen, ohne daß ich aufstehen durfte. Diese ganze Behandlung brachte mich körperlich und seelisch so herunter, daß ich im Dezember 1915 mit meinen Kräften zu Ende war, und wenn ich nicht fortgekommen wäre, ich sicher nicht weitergelebt hätte. Um einen Beweis über Mißhandlungen anzuführen, so wurde ich bei einer Verpflegungsverteilung von einem Wärter, Le Fleury, mit Faustschlägen ins Gesicht und Fußtritten in den Leib traktiert, so daß sowohl Franzosen wie Araber empört waren. Alle meine Versuche, durch Vermittlung des ersten Wärters, also instanzenmäßig, beim Direktor mich zu beschweren, mißlangen. In zynischer Weise fragte mich ein anderer Wärter, aus welchem Tor ich wieder hinaus wollte, doch wohl nur aus dem, wo der Kirchhof wäre. Schmähungen, Drohungen, Beleidigungen gab es täglich, immer wurde mir von den Wärtern vorgeworfen, ich hätte in Sardinenbüchsen Patronen für die Eingeborenen eingeführt und in Casablanca das Mehl vergiftet. Im Mai/Juni 1915 kamen 60 kriegsgefangene deutsche Soldaten, die in Marokko gewesen waren [290] und, wohl zum großen Teile schuldlos, wegen Diebstahls bis zu zehn Jahren verurteilt waren. Von Anfang an wurden diese armen Kerls zu den schwersten Arbeiten gezwungen, den Wein zu behacken u. dgl. Natürlich immer von den Wärtern getrieben, ohne Grund an den Händen gefesselt und geprügelt. Bei der schweren Arbeit und völlig unzureichenden Ernährung wurden viele sehr krank und krank weiter zur Arbeit getrieben. Ich sah selbst mit an, wie ein Sachse mit 41 Grad Fieber mit Fußtritten zur Arbeit getrieben wurde, obgleich ihm der Arzt Ruhe verordnet hatte. Während der Arbeit brach er natürlich zusammen und starb am folgenden Tage. Vielen anderen erging es ähnlich, wohin die Schläge trafen, war den Wärtern ganz egal. Noch schlimmer war es, wenn einer in die Zelle kam, dort wurden sie in vielen Fällen systematisch zu Tode geprügelt. Viele der französischen Soldaten hatten als Schreiber oder Vorsteher eine gewisse Macht und nutzten diese aus, um sich die deutschen Soldaten in perversester Art zu Willen zu machen. Da sich die Deutschen natürlich weigerten und sich nicht dazu hergeben wollten, wurden sie verprügelt. Alle Beschwerden blieben erfolglos. Ich sah selbst, wie ein deutscher Soldat, dessen Schußwunde am Arm noch offen war und der heute noch wegen dieser Wunde im Hospital liegt, zu schweren Arbeiten getrieben wurde. Es wird mir immer eine schreckliche Erinnerung sein, wie ein Gefangener beerdigt wurde, wo ich zum Tragen der Leiche dabei sein mußte. [291] Wie ein Hund wurde der arme Kerl eingescharrt, und nur mit Mühe gelang es mir, ein stilles Gebet am Grabe zu sprechen. Die ärztliche Behandlung war völlig unzureichend, auch nicht genügend Medikamente vorhanden. Es sind infolge der Mißhandlung, der schweren Arbeit im afrikanischen Klima, der schlechten Ernährung und geringen Fürsorge innerhalb acht Monaten von 60 Kriegsgefangenen 22 gestorben, ohne daß irgendeine Epidemie herrschte. Und es würden wohl kaum irgendwelche übrig geblieben sein, wenn sie länger dort hätten bleiben müssen. Im Juli schlug für sie die Erlösungsstunde, und sie wurden zunächst nach Avignon und dann nach Ile d'Oleron gebracht, wo ich sie im September 1916 wieder vorfand. Ende des Jahres 1915 war ich vollständig körperlich und geistig gebrochen, und da kam die Mitteilung, daß ich am selben Tage, am 31. Dezember, nach Maison Carré transportiert werden würde. Hier wurde ich in die Abteilung der Correctionels aufgenommen, Strafen bis zu einem Jahre. Gegen die Mördergrube Berrouaghia war Maison Carrée für mich eine Verbesserung, und besonders nach dem liebenswürdigen Besuch des spanischen Generalkonsuls in Algier war ich im Hospital untergebracht und blieb daselbst bis zu meinem Fortgang, 12. August 1916. Hier war ich in ärztlicher Behandlung, Arzt ein Araber, der alles tat, um mein Los zu verbessern. Am 12. August wurde ich zusammen mit Herrn Nehrkorn, der sich die ganze Zeit in der Abteilung der Traveaux forcés in Maison [292] Carrée befunden hatte, nach dem Gefängnis Barberausse in Algier-Stadt gebracht. Dort trafen wir mit Herrn Kästner, Hermann und Suns zusammen. Am 31. August wurden wir an Bord eines Dampfers gebracht und nach Marseille befördert, noch immer gekettet. Bei dieser Fahrt hatten wir fürchterliches Wärterpersonal. Wir wurden in einem kleinen Loch unter Deck untergebracht, ohne Licht und Luft, Wasser bekamen wir nur durch Vermittlung französischer Gefangener, da die Wärter erklärten, für die Boches kein Wasser zu haben." Am 15. November 1916 wurde Brandt in Freiheit gesetzt und sah seine deutsche Heimat wieder.
 Aus den amtlichen deutschen Akten über Berrouaghia: "Die zu längerer Strafe kriegsgerichtlich verurteilten Leute aus Marokko und Algier wurden nach Berrouaghia geschafft, das, tief im Süden Algeriens liegend, am Rande der Wüste ein bekanntes algerisches Fieberloch ist. 60 Prozent der Zivilinternierten hatten Malaria. Die ärmeren Zivilgefangenen sind in Berrouaghia buchstäblich durch die Unterernährung in einen solchen Zustand allgemeiner Entkräftung geraten, daß die herausgekommenen Leute schwerkrank in Deutschland angekommen sind und in einzelnen Fällen noch später, in Jahren besserer Ernährung, an Entkräftung gestorben sind. Eine auffallende Zahl von Todesfällen ist unter den Gefangenen in der Zeit vom August 1915 bis Mai 1916 zu verzeichnen. Während des Jahres 1915 [293] war Singen verboten, Sprechen nur mit halblauter Stimme gestattet. Der amerikanische Konsul in Algier hatte unter dem 31. Juli 1915 einen ernsten Bericht über das Zivilgefangenenlager Berrouaghia gesandt." Sowohl in der deutschen amtlichen Denkschrift als auch in der vom Deutschen Tageblatt im Jahre 1920 herausgegebenen "Gegenliste französischer Kriegsverbrecher" sind die Beamten des Lagers Berrouaghia als Schuldige an der bestialischen Behandlung und dem Tode vieler Deutscher bezeichnet und angeklagt. Von einer Bestrafung hat man nichts gehört, also billigte die französische Regierung ihre schändlichen Taten. Ein hervorragender Engländer sagte nach dem Kriege treffend: "Wir haben während des Krieges gelernt, die Leiden anderer geduldig zu ertragen."
 Und nun das Glanzstück französischer "Ritterlichkeit" in Westafrika: Die Behandlung unserer Kamerun- und Togodeutschen. Ich folge bei diesem erschütternden Tatsachenbericht der Darstellung im Gutachten Meurer. Während Deutschland die in Duala tätigen Engländer nach Kriegsausbruch in ihren Wohnungen beließ, ja sie sogar noch ihren Geschäften weiter nachgehen ließ, wurden die Deutschen nach der Einnahme von Kamerun von der Straße weg verhaftet, wobei auch Missionare nicht ausgenommen wurden, und in einer haarsträubenden Unterkunft auf den Dampfern fortgeschafft. Meist wurde ihnen noch nicht einmal Zeit gelassen, die notwendigsten [294] Habseligkeiten einzupacken. Die englischen und französischen Offiziere haben die Mißhandlungen durch schwarze Soldaten nicht bloß geduldet, sondern sich auch an ihnen beteiligt. Während aber England dann die Kolonialdeutschen in England internierte, hat sich Frankreich deutsche Kriegs- und Zivilgefangene noch von England ausliefern lassen, um sie – etwa 400 an der Zahl – in sein ungesundestes Gebiet von Westafrika, nach Dahomey, zu verschleppen. Die französischen Beschönigungen können keinen Eindruck machen. In Dahomey wurden die Kolonialdeutschen an Plätzen, die wegen Malaria, Dysenterie und Gelbfieber verrufen sind, bei ungenügender Unterkunft, schlechter Verpflegung, dürftiger Bekleidung, in schwerem Frondienst, unter Aufsicht von brutalen Schwarzen den Einwirkungen des Tropenklimas schonungslos ausgesetzt. Es wurden an ihnen unmenschliche Mißhandlungen in Form von Prügeln, Gefängnis und Folterstrafen verübt. Die Berichte der deutschen dritten Denkschrift geben entsetzliche Kunde von den gequälten Opfern. Einzelfälle von Mißhandlungen Seite 29 bis 31 so wie 121 bis 126. Die Belege in den 33 Anlagen, Seite 35 bis 177 sind die entsetzlichste Anklage, die vielleicht jemals erhoben worden ist. Es ist nicht möglich, auch nur annähernd ein Bild von dem widerlichen Sadismus zu geben, man muß die Anlagen selbst lesen.
 I. Dahomey. Drei Wochen nach der Übergabe von Kamina in Togo an die unter englischem Ober- [295] befehl stehenden englisch-französischen Truppen am 18. September 1914, haben die Engländer etwa 180 deutsche Männer aus Togo den Franzosen auf den vor Lome liegenden Dampfer "Obuasi" zur Verschleppung nach Dahomey ausgeliefert. Mit 13 deutschen Frauen, die ihren Männern in die Gefangenschaft folgten, und als Kriegsgefangene behandelt wurden – nach anfänglicher Trennung wurde das Zusammenbleiben erlaubt – wurden die gefangenen Männer in Cotonou unter dem Höhnen und Drohen der Bevölkerung ausgeschifft und unter Wellblechschuppen untergebracht, die ohne Lüftung waren und nur einen während der Nacht verschlossenen Ausgang hatten. Die Gefangenen mußten ihre Notdurft in Petroleumtonnen verrichten, in deren nächster Nähe sie ihr Lager auf hartem Steinboden hatten, der nur ungenügend mit Strohmatten bedeckt war. Die Luft war verpestet und bei der Tropenhitze so unerträglich, daß alsbald Schwächeanfälle eintraten. Das unsauber und schlecht zubereitete und ungenügende Essen mußte die Mehrzahl mit den Händen zu Munde führen; auch dem Gouverneur, der trotz Bitten drei Tage lang nicht einmal ein Glas Wasser bekam, wurde kein Besteck gegeben. Die Aufsicht war roh und erniedrigend. Auch Offiziere und Unteroffiziere der Kaiserlichen Schutztruppe, die nach dem Fall Garuas als Kriegsgefangene in Cotonou untergebracht waren, erfuhren dieselbe Behandlung. Der große Teil der Togodeutschen mußte noch [296] weiter nach Norden, nach dem 520 Kilometer von Savé – bis hierher Bahnfahrt – entfernten Gaya am Nil im französischen Sudan marschieren. Auf erhobene Vorstellungen antwortete der Generalgouverneur von Dakar: "Der Marsch nach dem Innern ist unter allen Umständen durchzuführen, koste es, was es wolle!" Am 22. und 23. September wurde von Savé in zwei Abteilungen abmarschiert. Täglich mußten Strecken von 20 bis 35 Kilometer, in einer Hitze von 30 bis 50 Grad, in der Sonne 80 Grad, zurückgelegt werden. Trotzdem die Märsche nachts um zwei Uhr begannen, war die Tageshitze nicht zu vermeiden, da die Sonne schon um acht Uhr morgens stark brannte und die Kranken sich nur langsam vorwärtsschleppen konnten. Nicht für solche Märsche ausgerüstet, mußten die Gefangenen, deren dünn besohlte Stiefel bald zerrissen waren, auf dem glühenden Boden barfuß gehen. Haussandalen aus hartem ungegerbtem Leder, zu denen man als Ersatz griff, scheuerten die Füße wund. Mit nüchternem Magen mußte der Marsch angetreten werden und bis in den Mittag hinein ohne ausreichendes Wasser fortgesetzt werden. Aus schmutzigen Pfützen wurde, ohne Rücksicht auf die Gefahren, getrunken; das bereitgehaltene Wasser war schmutzig und übelriechend. Das von Negern zusammengekochte Essen, das meist nur halb gar und mit Ungeziefer durchsetzt war, genügte in keiner Weise. Oft waren die Gefangenen so müde, daß sie sich, ohne zu essen, in den schmutzigen Neger- [297] hütten, die des Moskitoschutzes entbehrten, einfach auf die Erde warfen, unbekümmert, ob die Hütten mit Wasser voll liefen. Die Gefangenen verloren bis zu sechzig Pfund an Körpergewicht. Die Zahl der an Malariafieber und Dysenterie Erkrankten oder durch Erschöpfung und Fußwunden Marschunfähigen wuchs bis auf 50 täglich. An einzelnen Tagen mußten auch die Kranken marschieren. Marschunfähige wurden durch Kolbenstöße weitergetrieben. Als selbst ein französischer Truppenführer Gewissensbisse bekam und erklärte, die Verantwortung für den unmenschlichen Transport nicht weiter tragen zu wollen – man war erst in Parakou – wurde er abgelöst. Nachdem so 380 Kilometer in 20 Tagen einschließlich sechs Rasttagen zurückgelegt waren, und die Erschöpfung der Gefangenen den Weitermarsch absolut nicht mehr zuließ, wurde in Kandi ein 14tägiges Halt gemacht. Infolge neuer Erkrankungen an Malaria und Dysenterie erhoben die Deutschen abermals Protest gegen den Weitermarsch, aber der neue Transportführer, Kapitän Bosch, erklärte, die Gefangenen ständen außerhalb des Völkerrechts. Am 26. Oktober wurde der Weitermarsch nach Gaya beschlossen. Der deutsche Arzt, der die Gefangenen begleitete, gibt an: "Wenn man bedenkt, daß der Europäer den Gefahren des Tropenklimas nur unter Anwendung besonderer Schutzmaßnahmen zu begegnen vermag, so bedeutet dieser Marsch der an Kleidung und Schuhzeug auf das mangelhafteste ausgerüste- [298] ten Gefangenen einen Gewaltmarsch, der auf Leben und Tod ging." Gaya, 800 Kilometer von der Küste entfernt, ein Dorf mit 500 Einwohnern, ist durch seine Malaria- und Dysenteriegefahr berüchtigt. Die 20 Strohhütten der Gefangenen, die auf enger Fläche errichtet waren, schützten weder vor der Glut der Trocken- noch vor der Regenzeit und den Gewittern. In der Trockenzeit herrschte im Innern eine Temperatur von 40 bis 60 Grad, die auch nachts kaum abnahm. Die Hütten hatten weder Bett noch Tisch, weder Stuhl noch Waschschüssel. Es war nichts als der nackte Boden vorhanden, auf den sich die Gefangenen mit ihrer Strohmatte legen mußten. Da sie für ihre zerfetzte Kleidung und Wäsche in Gaya keinen Ersatz fanden, liefen sie zum Teil nackt herum und barfuß. Die Offiziere wurden, obwohl sie nach der LKO. Art. 6 von Arbeiten befreit sind, wie die Mannschaften gehalten; sie mußten selbst kochen und waschen, auch Hütte und Geschirr in Ordnung halten. Die Verpflegung war mangelhaft, einförmig und ungenügend; Zutaten zu kaufen war verboten, obschon Nahrungsmittel reichlich und billig zu haben waren. Gesuche um Verbesserung wurden vom Verwalter mit der Begründung abgelehnt, die französische Regierung habe befohlen, die Gefangenen "ohne Milde" zu behandeln. Später erst wurde es etwas besser. Die Zahl der Kranken war sehr hoch; sie betrug täglich 35 bis 50. Im ganzen erkrankten an Dysenterie 70 Prozent der Gefangenen, [299] an Malaria war jeder von ihnen ein oder mehrere Male krank; auch kamen acht Fälle von Schwarzwasserfieber vor. Ferner waren Magen- und Darmerkrankungen außerordentlich häufig. Es mangelte an entsprechenden Arzeneien, vor allem an Dysenteriebekämpfungsmitteln und Chinin. Instrumente fehlten monatelang fast vollständig, so daß Abszesse mit dem Taschenmesser geöffnet werden mußten. An dem ungesunden Platz war eine Gesundung nicht zu erwarten. Ähnliche Zustände herrschten in Kandi. Die Krankenziffer war in Kandi sehr hoch. Sie betrug in der Zeit vom 17. Oktober 1914 bis zum 10. Mai 1915 an
Im Laufe der Monate März bis Mai 1915 wurden die Gefangenenlager Kandi und Gaya allmählich aufgelöst, und die Mehrzahl der Gefangenen wurde nach dem Süden in das Lager Abomey überführt, in dem auch Togodeutsche aus dem Krankenhause Cotonou sowie die Kamerundeutschen, nachdem sich Duala am 29. September 1914 hatte ergeben müssen, untergebracht worden waren, so daß die Gefangenenzahl schließlich auf 300 stieg. Abomey liegt südlich von Savé in einem regenreichen, heißen und ungesunden Flachland, das stark von Malaria, Dysenterie, sowie in der Regen- [300] zeit fast alljährlich von Gelbfieber heimgesucht wird. Als Gefangenenlager diente das Hauptgehöft des ehemaligen Dahomey-Häuptlings Behanzin, das sich in einem völlig verwahrlosten Zustande befand. Das Gehöft und die nächste Umgebung waren von hohem schilfartigem Gras überwuchert, die Hütten bis auf ruinenhafte Mauerreste verfallen. Abomey war die Hölle. Die Gefangenen waren wieder in Lehmhütten untergebracht, deren Halbdunkel den Aufenthalt von Moskitos und sonstigem Ungeziefer begünstigte. Moskitonetze gab es aber erst gegen Ende der Gefangenschaft. Die Unglücklichen lagen auf der bloßen Erde, jeder hatte nur einen Platz von etwa 60 Zentimeter Breite zur Verfügung. Den offenen Abort mußten sie vor den Augen schwarzer Weiber mit den schwarzen Soldaten und anderen Eingeborenen teilen. (Grundriß Seite 14 der Denkschrift 3.) Lagerkommandant war der Major Beraud, unterstützt von dem Adjutanten Venère (einem früheren Zuchthausaufseher in der Verbrecherkolonie Neukaledonien), dem Sergeanten Castelli, dem Gefreiten Dianzelli und eingeborenen Soldaten. Lagerarzt war der französische Stabsarzt Dr. Longharé. Alle Kriegs- und Zivilgefangene hatten – ohne jegliche Bezahlung – schwere Arbeiten zu leisten. Sie mußten im Lager die meterdicken, steinharten Lehmmauern mit schweren Hacken umlegen, außerhalb des Lagers Wege bauen, Flächen ebnen, Ackerland und Plantagen roden, das Land von Dornen- [301] gestrüpp und Schilfgras reinigen. Die Gefangenen waren weder gegen die Sonnenstrahlen noch gegen die häufigen Gewitterregen geschützt. Neue Sachen wurden nicht geliefert, obschon die nötigen Vorräte vorhanden waren. Viele mußten die zum Schlafen ausgehändigten Decken als Hüfttuch tragen. Einige liefen barfuß. Die massenhaften Sandflöhe fanden so unter den Fußnägeln einen willkommenen Schlupfwinkel; schmerzhafte Schwellungen und Eiterungen waren die Folge. Die Nahrung war ungenügend, unsauber und geschmacklos. Das Trinkwasser war schmutzig, mit Insekten und Larven vermischt und mußte unfiltriert getrunken werden. Im Dezember 1914, als Venère eintraf, begann eine regelrechte Hungerkur, die bis in den April 1915 anhielt. Die Gefangenen suchten in den Abfallkörben nach Eßwaren. Beim Felderroden war das Aufrichten des Körpers oder das Niedergehen in die Kniebeuge verboten, desgleichen das vorübergehende Ausruhen und Abtrocknen des Schweißes. Die Mittagspausen und Sonntage wurden damit ausgefüllt, daß die Gefangenen schwere Lasten von der einen Kilometer entfernten Feldbahn abholen mußten. Mit Gewehr und Holzkeule bewaffnete schwarze Soldaten sowie Weiße, die mit Flußpferdpeitschen ausgerüstet waren, führten eine unbarmherzige Aufsicht. Kolbenstöße, Fausthiebe, Fußtritte, Keulenhiebe, Drohungen und Schimpfworte trieben unausgesetzt zur Arbeit an. Wer in der Sonnenglut infolge Überanstrengung zusammenbrach, wurde unter Beschimpfungen und [302] Schlägen zur Weiterarbeit gezwungen. Die Grausamkeiten des weißen Aufsichtspersonals, vor allem des Adjutanten Venère, übertrafen selbst die Roheit der Schwarzen. Zu keiner Stunde, selbst nicht zur Nachtzeit, waren die Gefangenen vor Arrest, Faustschlägen, Peitschenhieben, Fußtritten und Bedrohungen der Weißen sicher. Das Arrestlokal war stets überfüllt und die Arreststrafe dadurch verschärft, daß die Bestraften auf schmale Kost gesetzt waren und die Ausleerungen von Dysenterieerkrankten mit bloßen Händen aus dem Eimer genommen werden mußten. Venère schlug die Gefangenen aus Laune und in der Trunkenheit mit seinem Ochsenziemer, versetzte ihnen Faustschläge und trat auf ihnen herum, wenn sie am Boden lagen. Mit Peitschenhieben trieb er sie oft ins Arrestlokal oder auch in sein Arbeitszimmer, um sie dort weiter zu verprügeln. Fingerdicke Striemen waren oft noch lange zu sehen. Selbst Kranke und Genesende wurden mit der Peitsche zur Arbeit getrieben. Eine Spezialität in Abomey war die Daumenschraube, die tagtäglich zur Anwendung kam. Es wurden die beiden Daumen in die Öffnung dieses Folterinstruments gesteckt, dann wurde durch Anziehen der Schraube ein Stück Eisen auf die Daumen gedrückt. Diese Marterung dauerte stundenlang, ja ganze Nächte. Oft platzten die Daumen und die Gemarterten brachen bewußtlos zusammen. Die Wehrlosen in der Daumenschraube pflegte Venère durch Peitschenhiebe und Faustschläge noch [303] weiter zu quälen. Eine Verschärfung dieser Marter bestand darin, daß zwei Gefangene, denen Daumenschrauben angelegt waren, sich gegenüberstellen mußten und durch eine an den beiden Daumenschrauben befestigte Kette miteinander verbunden wurden. In dieser Stellung mußten sie stundenlang einen etwa zwei Kilo schweren, in der Mitte der Kette hängenden Holzklotz mit ausgestreckten Armen über den Boden in der Schwebe halten. Ließen die Gefangenen die Arme sinken, so wurden sie so lange geschlagen, bis sie die Arme wieder erhoben. Die Vorgesetzten schritten nicht ein, beteiligten sich vielmehr an den Mißhandlungen und wiesen dazu an. Dr. Longharé war mit im Bunde; er sah den Mißhandlungen ruhig zu und schickte ernstlich Kranke zur Arbeit. Als ihm eines Tages ein bei der Arbeit zusammengebrochener Gefangener im besinnungslosen Zustand gebracht wurde, setzte er seine Unterhaltung beim Wein ruhig fort mit dem Bemerken: "Auf dem Felde liegen Verwundete und Kranke recht lange ohne jede ärztliche Hilfe." Er bevorzugte die Hungerkur und das Glüheisen und überließ die Krankenbehandlung schwarzen Heilgehilfen. Das Vorbringen von Beschwerden war verboten und für strafbar erklärt. Deshalb, und weil Venère Verbesserungen in Aussicht stellte, unterließen es die Gefangenen, bei dem erstmalig im Januar 1915 erschienenen Kontrolloffizier Vorstellungen zu erheben. Eine spätere Beschwerdeschrift wurde durch [304] Venère konfisziert; die Ende Februar und März 1915 erhobenen Beschwerden hatten Arrest, Arbeitserschwerung und Kostentziehung zur Folge. Hinter hohen Lehmmauern waren die armen Gefangenen ihren Peinigern schutzlos ausgeliefert. Der gefangene Oberstabsarzt Prof. Dr. Zupitza, der Mitte März 1915 zur Unterstützung des französischen Arztes nach Abomey kam, schilderte Lager und Gefangene dort folgenderweise: "Das Ganze machte einen unheimlichen Eindruck; man hatte das Gefühl, von aller Welt auf Nimmerwiedersehen abgeschnitten zu sein. Nun gar der erbarmungswürdige Anblick unserer Landsleute. Lebensmüde, abgezehrte, hagere Gestalten, wachsbleiche Gesichter mit tief in den breit umränderten Höhlen liegenden matten Augen, krummgebeugt, mit schlotternden Gliedern, schritten sie verschüchtert über den Hof einher! Andere standen, mit verstohlener Neugier nach dem Ankömmling spähend, im Hintergrund ihrer Hütteneingänge, um sich beim Annähern eines Franzosen scheu wie verschlagene Hunde in das Innere zurückzuziehen. Das waren die arbeitsfähigen Gesunden. Welches Elend sollte sich mir noch offenbaren, als ich am Morgen nach meiner Ankunft zum ärztlichen Dienst das Lazarett betrat." Regimentsarzt Dr. Simon, der Ende Mai 1915 an Stelle des Prof. Zupitza von Kandi nach Abomey kam, berichtete über die Verhältnisse in Abomey wie folgt: "Das Schlimmste war der entsetzliche Gesund- [305] heitszustand der Gefangenen. Obwohl ich als Tropenarzt an schwere Krankheitsfälle gewöhnt bin, erschrak ich beim Anschauen der Jammergestalten, die dort zu sehen waren. Schlecht ernährt, mit bleichen, hohlen Gesichtern, wie Gespenster, niedergedrückt und scheu wie geprügelte Hunde gingen die Leute ihrer Arbeit nach. Fieber und Krankheiten wüteten in ihren Reihen. Das Schauerlichste war das sogenannte 'Neue Lager', ein zweites Lager, wohin die chronisch Kranken und nicht mehr Arbeitsfähigen verbracht waren. Alles jammervolle, heruntergekommene Gestalten! Einen solch trostlosen Anblick habe ich als Arzt selten gesehen!" (Es folgen statistische Angaben.) Auf die Übersendung des deutschen Anklagematerials durch Vermittlung der Schweiz an die französische Regierung antwortete die letztere in einer längeren Verteidigungsnote. Aber die deutsche Denkschrift zog aus dem Verhalten Frankreichs den Schluß, daß das Deutschtum an der Westküste Afrikas ausgelöscht und die deutschen Pioniere selbst getötet werden sollten. Da den Franzosen der Mut fehlte, die Deutschen auf einmal hinzumorden, suchten sie den gleichen Erfolg durch langsames Foltern und Hinsiechenlassen zu erreichen. Die französische Regierung hatte den Mut, im März 1915 gegenüber den dringenden Vorstellungen der deutschen Regierung zu behaupten: "Le traitement réservé aux prisonniers allemands dans les colonies franâaises est entièrement [306] conforme aux sentiments d'humanité que le Gouvernement de la Réublique tient à honneur, en toutes circonstances d'observer srupuleusement." Auf Deutsch: "Die Behandlung, die den deutscher Gefangenen in den französischen Kolonien zuteil wird, steht im vollen Einverständnis mit den Gefühlen der Menschlichkeit, denen unter allen Umständen gewissenhaft zu genügen, sich die Französische Regierung zur Ehrenpflicht macht." Ferner hat der stellvertretende Gouverneur von Dahomey Einrichtung und Betrieb des Lagers Abomey besichtigt und ausdrücklich gutgeheißen. Erst Anfang Juli 1915 – unter dem Druck der Zwangsmaßnahmen der deutschen Regierung – wurde das Lager von Abomey aufgelöst und die Gefangenen von ganz Dahomey wurden zunächst nach Cotonou geschafft, wo dann aber die demütigende Behandlung weiter fortdauerte. Alle Gefangenen Abomeys litten an allgemeiner Körperschwäche, hochgradiger Blutarmut und schweren nervösen Störungen. Fast ein Drittel waren so krank, daß sie die neun Kilometer lange Strecke nach der Station Bohikou nicht zu marschieren vermochten.
 Nordafrika Die Leiden der Kolonialdeutschen hatten noch nicht ihr Ende erreicht; die Marterstation wurde nur verlegt, und zwar nach Nordafrika. (Vergl. die Denkschrift Die Kolonialdeutschen aus Kamerun und Togo in französischer Gefangenschaft vom [307] Reichskolonialamt 1917.) Alle Kolonialdeutschen in Dahomey, auch die Frauen, wurden mit Ausnahme von hundert, die wegen Platzmangels zurückbleiben mußten, am 5. Juli 1915 auf dem Frachtdampfer "Asie" nach Nordafrika eingeschifft. Das Ziel der Fahrt waren die Lager Medea (Algerien) und Mediouna (Marokko). Hier litten die aus den Tropen gekommenen Gefangenen in ihren dünnen Kleidern nun stark unter Kälte. In Medea wurden der stellvertretende Gouverneur von Togo, die Offiziere mit ihren Frauen und die Ärzte gefangen gesetzt. Die Frauen wurden in Oran als Verbrecherinnen behandelt. Die Offiziere aus Kamerun erhielten als Unterkunftsraum zuerst eine Futterkiste zugewiesen, später, weil der Regen in dicken Strömen durch das Dach einströmte, einen Pferdestall, in dem das Pferd des Lagerkommandanten und die Araberwache hausten. Stühle, Schränke und Wascheinrichtungen fehlten; die Gefangenen mußten sich auch im Schneegestöber im Hofe waschen. Die Verpflegung war ungenügend und schlecht; die Krankenfürsorge war mangelhaft; Arzneimittel, insbesondere Chinin, wurden verweigert. In Mediouna wurden die übrigen Kolonialdeutschen untergebracht, die Behandlung und Verpflegung war die gleich schlechte. Da, wie in Abomey, auch in Mediouna Fieberkranke zur Schwerarbeit gezwungen und ins Gefängnis geworfen wurden, nahm die Malaria vielfach die schwere Form des Schwarzwassers an. Nachdem schon in Dahomey [308] vierzehn Deutsche an Schwarzwasserfieber gestorben waren, gingen hier sieben weitere an der gleichen Krankheit zugrunde. Die allgemeine Behandlung war rücksichtslos und hart. Kriegs- wie Zivilgefangene mußten Steinbrucharbeiten verrichten und schwere Erdarbeiten ausführen, auch Aborte entleeren. Harte Strafen waren an der Tagesordnung. Eine dieser Strafen bestand darin, daß der Gefangene unter eine niedere Zeltbahn kriechen und dort, ungenügend geschützt gegen Wind und Wetter, bis zu dreißig Tagen liegen mußte. Und diese Strafe wurde noch verschärft durch die Verbringung in das weiter im Innern südöstlich von Medea gelegene Straflager El Boroudj, das als Straflager für Kriegsgefangene eingerichtet war, die sich gegen die üble Behandlung in Frankreich gewehrt hatten. Unter dem Druck von Repressalien der deutschen Regierung wurden um die Mitte 1916 die Lager in Nordafrika geräumt und die Gefangenen nach Frankreich überführt. Aber auch die Überfahrt bedeutete eine neue Leidensstation; die etwa 380 Dahomey-Gefangenen lagen wieder im unerträglich heißen Laderaum des Schiffes auf dem schmutzigen Boden, ohne sich ausstrecken zu können. Am Tage durften sie zwar das Deck betreten, aber dort standen sie zusammengepfercht, ohne Schutz gegen die Sonne. Die Verpflegung war schlecht und die Behandlung durch die schwarze Bewachung brutal.
 Aus den amtlichen Feststellungen von Mißhandlungen in Abomey, aufgenommen vom Deutschen Reichskolonialamt. [309] "Der Gefangene L... aus Duala wurde von Venère derart ins Gesicht geschlagen, daß er eine schwere Verletzung des Nasenbeins erlitt und sein Gesicht dauernd entstellt ist. Dem Gefangenen S. wurden von Venère zwei Zähne ausgeschlagen. Ein anderer mit gleichem Namen wurde durch Schläge auf den Kopf so schwer verletzt, daß er bewußtlos in die Krankenstube getragen werden mußte und lange Zeit unter Kopfschmerzen und Schwerhörigkeit auf dem linken Ohr litt. Am 17. Dezember 1914 wurde der Gefangene L. auf Grund einer unwahren Meldung des Dolmetschers durch Venère, Castelli und mehrere Eingeborenensoldaten in Gegenwart des Kommandanten Beraud mittels Faust-, Stock- und Peitschenhieben über Gesicht, Kopf und Rücken, mittels Niederwerfen auf den Boden und Fußtritten in den Unterleib mißhandelt. Ferner wurden ihm Daumenschrauben so fest angelegt, daß die Haut platzte. Während der Mißhandlung wurde er von Venère auch noch mit Erschießen bedroht. Der katholische Missionsbruder Alphons aus Kamerun, dem die Ausbesserung der Motorräder der französischen Beamten übertragen war, erhielt acht Tage Gefängnis, weil der Motor am Fahrrad des Lagerarztes sich entzündete. Beim Abführen ins Gefängnis wurde Alphons durchsucht, dabei fand Sergeant Vergnaud ein Stück Brot und ein Gebetbuch. Vergnaud warf das Brot fort, zerriß das Gebetbuch in kleine Fetzen und zerstreute sie. Am 1. Juli 1915 wurde ein Gefangener durch [310] Venère mit der Peitsche über Kopf, Hände und Arme geschlagen und über Nacht in die Daumenschrauben gespannt, weil er versehentlich eine Lampe zerbrochen hatte. Dem Gefangenen L. wurde zunächst die Daumenschraube angelegt, dann peitschte Venère ihn mit dem Ochsenziemer und hielt ihm den Revolver an die Stirn. Beim Gefangenen P. wurden die Daumenschrauben so fest angezogen, daß er ohnmächtig wurde und in Herzkrämpfe fiel. Als er sich am Boden wand, versetzte ihm Venère außerdem noch Fußtritte. Am 5. Februar 1915 wurden zwei Gefangene aus Kamerun auf der Wache mit je 15 Peitschenhieben gezüchtigt. Nachdem ihnen sodann in der Wohnung des Venère Daumenschrauben angelegt waren, mißhandelte er sie durch Schläge ins Gesicht und durch Fußtritte. Zur Wache zurückgeführt, mußten die Gemarterten in die Kniebeuge gehen, worauf Venère dem einen mit dem Rufe: 'Revanche pour Duala!' ein Bajonett auf die Brust setzte. Alsdann wurden beide Gefangene durch eine an die Daumenschrauben befestigte Kette miteinander verbunden und in der Mitte der Kette ein zwei Kilo schwerer Holzklotz befestigt. Die Gefangenen mußten diese mit gestreckten Armen so straff halten, daß der Klotz nicht den Boden berührte. Sobald sie die Arme sinken ließen, wurden sie durch die sie beobachtenden schwarzen Soldaten mißhandelt. Diese Quälerei dauerte etwa zwei Stunden. Eines Tages ließ Venère einen an Milzbrand verendeten Ochsen [311] zerlegen, das Fleisch durch Gefangene in die Küche bringen und dort für sie verteilen. Obwohl die französischen Soldaten und Beamten nichts von dem Fleische essen wollten, verlangte Venère das von den Gefangenen. Sie taten es aber nicht auf den Rat des deutschen Arztes. Sechs der Leute, die damit zu tun gehabt hatten, erkrankten – einer davon lebensgefährlich – an Milzbrand. Als der deutsche Arzt den Venère bitten ließ, die Platte, auf der das Fleisch des Tieres zerschnitten war, zu verbrennen, wurde er von Venère mit Peitschenhieben bedroht und ihm geantwortet, er solle sich nicht in Sachen mischen, die ihn nichts angingen. Im November 1914 erkrankte der Gefangene L. an Malaria, Schwarzwasserfieber und Dysenterie. Es geschah fast nichts zu seiner Pflege, auch der französische Arzt kümmerte sich nicht um ihn. Als er so eines Tages mit 40 Grad Fieber daniederlag, kam Venère in seine Hütte und verlangte, daß er aufstehen und zur Arbeit gehen solle. Der Gefangene versuchte zu gehorchen, fiel aber sofort kraftlos zurück. Darauf riß ihn Venère von der Matte und schlug ihn unter Beschimpfungen mit dem Ochsenziemer. Schließlich gab er ihm noch Fußtritte und ging weg."
 Die französische Regierung wußte, warum sie diesen "energischen Unteroffizier", wie man solche Leute etwas schamhaft im französischen Kriegsministerium zu nennen pflegt, als Büttel über die deutschen Kolonialer setzte. Sie wußte sehr gut, [312] warum sie die Deutschen nach dem verrufenen Dahomey verschleppen ließ, ja noch weit ins Innere des Landes hinein, damit nur möglichst wenig wieder herauskämen. Nicht die Beraud, Venère und Longharé waren die Schuldigen, sondern die Pariser Regierenden allein, die angesichts solcher Unmenschlichkeiten noch heuchlerische Worte aufbrachten. Noch ein paar Worte über die "Gegenmaßnahmen" der deutschen Regierung. In der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 10. Juni 1915 stand zu lesen: "Schon im November vorigen Jahres hat die deutsche Regierung die Forderung gestellt, daß die deutschen Kriegs- und Zivilgefangenen aus Afrika in klimatisch einwandfreie Orte geschickt werden sollten. Diese Forderung ist durch die Amerikanische und auch durch die Spanische Botschaft verschiedentlich wiederholt worden.... Unsere Heeresleitung hat sich nun gezwungen gesehen, da alle Verhandlungen bisher erfolglos blieben, zu Taten, das heißt zu energischen Gegenmaßnahmen zu schreiten. Das mörderische Klima von Dahomey steht uns nicht zur Verfügung, auch auf dem Wege der Erniedrigung der weißen Rasse durch die Aufsicht von Schwarzen vermag Deutschland dem Kulturstaat Frankreich nicht zu folgen. Aber man wird kriegsgefangene Franzosen in ungefähr gleicher Zahl wie unsere Kriegs- und Zivilgefangenen in Afrika aus den schönen Gefangenenlagern zu [313] Arbeiten in die Moorkulturen überführen. Wir wollen dadurch erreichen, was der Appell an die Menschlichkeit Frankreichs und langmütige Verhandungen nicht erreicht haben."
Es sind dann einige hundert Franzosen, mit warmen Decken, gutem Schuhzeug und warmer Kleidung wohlausgerüstet, nach der Lüneburger Heide und nach Mitau geschickt worden. Hoffentlich haben sie sich in diesen gesunden Gegenden recht wohl befunden. |