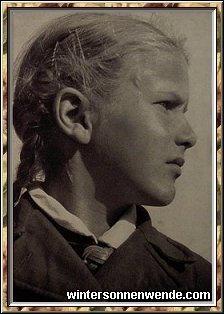|
 Wir hatten strengstes
Verbot Von Inge Klamroth Im April sprach der Führer zuerst bei uns, in Lyck. Der Tag lag in der Schulzeit; wir hatten strengstes Verbot, hinzufahren. Die Jungens wollten aber trotzdem hin, und ich auch. Es wurde beschlossen, sie sollten bis zur nächsten Station laufen und dort in den Zug einsteigen, ich wollte gleich von L. aus fahren. Eine Kameradin brachte mich zur Bahn. Im letzten Augenblick entdeckten wir eine Lehrerin, die etwas verborgen hinter einer Tür steht und offensichtlich "aufpaßt". Was nun, umkehren? Fünf Minuten vor dem Sonderzug geht der fahrplanmäßige Zug. Kurz entschlossen löse ich die Karte dafür. Und als die Dame mich anhält und mit saurem Lächeln nach dem "Wohin" fragte, zeige ich die Fahrkarte nach "L.", das auf der Strecke nach Lyck liegt und wo meine Eltern wohnen. "Aach - -." "Ja, ich besuche meine Eltern!" "Heute noch, bloß zum Abend?" "Ach doch, ich konnte nicht früher fort!" Da läßt sie mich ziehen. Als wir in Lyck ankommen, ist es dunkel. Menschen [41] strömen durch die Straßen, Musiktakte klingen auf - wir gehen einem fernen Brausen entgegen. Viele tausend Menschen warten auf den Führer. Sie stehen dichtgedrängt, wir mitten dazwischen, sind bald in den brausenden Menschenmauern eingepreßt. Urplötzliche Stille. Und dann Heilrufe gewaltig und nicht enden wollend. Wir sehen den Führer nicht. Aber jetzt ist seine Stimme bei uns, warm und tief - wir hören ihn zum ersten Male. Und seine Rede ergreift uns, packt uns, schafft jubelnde, gläubige Freude. Wir zwingen es, - wir erkämpfen den Sieg! Und dieser Stimme, die seither so oft zu uns kam, die immer wieder zu uns sprach, gelobten wir Treue, gelobten wir Gefolgschaft und Gehorsam. Ich weiß heute kein Wort jener Rede mehr, so sehr wurde ich durchrüttelt und gepackt, daß nichts haftenblieb. Als eines, wenn durch den Rundfunk die Reden des Führers übertragen werden, ist dieses für Augenblicke wieder da: Lodernde Fackeln gegen einen dunklen Himmel, tiefrote Fahnen, dichtgedrängte Menschen - und aus dem Dunkel spricht die Stimme des Führers - Glauben, Treue, Sieg. Im Juli sollte er das zweitemal kommen. Diesmal nach Lötzen. [42] Wir hatten Schulferien und machten uns mit Feuereifer an die Vorbereitungen. Täglich, morgens vier Uhr, kutschierten wir zum Wald, um Tannen zu holen. Und dann saßen wir und flochten Girlanden - tagelang. Achthundert Meter mußten gewickelt werden, Arme und Hände waren bald zerstochen und wund, uns störte es nicht. Wir hüteten ängstlich unsere Sommerblumen, alle sollte der Führer haben! Fünfzehn Mädel waren wir damals, und keine wollte zurückstehen. So viel gab es zu laufen, zu holen. Und wenn gerade nichts zu tun war, dann sangen wir, damit den andern die Zeit nicht lang wurde. Unser großer Weidegarten sollte der Versammlungsplatz werden. Als unser Gauleiter zur Besichtigung kam, war niemand bei uns zu Hause. So konnte ich ihn und die SA.-Führer führen. Überall standen noch die Stacheldrahtzäune, durch die wir durchklettern mußten, alles wurde genau besehen, dann war es endgültig entschieden, hier sollte der Führer sprechen. Bald waren die Zäune verschwunden. Bänke wurden aufgeschlagen, die Tribüne gezimmert, Fahnenmasten aufgestellt. Immer näher kam der 16. Juli. Die Nächte vorher konnten wir kaum schlafen vor freudiger Erwartung. Und nie haben wir mit solcher Bangigkeit nach dem Wetter geforscht - "wenn es nur schön bleibt!" Es blieb schön. In strahlender Sonne lag an jenem Morgen der [43] weite grüne Platz, auf dem bald die ersten Menschen standen. Unsere Jungmädel kamen mit riesengroßen Blumensträußen und erwartungsfrohen Augen mit als die Ersten. Sie durften an der Tribünentreppe stehen und den Führer begrüßen. Immer größer wurde der Menschenstrom, der die sandige, fahnengeschmückte Straße entlang kam. Da waren Arbeiter, die aus den Betrieben kamen, Bauern, die Sense und Hof verlassen hatten, Kinder, Frauen und viele junge Menschen. Aber in der Hauptsache waren es Bauern. Sie standen dann auch bald dichtgedrängt auf dem Platze. Sie waren von weither gekommen, um den zu hören, der sie führen sollte. Masurische Art ist schwer und treu. Als der große Krieg über unser Land kam, als die Russen über unsere Grenzen brachen, als die Nächte rot waren vom Schein der brennenden Dörfer und die Tage im Kampflärm dröhnten, haben sie ohne viele Worte gehandelt. Es galt ihr Teuerstes, die Heimat. Bei Tannenberg standen sie, namenlos, eingereiht in das große graue Heer und schlugen den Feind, daß er das Wiederkommen vergaß. Als der Krieg, der ihnen natürlich Notwendigkeit gewesen, vorbei war, griffen sie wieder zu Pflug und Sense, bauten ihre verbrannten Häuser wieder auf und pflügten die zerstampften Äcker. [44] Nun bedrohte sie ein neuer Feind. Schlimmer war er als der Russe, denn er war nicht zu greifen, nicht zu schlagen. Er nahm ihnen das Vieh, die Ernte, den Hof. Da ballten sie die Fäuste und sahen sich um - war keiner da, der sie hier zum Kampf führte? Und fanden Hitler. Nun warteten sie hier auf ihn, er sollte ihnen sagen, was sie zu tun hätten. Und dann kam Hitler. Weit hinten begann ein Summen, Brausen, Rufen, - war schon bei uns - Und dann stand er dort oben, unter den großen leuchtenden Fahnen, und sah über den weiten Platz voller Menschen. Sah weiter zu den Kornfeldern, die reif und gelb in der Sonne lagen, umfaßte See und Wald mit seinem Blick. Und uns war, als wollte diese Erde, die wir ganz stark spürten, als der Führer sie sah, als wollte diese Heimat selbst zu uns sprechen. Und wurden ganz still. Verarbeitete Hände falteten sich, und über gramdurchfurchte, zersorgte Gesichter liefen die Tränen. Der Führer war bei uns! Und dann jubelten wir ihm zu - lange noch, als seine Rede längst vorbei war. Wir wußten, er fuhr nun über unsere vielen wunder- [45] schönen Seen, sprach in wenigen Stunden wieder. Und auch wir gingen wieder an die Arbeit zurück. Die Ernte begann.
Und jeder Sensenstrich wurde ein Schwertschlag gegen die Not ringsum.
 [46] Der
Hof Von Inge Klamroth Und dies ist die Welt, die Liese kennt: Hof und Garten, weite Felder, Wald und See. Was sonst noch ist - die Stadt, in der sie zur Schule geht, die hastenden Menschen dort - gehört ihr nicht zum richtigen Leben. Sie hat sich das noch nie überlegt, aber sie weiß es. Und wenn irgendwo das Wort "Heimat" ausgesprochen wird, sieht Liese den See, über den die kleinen Wellen tanzen, sieht den Sternenhimmel über den dunklen Baumspitzen, spürt den guten Geruch der Erde, wenn Vater pflügt. In der Schule steht sie abseits. Die andern, die Stadtmädel, kommen nicht zurecht mit [ihr], weil sie anders ist als ihre Klassenkameradinnen. Liese hat immer ein bißchen rissige Hände und riecht nach Land und Pferden. Man kann mit ihr nicht über all die kleinen Nichtigkeiten sprechen, die die Mädel aus der Stadt beschäftigen. Lieses helle Augen blicken dann so seltsam verständnislos, und nach einer Weile sagt sie irgend etwas, womit sie nichts anfangen können. Etwa: "In diesem Jahr wird es viel Kartoffeln geben - ." Oder: "Du müßtest Suse kennen, - Suse [47] ist das klügste Pferd, klüger als viele Menschen." Und seit die Mädel wissen, daß Liese die Nachmittage lang auf dem Feld arbeitet, daß sie Schweine füttert und das Federvieh besorgt, seit sie dies wissen, sprechen sie kaum noch mit ihr. Liese hat sich daran gewöhnt. Es gleitet von ihr ab, denn sie weiß, daß ihre Welt eine andere ist. Es ist ein hartes Leben, das die Bauern führen. Arm und karg ist der Boden. Alle Hände müssen mithelfen, und Liese weiß das. Sie fühlt keine Schwere dabei und keine Unlust. Es ist ja ihre Heimat und ihr Hof, wofür sie schafft. Ein Gedanke steht über ihrem Leben: Wenn ich groß bin - wenn ich Mutter alles abnehmen kann! Aber dieses eine spürt Liese: Daß sich eine große dunkle Wolke vor das Leben schiebt. Viel Lachen und Reden kannte man nie auf dem Hof, dazu ist die Art der Bauern zu schwer und zu ernst. Aber jetzt hört es ganz auf. Liese sieht, wie die Mutter immer blasser und müder wird, und strengt ihre kleinen Kräfte an, ihr zu helfen. Der Vater ist oft in der Stadt, und wenn er zurückkommt, hat er böse Augen und eine laute Stimme. Dann war er auf dem Finanzamt, dann ging es um dieses Schreckliche, das Liese nicht versteht - um Geld und um Steuern. Und einmal hört Liese, wie der [48] Vater aufstöhnt: "Sie werden nicht ruhen, bis sie uns vom Hof gejagt haben!" Da faßt sie eine große Angst: Vom Hof jagen, - das geht doch nicht, - es ist doch ihr Hof? Sie nimmt sich vor, Heiner danach zu fragen. Heiner - der ist auch anders geworden. Sonst hatte der große Bruder immer Zeit für sie, jetzt ist er abends kaum noch da. Liese bringt ihm das Vesperbrot aufs Feld und grübelt vor sich hin. Warum wird alles so anders? Warum sind Vater und Mutter so in Sorge? Warum hört sie so oft von Not und Elend? Warum hat Heiner so ein kantiges Gesicht und so zornige Augen bekommen? Wie sie jetzt zu ihm kommt, hört er nicht auf mit dem Pflügen. Früher, da war dies auch anders. Da durfte sie einmal herumpflügen, während Heiner nur die Zügel hielt und ab und an den Pflug zurechtrückte. Dann sangen sie wohl auch, und er wußte immer eine Geschichte und ein gutes Wort für sie... Jetzt, - er schaut nicht auf. Sie trottet hinter ihm her, spürt die gute, duftende Erde, hört wieder Vaters Stimme: "Vom Hof jagen - - - !" und ein Würgen steigt ihr in den Hals. "Heiner, warum hörst du nicht auf?" "Keine Zeit, Liese, ich muß heute abend früher fertig sein, ich habe Dienst." [49] "Dienst", was ist das? Wo dient Heiner - und wem? Der Bruder hält plötzlich mit einem Ruck das Gespann an. "Liese, nicht bloß bei uns ist Not, - nicht bloß uns wollen sie vom Hof haben" - mit einer weiten Handbewegung weist er über das ganze Land - "überall ist es so, hier bei uns, bei denen drüben, - und dort auch. Im ganzen Reich, Liese. Sie wollen nicht uns kaputt machen - und Jakuhns und Lemkes, - sie wollen Deutschland vernichten. Wir sind bloß ein kleiner Teil. Uns allen wollen sie die Heimat nehmen!" In dieser Nacht kann Liese nicht schlafen. Herbststurm rüttelt an den Fenstern, es regnet, und Liese denkt an den Bruder: Wo ist er? Wo tut er "Dienst"? Und wer ist dieser furchtbare Feind, der sie vernichten will? Sie? Deutschland hat Heiner gesagt, - und das ist das Neue, das Liese in ihrem Denken zu groß und fremd ist. Das geht doch nicht? Das kann doch nicht sein? Was Heimat und zu Hause ist, weiß sie. Daß man ihr das nehmen will, "man", das Geld und die Steuern, - das hat sie in den letzten Wochen gelernt. Aber Deutschland? Ein Brausen ist vor ihrem Fenster, - der Sturm? Nein, Stimmen, Rufe, jetzt versteht sie es deutlich, - ein immer wiederkehrendes Rufen: "Deutschland er- [50] wache!" Dann wird es still. Unten geht die Haustür, Heiner ist zurückgekommen. Am andern Tag muß sie ihn fragen: "Wer hat dir das gesagt - von Deutschland? Wer will es haben, daß du Dienst tust? Und warum?" Heiner schiebt sie schweigend durch seine Zimmertür, weist ihr ein Bild: "Das ist unser Führer", zeigt ihr ein rotes Tuch mit einem seltsamen Zeichen in der Mitte, - "so sieht unsere Fahne aus. Und warum, Liese? Weil Deutschland uns braucht." Noch ehe es richtig Winter ist, müssen sie vom Hof. Liese begreift nichts. Sie kann nicht weinen, sie weiß keine Worte. Sie stützt die Mutter und sieht nicht zurück, als der Wagen sie zur Stadt bringt. Der Vater ist so ruhig, daß man Angst hat vor ihm, und Heiner ist fort. Das ist das schlimmste, daß nun niemand da ist, der ihr auf alle Fragen Antwort gibt. Und es gibt doch so viel, was Liese nicht begreift. Suse ist noch da, das Pferd. Man kann seine Arme um den Hals des Tieres legen und sein Gesicht an das glatte warme Fell drücken. Dann kann man die Augen zumachen und denken, alles sei nicht wahr, und man sei wieder zu Hause. Aber dann ist eines Tages Suse auch fort, und der Vater fährt aus seinem Brüten auf: "Laß mich in Ruh, du weißt doch, daß wir nichts behalten dürfen!" [51] Liese läuft durch die Straßen und sucht den Himmel, sucht Acker und Weite. Aber es bleiben überall Steine und Menschen und Lärm. Abends in ihrer Kammer liegt sie lange ohne Schlaf und sieht ins Dunkle. "Warum"? Und immerzu denkt sie an Heiner. Der tut nun irgendwo Dienst, - Dienst für den Führer, für Deutschland. Sie wird wieder ein wenig froher, als sie an den Bruder denkt, und sie versucht, den Eltern davon zu erzählen. Der Vater hört nicht zu, aber die Mutter, die nun schon lange krank liegt, streicht ihr leicht übers Haar: "Wir wollen hoffen, Liese..." Da weiß das Mädchen, daß die Mutter dasselbe denkt und glaubt wie sie.
Durch die dunklen Straßen geht Liese nach Hause, zur Mutter. Sie sitzt an ihrem Bett und hält ihre schmalen, kranken Hände. "Mutter", sagt Liese, "Mut- [52] ter, Heiner trägt die Fahne, - und die Fahne ist Heimat und Deutschland zugleicht. Der Führer wird die Not zwingen, - auch unsere Not, Mutter. Wir müssen nur glauben."
In dieser Nacht träumt Liese wieder vom Acker, vom Wald und vom See.
|