
[375]
Die Kolonialdeutschen
Rolf Brandt
Um die kleine Stadt Moschi am Fuße des Kilimandscharo herum liegen die
großen Kaffeeplantagen. Sie sind fast alle wieder in deutscher Hand. Am
Dienstag und am Freitag in jeder Woche kommt die Bahn von Tanga und bringt
Post, Güter und sehr wenig Reisende. Am Dienstag und am Freitag also
treffen sich die Farmer dieser ganzen reichen Hochebene auf der Veranda, der
Baraza, des größeren Hotels in Moschi, das einen deutschen
Geschäftsführer hat. Sie kommen am frühen Morgen, wenn
die Sonne noch leichter über der Ebene liegt, auf endlosen Wegen
herangefahren. Sehr oft sind die Frauen dabei, weil man in Moschi auch alle
Einkäufe für die Hausfrau erledigen kann.

[377]
Am Fuße des Kilimandscharo.
|
In den Geschäftsräumen der Asagarakompanie trifft man in zehn
Minuten ein Dutzend deutscher Kaffeepflanzer, die ihre Geschäfte
erledigen. Man kann den Typus des Kolonialdeutschen, wie er jetzt nach dem
verlorenen Krieg geworden ist, dort in dem kleinen Ort Moschi dicht unter dem
Kibo,dem höchsten Berg Afrikas, studieren. Sie tragen die verwaschenen
Khakianzüge mit dem verstaubten Tropenhelm, die Frauen haben einen
doppelten Kalabreser, auch von der Sonne hart mitgenommen, auf dem Kopf.
Auch viele der Frauen tragen die Shorts, die kurzen Leinwandbeinkleider, die
kaum bis zum Knie gehen, dann Wickelgamaschen. Ein hartes Geschlecht. Aus
den Gesichtern, die übrigens alle nicht übermäßig braun
sind - man kann sich dieser Sonne ja niemals aussetzen; auch wenn man
längere Zeit dort ist, muß man sie fürchten wie den
Keulenschlag - brennen helle, lebensstarke Augen. Sie sehen nicht oft in
der Zeit der Weltwirtschaftskrise einen Fremden, am wenigsten einen Landsmann
aus Deutschland. Sie alle haben im Grunde immer wieder die eine Frage: Was
wird? Wohin geht der Weg?
Es geht ihnen schlecht. Sie haben für ihr Schicksal fast alle die gleichen
Worte: Man hat gearbeitet vor dem Krieg, man
hat - die Männer im Felde, die Frauen als Rote
Kreuzschwestern - die vier furchtbaren Jahre in Ostafrika
durchgekämpft, man hat wieder angefangen, man sah den Erfolg schon und
nun, seit zwei Jahren beginnt der mörderische Kampf der Krise, nun
könnten die Haare grau werden vor Sorge. Es ist richtig, ich habe fast
dieselben Worte gehört in Ostpreußen, als die Lerchen sich in das
Himmelsblau warfen und über den hellgrünen Feldern der Wind vom
Haff ein wenig Seeluft brachte. Hier liegt die Sonne wie ein glühender
Kupferklumpen auf der steinernen Umfassung der Baraza, und die Luft ist
unbeweglich und klebt wie eine heiße Kompresse an der Haut. Aber es sind
dieselben Worte, es sind dieselben Menschen aus der gleichen Schicht.
Jüngere Söhne der Landwirtschaft meistens, jüngere
Söhne mit großen Namen alter Familien und aus festem
bäuerlichem Blute auch, die hier meist schon vor dem Krieg
hingegan- [376] gen sind, um ihr
Schicksal in eigene Hand zu nehmen. Es ist vielleicht der beste deutsche Typ
überhaupt, den man hier sehen kann. Sie haben alle unter der Sonne Afrikas
nur noch wie einen ganz leichten Hauch die Eigentümlichkeit des
deutschen Stammes an sich, aus dem ihr Blut geflossen ist. Sie wurden
Väter einer neuen Generation, sie wurden zum Teil Mitschaffer eines neuen
Stammes: Kolonialdeutsche.
Das Schicksal geht mit schweren Schritten durch die Welt; und wer durch die
Welt zog, sah, wie überall durch Not und Elend menschliches Glück
zerstampft wurde. Man sieht auch die schwere Hand des Schicksals über
die sonnigen Abhänge des Kibo gleiten, wie sie über die Landschaft
von Thüringen, der Mark, Ostpreußen oder Schlesien geht. Es sind
die gleichen hellblauen Augen, diese festen Gesichter und diese nordisch
schmalen Wangen, die hier am Äquator den Kampf um ihr Leben und um
das deutsche Gesicht dieses schönsten Teiles von Afrika
kämpfen.
Sie lieben die Freiheit und sie lieben die Weite, die das große Geheimnis
von Afrika ist. Sie haben hier in diesem Bezirk, über dem das
schneebedeckte Haupt des großen Berges leuchtet, ihre besonderen Sorgen,
die sie mit dem Weltmarkt
verbinden: Kaffee. Der ostafrikanische Kaffee
gehört, und deshalb kann er sich trotz der Ungunst der Zeit auf dem
Weltmarkt noch leidlich behaupten, zu den besten Sorten, die überhaupt
angeboten werden. Er ähnelt der arabischen Mokkabohne. Also, das
Gespräch geht um Weltmarkt, Kaffeepreise, um Verfrachtung via London,
um die Frage, ob es sich lohnt, die neuen Maschinen aufzustellen, die den
Werdegang der reifen Kaffeebeere bis zur fertig getrockneten Bohne in eine
schnelle Folge zusammenpressen. Man muß kaufmännisch denken
und handeln. Aber es wird den meisten sauer, sich so umzustellen und sich so
einzustellen. Denn sie sind alle einmal nicht nach Afrika gegangen, um besonders
gute Kaufleute zu werden...
Die Frauen
haben es nicht leichter als die Männer. Wer in die Kolonien
geht, muß wissen, daß er die Freiheit, die dort größer ist,
als im alten Europa, so teuer bezahlen muß, wie wir alles im Leben
bezahlen müssen, was lockend und schön ist. Die Schwarzen an
diesen Abhängen des Gebirgsstocks, die Wadschaggas, sind friedlich
geworden, und sie haben die Zeit, da die deutsche Flagge dort wehte, alle in guter
Erinnerung. Aber sie haben die Eigentümlichkeiten der Neger im
äquatorialen Afrika, denen eigentlich eine glückliche Natur das
historische Recht auf Faulheit zugebilligt hat. Sie haben eine gute
Auffassungsgabe und geben gute Diener und Hilfskräfte
ab - wenn man sie in jeder Minute beaufsichtigt. Man hat also Bedienung
meist im Überfluß, jedenfalls mehr, als man es in ähnlicher
Lage in Europa haben könnte. Man hat die Lebensmittel von einer ganz
unwahrscheinlichen Billigkeit, soweit man sie nicht selbst erzeugt. Man braucht
keine Kleider, der Tropenanzug kann für ein paar Jahre halten. Aber auch
nur jeden kleinsten Schein von Komfort muß man teuer bezahlen. Oben in
Marangu in 1500 Meter Höhe liegt ein kleines deutsches Hotel. Es
hat eine zauberhafte Aussicht, einen Blick über die Ebene hinweg zu den
Usambara-Bergen. Rosen blühen dort das ganze Jahr und Lilien und
afrikanische Veilchen und Erdbeeren gibt es im
Dezember - aber man muß sich schon überlegen, ob man das
Benzin verfahren will, um sich dort ein paar Tage zu erholen. In diesem Hotel,
dies muß man wohl erzählen, um das Leben der Kolonialfrau in
einem [377] kleinen Bild ganz
genau zu fangen, also dort oben gibt es - der Wirt hat es selbst
zusammengebastelt - ein ganz ausgezeichnetes Rundfunkgerät und
einen sehr guten Empfang. An einem Abend saß eine junge Baltin dort, die
war schon drei Jahre in Afrika, hatte dort Kinder bekommen und war eine tapfere
Frau. Denn Tapferkeit ist das Erste, was man dort draußen braucht. An
diesem Abend aber hatte sie die Kopfhörer umgeschnallt, der Wirt bastelte
und suchte und plötzlich liefen der jungen Frau ein paar Tränen
über die Wangen. Sie hatten Berlin, mitten unterm Äquator hatten sie
Berlin, in einer Mondnacht, da der Kibo seltsam weiß und groß
über den blühenden roten Akazienbäumen leuchtete und die
Bananenhaine in Silber gebadet waren. Sie hatten Berlin! Und die junge Frau
hörte plötzlich das große Orchester aus der Ferne dunkel
rauschen, und sie hörte die Stimmen der Sänger. Es war eine
Opernübertragung der Berliner Staatsoper. Da weinte sie. Nicht, weil sie
unglücklich war, nicht, weil sie Afrika nicht liebte, aber da in der
Hörmuschel war der ganze andere Teil des Lebens, auf den man verzichten
muß, wissend und wollend, drüben in den Kolonien.
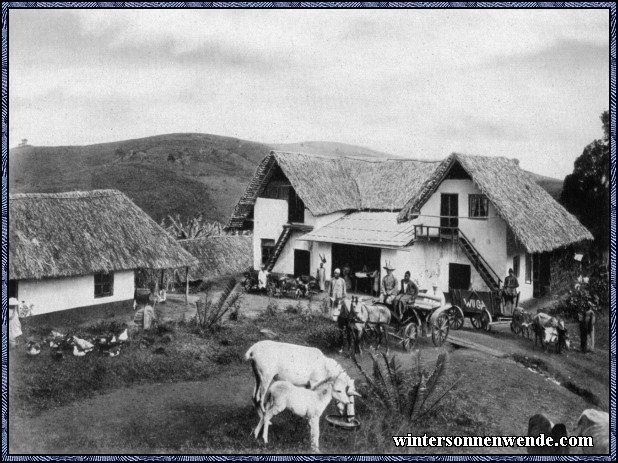
[381]
Ansiedlung in Usambara.
|
Das Land ist fruchtbar und vergilt reichlich alle Mühe. Aber jede Art von
Komfort muß, es war schon ausgeführt, teuer bezahlt werden; und
wer nicht auf europäische Bequemlichkeiten verzichten kann, der wird
unglücklich in den Kolonien werden. Eine Zeitlang allerdings hatte es
gerade in Ostafrika, aber auch in Südwest, den beiden wertvollsten [378] Teilen des ehemaligen
deutschen Kolonialbesitzes, so ausgesehen, als ob sich die dort arbeitenden
Deutschen schnell zu einer wohlhabenden, ja, reichen Klasse entwickeln
könnten, zu einem Reichtum, der auch im Äußeren des Lebens
zum Ausdruck kommen würde. Diese Entwicklung zeichnete sich in den
Jahren nach der Rückkehr der Deutschen in Ostafrika, also seit
Juni 24 bis zum Jahre 29, da die Krisis ganz stark auch in die
afrikanische Plantagenwirtschaft eingriff, besonders in Usambara ab, in der
schönen afrikanischen Hügelwelt, die langsam zum
Usambaragebirge emporsteigt. Dort wurde Sisal gepflanzt. In den neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts führte Dr. Hindorf zweiundsiebzig
Agavenpflänzlinge von Yukatan nach Deutsch-Ostafrika ein. Damit begann
die große Entwicklung, die so schnell ging, daß man voraussehen
konnte, daß Deutsch-Ostafrika ein wichtiges Gebiet für die
Weltwirtschaft sein würde. Der Sisalhanf verdrängte jede andere
Hanfart vom Markt. Die Arbeiterverhältnisse waren gerade in
Deutsch-Ostafrika bei dem konservativen Charakter seiner
Negerbevölkerung auf Generationen hinaus günstig. An diesen
Vorbedingungen hat sich natürlich im Grunde nichts geändert.
Sobald den Deutschen die Einreise wieder gestattet war, kamen sie, Menschen,
die nirgendwo mehr glücklich sein konnten, als drüben in den
freieren Verhältnissen, in der Weite, in der persönlichen
Unbeschränktheit. Sie haben alle ganz ungeheuer gearbeitet. Sie kauften die
verschleuderten deutschen Besitzungen wieder; sie waren meist in den
Händen von Indern und Griechen, denn die Engländer hatten genug
mit ihrer Lieblingskolonie Kenya und überall sonst in der Welt zu tun.
Außerdem hatte die junge englische Generation ganz im Gegensatz zu der
jungen deutschen eine Abneigung, in die Kolonien zu gehen; der Krieg hatte auch,
in ganz anderer Weise als in Deutschland, das Wesen des englischen Menschen
erschöpft. Im Jahre 1924 wurden aus dem ehemaligen
Deutsch-Ostafrika rund achtzehntausend Tonnen Sisal ausgeführt, im Jahre
1928 über sechsunddreißigtausend. Dazwischen liegen vier Jahre
deutscher Arbeit. Die Ausfuhrzahl war in dieser Zeit verdoppelt worden.
Hinter Tanga entstanden auf den Hügelkuppen weiße Villen,
Kraftstationen wurden gebaut, mitten in der Gebirgswelt, in der während
des Krieges die große Vegetation Afrikas alle Kulturarbeit wieder
überwuchert hatte, brannte nun elektrisches Licht, Windfächer
rauschten, Autos fuhren auf neuen ausgezeichneten Chausseen. Man nannte im
Lande diese deutschen Besitzer von Landstrecken, die wie kleine
europäische Fürstentümer waren, die "Sisalkönige".
1928 stand die Tonne Sisal auf vierundfünfzig Pfund. 1930 war der Preis
auf zweiundzwanzig Pfund und zehn Schillings gesunken und, wenn man
vorsichtig kalkulierte, konnte man auch bei diesem Preis noch auskommen! Eine
einzige Plantage, allerdings die größte, die des Herrn von Brandis,
der den großen deutsch-englischen Konzern gebildet hatte, hatte drei
Sisalfabriken errichtet, von denen in einem Turnus von zehnstündiger
Arbeit jede Anlage einhundertzwanzig Tonnen Sisalblätter täglich
verarbeitete. Von 24 bis zum Jahre 28 schöpfte man den
Reichtum....
Um die gleiche Zeit hatte Südwest-Afrika eine ähnliche
wirtschaftliche Blüte durch die gute Entwicklung der Viehzucht, und die
Kokospflanzer an der Küste Ostafrikas mußten notwendigerweise,
wenn nicht die Krise gekommen wäre, in wenigen Jahren Millionäre
werden. Die deutsche Kaufmannschaft sowohl in
Südwest- wie in Ostafrika erkämpfte [379] sich sehr schnell ihre
Plätze wieder. Deutsche Waren wurden eingeführt, trotzdem hier mit
Schwierigkeiten zu kämpfen war. Allein die eine große Farm in
Usambara, Sigi Segoma, bezog für fast eine halbe Million Mark
deutsche Waren, von den neuesten Kruppschen Maschinen bis zu Leinwand und
Konserven.

[379]
Ochsengespann bei Windhoek
in Deutsch-Südwestafrika.
|
Diese wirtschaftliche Betrachtung ist nötig, um die Gestalt des
Kolonialdeutschen richtig zu sehen. Denn die nun folgende Notzeit hat an den
innerlichen Tatsachen nichts ändern können. Sie sind dem Charakter
und der Betätigung nach Herrenmenschen, die dem Leben den großen
Erfolg abringen wollen.
Die Verhältnisse, unter denen die Deutschen leben, sind selbst im
äquatorialen Afrika sehr verschieden; anders an der Küste, wo die
Kokospflanzer sitzen, die ein recht erhebliches Kapital aufbringen müssen,
um überhaupt die Pflanzung in Gang zu
bringen - unter sechzigtausend Mark wird man dort nicht viel anfangen
können, und dann muß man sparsam und bescheiden acht Jahre
leben, bis die Kokospalmen die ersten großen Ernten
bringen - anders in Iringa im Süden
Ost-Afrikas, wo in einer Gebirgswelt, die an den deutschen Schwarzwald erinnert,
deutsche Bauernsiedler sich angesiedelt haben. Sie kommen aus kleineren
Verhältnissen, als etwa die Sisalkönige oder die Plantagenbesitzer
[380] um Moschi, aber sie
müssen im Grunde alle aus demselben Holz geschnitzt sein. Dabei ist eines
leicht zu erkennen: Je kleiner die Verhältnisse sind, desto mehr wird es
nicht nur auf den Mann, sondern auch auf die Frau ankommen, ob man sich
drüben durchsetzt. Auch das Landschaftsbild ist verschieden. Afrika ist ja
im Grunde viel mannigfaltiger gestaltet, als Europa. Der deutsche Landwirt in
Südwest findet ganz andere Bedingungen vor, eine ganz andere
Bevölkerung im Grund auch, als der Tropenpflanzer an der Ostküste
um Daressalam oder Tanga.
Das Deutschtum im Südwest hatte außerdem durch das Abkommen
mit der Südafrikanischen Union-Regierung einen ganz anderen, viel
sicheren Untergrund, als die Deutschen in dem Mandatland Tanganjika, wie die
Engländer unser altes Ostafrika nennen. Das deutsche Gepräge des
Landes war niemals verloren gegangen. Die Farmen waren in deutscher Hand
geblieben, und nach einer relativ kurzen Zeit der Bedrängnis setzte sich die
Kraft des deutschen Elementes auch äußerlich wieder durch. Die
deutsche Sprache wurde zweite Amtssprache. Eine deutsche Flugzeuglinie ging
über das Land. Man mußte schon rein zahlenmäßig mit
dem auch wirtschaftskräftigen deutschen Element rechnen.
Politisch lagen die Dinge auch anders. Die Union geht ihren eigenen Weg, der
Schritt für Schritt mit unabänderlicher Sicherheit fort von England
führt, während in Ostafrika die Dinge so liegen, daß mir
hervorragende Kolonialengländer, Pflanzer und hohe Beamte alle wie aus
einem Munde gesagt haben: "Wir geben Ostafrika nur zurück nach einem
verlorenen Kriege, denn es ist die Schlüsselstellung für Kenia,
Uganda und den Sudan". Trotzdem zeichnet sich aber auch in Ostafrika eine
Entwicklung ab, die zu ganz anderen Zielen führen kann, als sie in London
erstrebt werden. Sehr undeutlich und vielleicht sehr fern sieht man eine
weiße Bevölkerung, die so kräftig ist, daß sie die
Bestimmung über das Land, das durch ihre Arbeit sein Gesicht bekommen
hat, selbst in die Hand nehmen will, unabhängig von Londoner
Vorschriften. In diesem Falle würde das deutsche Element eine besonders
entscheidende Rolle spielen können, weil es der Charakterbildung nach aus
besonders aktiven und tatkräftigen Menschen besteht.
Die Prägung des Menschen durch den Einfluß der Landschaft, die
man in Deutschland bei allen deutschen Stämmen, ebenso in allen
europäischen Kulturländern - ganz stark bei den
Engländern, fast ebenso stark bei den Franzosen und Spaniern, auch bei den
Italienern - feststellen kann - hat naturgemäß in Afrika
nicht die gleiche Kraft, denn es fehlt die Folge der Generationen. Die rein
tropischen Gebiete werden ja in diesem Sinne überhaupt niemals Heimat
des weißen Mannes sein, weil sie nicht das Land der Kinder und
Mütter sein können. Aber auch unter dem Äquator, nicht bei
den deutschen Siedlern, weil ihre Entwicklung ja durch den Krieg unterbrochen
wurde, sondern bei den Engländern im
Kenia-Gebirge gibt es schon Familien, die drei Generationen lang dort
aufgewachsen sind und sich behauptet haben. Auch in
Südwest-Afrika kann man vielleicht schon den Einfluß der
besonderen landschaftlichen Verhältnisse auf die Ausprägung der
Deutschen erkennen. Vorläufig aber war immer noch das andere
entscheidend: die Auslese. Wer der starken Natur des Landes, seiner heroischen
Einsamkeit, seinen Dimensionen nicht [381] gewachsen ist, wird
untergehen. Die Zeit des eigentlichen Pioniertums in Afrika ist vorüber. Die
besten deutschen Namen stehen in den Listen der Entdecker des schwarzen
Erdteils. Jetzt führen überall die Autostraßen durch das Land,
Flugzeuge bringen in acht Tagen die Post aus Europa, es gibt keine weiße
Stelle mehr auf der Karte Afrikas. Aber gerade die Deutschen, die ihr Land noch
einmal wieder erobern mußten, haben den Lebensstil und die Art von
Pionieren beibehalten. Sie sind ja nicht nur wie die anderen Kämpfer
für das Schicksal der weißen Rasse, sie kämpfen auch jeder
einzeln für ihr Deutschtum. Diese Notwendigkeit der Behauptung schafft
den Typus des Kolonialdeutschen, einen neuen deutschen Volksstamm, wenn man
so sagen will, aus allen Kräften des deutschen Volkes entstanden und
genährt.
Ob man sie im Grasland, in der Steppe Südwest-Afrikas sieht, zwischen
den großen Palmenwäldern von Bagamojo, in der furchtbaren Hitze,
die nur manchmal der leichte Wind vom Indischen Ozean lindert, ob in den
kleinen Hütten des Iringa-Berglandes oder in den weißen Villen von
Usambara, die wie kleine Schlösser durch die afrikanische Nacht leuchten,
überall haben sie sich zur harten Form entwickeln müssen, diese
deutschen Männer und Frauen. Eine Menschenart, die arbeiten kann und
der Not des Tages mit Entschiedenheit ins Antlitz sieht. Der Mann, der nicht
gelegentlich die Büchse hochreißen kann, um sich zu verteidigen,
wird nicht glücklich in Afrika sein. Die Frau, deren Liebe [382] schönen
Kleidern, der Musik oder der Kunst gehört, wird selbst, wenn sie dazu
entschlossen wäre, ihr Leben drüben in den Gang des Tages nicht
einfügen können. Sie haben das andere dafür, diese
Nächte, die unvergeßlich sind und erschütternd in der
Größe ihrer Einsamkeit, wenn unter dem fremden Sternhimmel die
Riesenorgel der Zikaden ertönt, auf- und abschwellend, ein dunkler Ton in
der endlos blau fließenden Nacht, das Brüllen der Löwen, das
selbst die Vogelrufe stumm macht, das Schreien der Schakale und das Lachen der
Hyänen, der Gesang der Neger, fremd, monoton und traurig und seltsam
sehnsüchtig, das Locken der afrikanischen Taube, das tiefe Gurren, das in
die schnelle Abenddämmerung klingt. Die grüne Stunde nach sechs
Uhr, wenn die Sonne nachläßt und alles von einem
merkwürdigen Licht erfüllt ist wie mit leichtem grünen Glanz;
der erste Windhauch, der von den Bergen niederfällt nach dem
glühheißen Tag; der weiße, harte Mondschein über der
Steppe, dann das andere: das königliche Gefühl, wie aus der Wildnis
die Kultur wächst, wie der Geist des weißen Mannes das Land
stärker in Besitz nimmt als die Arbeit der Neger.
Noch ist der Typus des Kolonialdeutschen kein festgelegter Begriff. Wir sind
spät in die Kolonialgeschichte aktiv eingetreten, und der Krieg hat diese
Entwicklung aufgehalten. Er hat sie nicht unterbrochen. Das ist sicher: So wie es
Kolonialdeutsche gibt, in denen die besten und siegreichen Eigenschaften unserer
Rasse verkörpert sind, so wird es wieder deutsche Kolonien geben.
|