
Fels im Chaos
Die Grenzpfähle, die erst 1866 und dann, nach der Gründung des
Zweiten Reiches, 1871 zur nunmehrigen Unterscheidung von "Reichsdeutschen"
und "Österreichern" inmitten des geschlossenen deutschen
Siedlungsraumes in die ebenfalls uralte deutsche Erde gerammt wurden, glichen
wirklichen Pfählen in dem lebendigen Fleische des Volkskörpers. Es
schien, als breite sich von den Wunden, die durch sie diesem Volkskörper
geschlagen worden waren, ein Krankheitsherd aus, der allmählich die
Zufuhr frischen Blutes aus den Kraftquellen des Körpers unterband und die
abgesonderten Glieder mehr und mehr dem Absterben nahebrachte. Und das
während eines Zeitlaufes, da diese Glieder zur Abwehr von Gefahren, die
gegen den ganzen Volkskörper herandrängten, gerade das ganze
volle Ausmaß einer ständigen Blutzufuhr notwendig hatten.
Vermochten doch die Deutschen Österreichs von dem Tage ab, da ihre enge
politische Verbindung mit dem Deutschen Reiche nicht mehr bestand, sogar ihrer
Mittlerrolle zwischen der Nation und den Völkern des Südostraumes
nicht mehr vollauf gerecht zu werden. Über die Tatsache konnte auch die
später erfolgende Schaffung des Zweibundes mit ihrer Festigung des
"freundschaftlich nachbarlichen Verhältnisses" und den vielen
schönen Worten von der Nibelungentreue und den sich auch weiterhin
gleichbleibenden Aufgaben des "Brudervolkes" in Österreich nicht
hinwegtäuschen. Das sich seit 1866 von Jahr zu Jahr steigernde Erwachen
der anderen Völker innerhalb [255] des Habsburgerstaates
zwang die in Österreich verbliebenen Deutschen jetzt selbst zur Abwehr
und zur Verteidigung ihres im Rücken vom großen
Volkskörper abgetrennten und an den Außenfronten von allen Seiten
immer enger geschnürten Lebensraumes. Allein auf sich selbst gestellt,
hatten sie wohl als "zuverläßlichstes Staatsvolk" alle Verpflichtungen
und Belastungen treuer Untertanen im weitesten Ausmaße zu tragen, fanden
aber keine Unterstützung in der Sicherung ihrer eigenen völkischen
Interessen, besonders dann, wenn das ewige Ausgleichsspiel zwischen den
Völkern zum Nutzen des Habsburgerstaates die Vertreter eines anderen
Volkes zeitweilig zu Trägern der Staatsidee machte.
"Ausgleich" war nach 1866 überhaupt die neue Parole, von der sich das
Haus Österreich eine endliche Stabilisierung des
Nationalitätenproblems im Sinne seiner Hausmacht versprach. Da die
Lockerung der Zügel nach der absolutistischen Regierungsperiode
Schwarzenbergs nur ein neuerliches Aufbäumen der niedergehaltenen
nationalen Leidenschaften gebracht hatte, versuchte man es jetzt mit einer Art
Sättigung des Begehrlichsten unter den Unzufriedenen im
Völkerreiche. Diese Sättigung war der sogenannte "Ausgleich" vom
Jahre 1867. Aus der Not geboren - hatte doch Bismarck durch eine
Verständigung mit den Magyaren diesen und nicht den Deutschen
Österreichs auch für die Zukunft die Rolle einer Art von Gendarmen
zur Verhinderung reichsfeindlicher Strömungen am Wiener Ballhausplatze
zugedacht - kam 1867 durch den von Kaiser Franz Josef berufenen
österreichischen Reichsrat der "Ausgleich" mit den Magyaren zustande.
Dieser Ausgleich brachte eine grundlegende Veränderung der Verfassung
des Habsburgerstaates. Das Kaisertum Österreich wurde von nun ab in zwei
durch das Flüßchen Leitha voneinander geschiedene
Reichshälften geteilt. Als "im Reichsrate vertretene Königreiche und
Länder" hatte der österreichisch verbliebene Teil mit den
"Ländern der ungarischen Krone" nur mehr den Herrscher, die Vertretung
der außenpolitischen Interessen, die Verwaltung der Finanzen und das Heer
gemeinsam. So entstand aus dem bisherigen Block des zentralistischen
Österreichs die dualistische Doppelmonarchie
Österreich-Ungarn. "Österreicher" waren von nun ab Deutsche,
Tschechen, Polen, Ruthenen, Rumänen, Slowenen, Italiener und Ladiner,
"Ungarn" aber Magyaren, Slowaken, Kroaten und Serben, zu welchen noch die
Angehörigen der deutschen Volksgruppen in den Ländern der
ungarischen Krone hinzuzurechnen waren. Die wirklichen großen Gewinner
dieses Ausgleiches waren in erster Linie die 8 Millionen Magyaren. Brachte ihnen
doch die Zuerkennung der staatlichen Eigenständigkeit die volle
Souveränität [256] über 3,5
Millionen Rumänen, 2 Millionen Slowaken, 500 000 Serben und 2,5
Millionen Kroaten. Geeint in einem unnachgiebigen Nationalgefühl,
verstanden sie es von nun ab, nicht nur die anderen Völker der ungarischen
Reichshälfte mit härtesten Mitteln niederzuhalten, sondern sie
trieben als gleichberechtigter Partner der österreichischen
Reichshälfte jetzt eine Forderung nach der anderen im eigenen, aber
keineswegs im Interesse des Gesamtstaates ein. In der österreichischen
Reichshälfte hingegen herrschte machtpolitisch das Chaos. Dem
geschlossenen Magyarentum standen hier einmal die Deutschen, dann wieder die
Polen, zeitläufig sogar die Tschechen als Vertreter Österreichs
gegenüber. Daß sich die Slawen dieser Reichshälfte, die sich
natürlich mit den Slawen der ungarischen Länder im Kampfe gegen
das Magyarentum verbanden, nicht als Verfechter des Habsburgischen
Machtgedankens, sondern als Vorkämpfer ihrer eigenen Freiheit
betrachteten, lag auf der Hand. Diese Freiheit war ursprünglich noch als
eine Art Autonomierecht ohne Sprengung des österreichischen
Staatsgedankens gedacht. Das wirkliche Ziel einer Selbständigkeit der
slawischen Staaten brachte erst die letzte Entwicklung vor und zum Teil sogar
noch während des Weltkrieges, nicht zuletzt als Folge der
rücksichtslosen Politik der Magyaren gegen die unter ihrer Herrschaft
verbliebenen und ihrem Hoheitsgebiet benachbarten Südslawen.
Vom Stande des Deutschtums aus betrachtet, erwuchsen diesem aus den
Autonomie- und Selbständigkeitsbestrebungen der mit ihm in dem gleichen
Staatsverbande zusammenlebenden Völker Gefahren. Die Tschechen
verfochten seit der Erweckung ihres Nationalbewußtseins im
Achtundvierzigerjahr den Gedanken des tschechischen Großstaates als
Vorposten des panslawistischen Blockes, der den Umfang der späteren
Benesch-Tschechoslowakei erreichen und damit 3,5 Millionen Deutsche aus
ihrem Siedlungsgebiet abdrängen sollte.
Die Südslawen, unter sich durch Sprache, Kultur, Schrift und Religion
selbst noch uneins, erhielten ihren Auftrieb zur Verfechtung eines gemeinsamen
südslawischen Einigungsgedankens einmal durch den Abwehrkampf gegen
das Magyarentum, andererseits ebenfalls durch das Vorantragen des von
Rußland entrollten panslawistischen Banners. Erst noch für Habsburg
als Vollstrecker seiner Staatsautorität gegen die Magyaren vereint, trennten
sich Serben und Kroaten dann aber seit dem Aufkommen des
großserbischen Gedankens. Als Träger einer höheren Kultur
und einer bewährten soldatischen Tradition lehnten die Kroaten eine
serbische Bevormundung ab und hofften, besonders seit der Einflußnahme
des späteren Thronfolgers Franz Ferdinand auf die Gestaltung der
Innenpolitik, eine Sonderstellung als drittes "Staats- [257] volk" neben den
Deutschen und Magyaren zu erhalten. Erst die völlige Uferlosigkeit der von
Karl von Habsburg eingeschlagenen Politik in den letzten Entscheidungsjahren
des Weltkrieges brachte das endgültige Umschwenken der kroatischen
Volksführer in die Reihen der durch die Serben und Slowenen vertretenen
südslawischen Staatsgegner. Die Slowenen aber waren die
gefährlichsten Gegner des Deutschtums. Rings um die Sprachinsel der
Gotschee, dann an den Randgebieten der südlichen Steiermark und
Kärntens siedelnd, breitete sich ihr Volkstum mit großer
Schnelligkeit aus. Fruchtbar, arbeitsam und intelligent verstanden sie es nicht nur,
sich immer tiefer in das deutsche Siedlungsgebiet vorzuschieben, sondern sie
bildeten gleichsam auch eine Art Kitt, der die Gegensätze zwischen den
Serben und Kroaten überbrückte. Im Gegensatz zu den Kroaten und
Serben war ihre politische Haltung scharf gegen das Deutschtum ausgerichtet. Es
bestand kein Zweifel, daß sie bei der Verwirklichung der
südslawischen Einigungsidee ihre Hand nach deutschem Volksboden
ausstrecken würden.
Magyaren also, Tschechen und ein gewichtiger Teil der Südslawen reichten
sich bei aller sonstigen Gegnerschaft in ihren Absichten zur Vernichtung des
Deutschtums getreulich die Hände. Da in Galizien eine deutsche Frage im
Kampf zwischen den Polen und Ruthenen nicht in den Vordergrund trat, die
Rumänen Siebenbürgens aber, selber noch über ihre Zukunft
im unklaren, sich mit den benachbarten Siebenbürger Sachsen im
Widerstande gegen die Magyaren verbanden, mußten die Deutschen in den
drei genannten Völkern ihre Hauptgegner sehen. Auch die immer wieder
zutage tretende Absicht Italiens, seine Staatsgrenze bis auf den Brenner
vorzuschieben, brachte auch dem tausendjährigen Deutschtum Tirols ernste
Gefahren.
Dennoch verzichtete ein großer Teil des Deutschtums noch durch viele
Jahre hindurch auf eine entschlossene Abwehr der seinem Volkstum drohenden
Gefahren. Im Gegenteil, es schien tatsächlich, als ob die seit 1816 erfolgte
Abschnürung vom großen Volkskörper jenes langsame
Absterben seiner Glieder vorwärtstrieb, das in der Bereitschaft bestimmter
Kreise der Deutschen, auf die übrigen Völker im Sinne einer
staatsbejahenden Haltung einzuwirken, seinen tragischen Ausdruck fand. Bis dann
der systematische Vernichtungskampf gegen alles Deutsche, der
hauptsächlich von den Tschechen ausging und der in Ministern vom
Schlage eines Hohenwart und Taaffe noch überdies wohlwollende
Förderer fand, endlich doch eine Abwehrfront bei den Deutschen
aufrichtete. Allerdings hafteten dieser Front bereits die Spaltpilze römische
Kirche, Liberalismus und Sozialdemokratie an. Gerade die römische Kirche
machte sich in der protschechischen Haltung der deutschen Klerikalen zum
[258] böhmischen
Wahlgesetz zur ausgesprochenen Verräterin an der deutschen Sache. Die
Aufhebung der deutschen Amtssprache, jener weitschauenden Einrichtung Maria
Theresias, die Abtrennung einer tschechischen Universität von der uralten
deutschen Alma mater Prags, das Verschwinden der deutschen Inschriften
von den Ämtern, Kommunalverwaltungen, Schulen und
Straßenschildern zwangen aber wenigstens die volksbewußten Kreise
der Deutschen zum Widerstand. Ein leuchtendes Vorbild in diesem Kampfe war
Georg von Schönerer mit seinen Forderungen des Linzer Programmes.
Aufbauend auf den völkischen Grundsatz der Schaffung eines gesunden
Bauern- und Gewerbestandes, forderte er eine grundlegende Änderung in
der Verfassung und sagte der Regierung, vor allem aber auch den
judendurchseuchten Liberalen schärfsten Kampf an. Zuletzt brachte aber
die berüchtigte Sprachenverordnung des Polen Badeni doch eine
gemeinsame Haltung der Deutschen zustande. Als bekannt wurde, daß
Minister Badeni, um tschechische Stimmen für den ungarischen Ausgleich
zu gewinnen, neuerliche Sprachenverordnungen für Böhmen erlassen
hatte, die für sämtliche nichtmilitärische Behörden auch
in rein deutschen Gebieten die Doppelsprachigkeit anordneten, ging das deutsche
Volk auf die Straße. In allen Städten des deutschen Siedlungsgebietes
kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen dem Volke und den
Behörden. Auch die deutschen Abgeordneten legten die Tätigkeit des
Reichsrates lahm. Erst als Blut floß und slawische Truppen auf Deutsche
schossen, griff Franz Josef ein und enthob Badeni von seinem Posten.
Ausschreitungen der Tschechen waren daraufhin die Antwort. Als jetzt auch die
Sprachenverordnungen Badenis aufgehoben wurden, rotteten sich in
Böhmen und Mähren die Tschechen zu Gewalttaten gegen die
Deutschen zusammen. Während Franz Josef den Volksvertretungen durch
Auflösung des Parlaments jede Möglichkeit weiterer "nationaler
Obstruktionen" entzog, verweigerten tschechische Reservisten bei den
Kontrollversammlungen zum ersten Male die Meldung in deutscher Sprache.
Ungeschminkt erhob tschechischer Meuterergeist jetzt öffentlich das Haupt.
Diejenigen, die soeben erst als slawische Soldaten auf Deutsche zum Schutze des
Habsburgerstaates geschossen hatten, sagten dem einzigen bisher noch
unberührt gebliebenen Bollwerk der Ordnung inmitten des Chaos, dem
Heere, jetzt offen den Kampf an.
Das Heer glich während all der 1866 folgenden Jahre tatsächlich
einem Fels, das die Brandungen der politischen Sturmfluten, unermüdlich
nach einem geeigneten Punkt zur Unterhöhlung suchend, umbrandeten.
Auch für das Heer hatte das Entscheidungsjahr des deutschen
Bruderkampfes endlich den längst notwendig gewordenen grundlegenden
[259] und die ganze bisherige
Wehrverfassung des Staates umwälzenden Neuaufbau gebracht. Aus der
Niederlage von Königgrätz erwuchs dem im Ausgleich neu
zusammengefügten Staatsgebilde endlich die allgemeine Wehrpflicht. Sie
wurde erst im Dezember 1866 vom Kaiser Franz Josef dekretiert und zwei Jahre
später, nach Überwindung bedeutsamer durch die politischen
Wehrausschüsse in Wien und Budapest erhobenen Schwierigkeiten, auch
zum Gesetz erhoben. Doch schon in ihrer äußeren Konstruktion glich
diese Wehrverfassung einem Spiegelbilde des innerstaatlichen Zwiespaltes. Es
wurden drei selbständige Körper gebildet. Das dem Schutze beider
Reichshälften zur Verfügung stehende gemeinsame kaiserlich und
königliche (k. u. k.) Heer und die k. u. k.
Kriegsmarine, die kaiserlich-königliche (k. k.) österreichische
Landwehr und die königlich-ungarische Honved (Landwehr). Die
Landwehren gehörten somit zu den stehenden Heereskörpern,
unterschieden sich jedoch von der k. u. k. Armee dadurch, daß
ihre ursprüngliche Aufgabe nur im Schutze der Grenze der eigenen
Reichshälfte bestand. Diese die Wehrkraft des Völkerreiches
immerhin einigende Bestimmung fiel erst im Jahre einer zeitweisen
Annäherung der Regierung an die Deutschen, 1893. Ursache der
Dreiteilung des Heeres in die gemeinsame Armee, die österreichische
Landwehr und ungarische Honved, war lediglich die Obstruktion der Magyaren.
Unentwegt hielten sie an dem 1848/49 so blutig verwirklichten Gedanken eines
ungarischen Nationalheeres fest. "Die gemeinsame Armee mit deutscher
Kommandosprache, die den Einheitsgedanken verkörperte, sahen sie
zunächst noch als notwendiges Übel an. Eine ungarische Landwehr,
die, von der Armee getrennt und dem Reichskriegsministerium nicht unterstellt,
die Tradition des alten Landesaufgebotes, die Insurrektion, glanzvoll pflegte,
entsprach ihren nationalen Hoffnungen, machte freilich gerechterweise auch eine
österreichische Landwehr nötig." (G. Nitsche.) Es sprach
immerhin für das Geschick der mit der Organisation der neuen Wehrmacht
betrauten Männer wie Erzherzog Albrecht, den beiden Kriegsministern
Freiherr von John und Feldzeugmeister Freiherr von Kuhn sowie
dem Leiter der Abteilung für Heeresorganisation Freiherr von Horst,
daß sie es einerseits verstanden, den Magyaren durch Ernennung der
ehemaligen Revolutionsgenerale Klapka, Vetter und Percgel zu
Honveddistriktskommandanten entgegenzukommen und andererseits in
besonderer Heranziehung des alpenländischen deutschen Elementes zum
Landwehrdienst ein bewährtes Fundament der österreichischen
Wehrkraft zu schaffen.
Die Honved wurde unter Einbeziehung der nunmehr gänzlich der
Auflösung verfallenden Grenzverbände in
28 Infanterie- und 10 Husarenregimenter gegliedert. Zu den Truppenteilen
dieser ungarischen [260] Landwehr mit
ungarischer Kommandosprache gehörten aber jetzt ebenso deutsche
(westungarische, siebenbürgisch-sächsische) wie kroatische,
serbische, slowakische, karpatoukrainische und rumänische
Verbände. Es konnte sich daher jenes, von Otto Gallian in seinem
Büchlein Der österreichisch-ungarische Soldat im Weltkrieg
als so bezeichnend geschilderte Bild ergeben, daß z. B. auf dem
Exerzierplatz einer westungarischen Stadt ein aus magyarischen Mannschaften
bestehendes Infanterieregiment des gemeinsamen Heeres unter deutscher
Kommandosprache exerzierte, während ein daneben aufmarschierendes,
aus deutschen Burgenländern bestehendes ungarisches Honvedbataillon mit
magyarischen Kommandoworten ausgebildet wurde. Aus der Schilderung dieser
Zusammensetzung der "ungarischen" Honved mag es vielleicht manchem
Kriegsteilnehmer aus dem Altreich erklärlich erscheinen, warum auch
Verbände der sonst so zuverlässigen ungarischen
Honved - gerade während der russischen Einbruchsschlachten des
Sommers 1917 - verschiedentlich versagten. Diese "Ungarn" waren eben
keine Magyaren, sondern Rumänen, Karpatoukrainer, Serben oder
Hannaken.
Für den Ausbau der Honved bewilligte die Volksvertretung in Budapest
ungeschmälert die eingebrachten Etatsvorlagen. Der magyarische
Nationalstolz schmiedete damit seiner ungarischen Landwehr bedeutsamer und
vollkommener die Waffe, als er dies für das gemeinsame Heer zu tun bereit
war. In der österreichischen Reichshälfte hingegen hing die
Bewilligung des Landwehretats überhaupt vom guten Willen der Polen,
Ruthenen, Tschechen und Italiener ab. Es war also kein Wunder, daß die
eigentliche Stärke der österreichischen Landwehr
hauptsächlich in der Wehrkraft des Deutschtumes wurzelte. Erst nur in
Bataillonen formiert, wuchs sie, allerdings in engster Anlehnung an das
gemeinsame Heer, aber dennoch unter vielfacher Berücksichtigung
althergebrachter Wehreinrichtungen in den Ländern zu Regimentern heran.
In ihrer Ausbildung und Verwendung dem gemeinsamen Heere durchaus
gleichwertig, wurden 36 Landwehrregimenter geschaffen, die erst in der
zweiten Hälfte des Weltkrieges in Schützen umbenannt wurden.
Tirol aber, dessen Wehrverfassung noch immer besondere
Berücksichtigung verlangte, stellte drei der besten Regimenter des
österreichischen Heeres, die Tiroler Landesschützenregimenter als
alpine Spezialtruppe und eine Division berittener Landesschützen auf.
Landesschützen zu Fuß und zu Pferd gab es ebenfalls in Dalmatien.
Die Kavallerie formierte außerdem 6
Landwehr-Ulanenregimenter in den übrigen österreichischen
Kronländern, deren Mannschaften jedoch hauptsächlich aus Polen
bestanden. Der Gesamtstand der k. k. Landwehr betrug 1892 10 000
Mann, der der Honved 12 500 Mann. (Nach [261] G. Nitsche.) Das
gemeinsame Heer gliederte sich in der Hauptsache in 102
Heeresinfanterieregimenter, 4 Regimenter der Tiroler Kaiserjäger, 22
Feldjägerbataillone, dann nach 1878, vier
bosnisch-herzegowinische Infanterieregimenter, 15
Dragoner-, 16 Husaren- und 12 Ulanenregimenter. Die Artillerie entwickelte sich
bis 1894 zu 14 Feldartillerie-, 42 Divisionsartillerie- und mehreren in der Zahl
wechselnden Gebirgsartillerieregimentern. Außerdem gab es noch 6
Festungsartillerieregimenter und 3 selbständige Festungsartilleriebataillone.
Von den technischen Truppen seien nur die im Weltkriege hervorragend
bewährten 15 Pionier- und Sappeurbataillone, das
Eisenbahn- und Telegrafenregiment genannt. Der Gesamtstand der gemeinsamen
k. u. k. Armee betrug 1892 103 100 Mann. Die
Korpseinteilung blieb dieselbe wie 1859. Sie wurde lediglich nach der Annexion
Bosniens durch die Errichtung eines 15. Korpskommandos in Sarajewo und
ein gleiches besonderes Kommando für Dalmatien erhöht. An der
Spitze der österreichischen Landwehr stand das Landwehroberkommando
in Wien, das dem Landesverteidigungsministerium unterstellt wurde. In Budapest
bildete das Honvedministerium und Honvedoberkommando die oberste
Landwehrbehörde. Höchste Instanz des gemeinsamen Heeres blieb
das Wiener Kriegsministerium.
Der wehrpflichtige österreichisch-ungarische Staatsbürger wurde
nach dem neuen Wehrgesetz erst 3, dann 2 Jahre zur Dienstleistung bei der Fahne
herangezogen. Nach Ablauf der aktiven Dienstzeit stand er erst 7, dann
später 10 Jahre in der Reserve. Wehrpflichtige, die auf Grund besonderer
Bestimmungen für einzelne Berufszweige oder Mindertauglichkeit vom
aktiven Dienst freigingen, gehörten der sogenannten Ersatzreserve an.
Für die Landwehr bestand eine Präsenzpflicht von 2 Jahren.
Außerdem gehörten ihrem Ergänzungsstand sämtliche
Reservisten des gemeinsamen Heeres für 2 Jahre an, deren
zehnjährige Wehrpflicht abgelaufen war. Auch die Reservisten der
Landwehr blieben durch 10 Jahre im Wehrpflichtverhältnis zum stehenden
Heere. Neu war die Einführung des Landsturmes in beiden
Reichshälften, "durch ein entsprechendes in beiden Reichshälften
1886 beschlossenes Gesetz".
Landsturmpflichtig waren alle wehrfähigen Staatsbürger vom 19. bis
zum 42. Lebensjahre, die in keinem Dienstpflichtverhältnis zum
gemeinsamen Heere oder den Landwehren standen. (Sämtliche Angaben
nach G. Nitsche.) Für Tirol, Vorarlberg und Kärnten bestand
außerdem noch die Wehrverpflichtung aller wehrfähigen
Stand- (vom Schießstand) schützen, die im Alter vom
16. bis zum 55. Lebensjahre in die Stammrollen der Schießstände
eingetragen und die ebenfalls, wie die Land- [262] stürmer, nicht zu
Dienstleistungen bei anderen Truppenkörpern bestimmt waren. Gerade der
österreichische und ungarische Landsturm sollte sich im Weltkriege
hervorragend bewähren. Zur Ergänzung der Abgänge bei der
im Felde stehenden Armee eingesetzt, haben die Landstürmer des
Volksheeres nicht allein bei Heeres- und Landwehrverbänden, sondern vor
allem als selbständige Bataillone, bei denen sich durch die Heraufsetzung
des Landsturmpflichtalters während des Weltkrieges oft
46- und 50jährige Männer befanden, ganze Frontabschnitte
heldenmütig gehalten und sind während der Offensiven mit
vormarschiert. Ostgalizien, die Bukowina, die Karpaten, Tirol, Kärnten, der
Isonzo, Siebenbürgen, Bosnien und Süddalmatien, auf allen diesen
Kriegsschauplätzen hat sich der Landsturm ebenso verblutet wie die
Verbände der Landwehren und des gemeinsamen Heeres.
Inmitten der sich von Jahr zu Jahr steigernden innerpolitischen Wirrnisse hatte das
Heer somit den allein schon organisatorisch an jedermann höchste
Anforderungen stellenden Übergang vom "stehenden" Heere zur
Völkerarmee zu vollziehen. Daß es seiner inneren Haltung nach trotz
der Schaffung dreier getrennter Wehrmachtskörper, von denen einer als
Zugeständnis an die Gegner des Staatsgedankens zu betrachten und ein
zweiter einem politischen wie militärischen Gegengewicht gleichkam, jetzt
noch keine Zersetzungserscheinungen aufwies, sprach für die schier
unerschöpfliche Kraft des seinem Soldatentum innewohnenden Geistes.
Nicht zu Unrecht haben viele der besten österreichischen Soldaten die
Armee der Jahrzehnte von 1866 bis 1914 als die "große Schweigerin"
bezeichnet. Diese Schweigerin war sie wirklich. Nicht allein deshalb, weil es nicht
Soldatenart war, über die Unsumme an harter aufopfernder Arbeit viel
Aufhebens zu machen, die angewandt werden mußte, um Soldaten von 12
Nationen, die sich zu mehr als wie einem halben Dutzend Religionen bekannten
und ebenso viele verschiedene Schriften wie Schriftzeichen schrieben, zu
Waffenträgern eines Staates zu erziehen, sondern die Armee glich auch
einer Schweigerin in ihrer Unnahbarkeit gegenüber den Versuchen, sie in
den Strudel des innerpolitischen Kampfes hineinzuziehen. Nur in einem hat die
Armee zu Unrecht und in der Sorge, durch zu scharfes Vorprellen die politische
Situation noch zu erschweren, zwar nicht immer geschwiegen, aber sich doch viel
zu oft schweigend beschieden. In der Duldung all der Abstreichungen durch die
heeresfeindlichen Etatsausschüsse, die eine volle Ausschöpfung der
österreichisch-ungarischen Wehrkraft verhinderten. Zu spät und
unter ungeheuren Blutopfern mußten die Völker dann während
des Weltkrieges dieses Sichbescheiden bezahlen.
Dieser Geist jedoch, der die Armee unbeschadet aller politischen
Ein- [263-266=Illustrationen] [267] wirkungsversuche
und trotz der Schaffung der Honved als
national-ungarischer Landwehr in unerschütterlicher Festigkeit noch
weiterhin zusammenhielt, schöpfte seine Kraft aus drei bedeutungsvollen
Faktoren. Aus der großen Tradition, dem Offizierkorps und der
Persönlichkeit des Monarchen. Alle drei Faktoren bildeten eine
unlösbare Einheit. Dies erschien wohl im Hinblick auf die Waffentaten der
Armee und ihr Offizierskorps als eine Selbstverständlichkeit. Dafür
waren aber verschiedene habsburgische Fürsten durchaus nicht das tragende
Symbol für die Unerschütterlichkeit des Heeres gegenüber
äußeren Einwirkungen gewesen. Man erinnere sich dabei bloß
der Absplitterung magyarischer Kontingente zur Regierungszeit des
unfähigen Ferdinand. Um so bedeutungsvoller prägte jedoch Franz
Joseph, von dessen unermüdlichen Einsatz um die Armee bereits einmal
gesprochen wurde, dem Heere in allen seinen drei Wehrmachtskörpern den
Stempel seiner Persönlichkeit auf. "Die Offiziere sollten sich nicht als
Deutsche, Ungarn, Polen, Tschechen, sondern schlechthin als kaiserlich
fühlen und so die Wehrmacht gesund und frei von nationalem Zwiespalt
erhalten. Als bloßes Symbol konnte das Wort kaiserlich in der Zeit des
nörgelnden Liberalismus nicht zünden, es mußte eine greifbar
gefüllte, überlegene Persönlichkeit dahinterstehen. Dies war der Soldatenkaiser Franz Joseph I. Jung in den Wirren der Revolutionsjahre
auf den Thron gelangt, erlebte er Österreich im Lager der Wehrmacht,
bewies beim Eindringen in die Stadt Raab den persönlichen Mut des
Offiziers und nahm von da ab bis in sein Greisenalter die Überzeugung mit,
daß ohne eine gesunde Armee und einen soldatischen, von Härte und
unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckenden Willen
Österreich nicht zu regieren sei. Als Feldherr hatte er kein Glück,
aber sein militärisches Urteil war klar und sicher. Wenn Österreich
Großmacht und die deutsch kommandierte Armee das kaiserliche
Instrument blieb, das treu und schweigsam der völkischen und
parteipolitischen Zersetzung trotzte, dann war sein Anteil daran groß."
(G. Nitsche.)
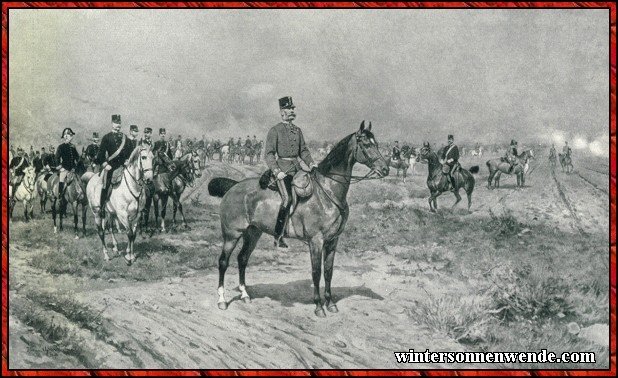
[265]
Kaiser Franz Josef I. bei den Manövern
1890.
Nach einem Gemälde von Thadeus Ajdukiewicz.
(Österreichische Lichtbildstelle, Wien)
|
Franz Joseph warf auch oft genug das ganze Gewicht seiner eigenen
Persönlichkeit, nicht nur als Oberbefehlshaber über Heer und Flotte,
sondern als Monarch in aller Öffentlichkeit in die Waagschale politischer
Entscheidungen, die sich mit dem Aufbau des Heeres befaßten. Dies kam
besonders in seiner Haltung gegenüber den Volksvertretungen zum
Ausdruck, die, in beschämender Abhängigkeit von den billigen
Einflüssen eines jüdisch verseuchten Sozialismus und Liberalismus,
dem Staat gegenüber ihre "Gewichtigkeit" eines Einspruchsrechts gegen
den "militaristischen" Heeresetat in Anwendung brachten. Gemeinsam mit
Tschechen, Polen und Italienern versündigten sich zuletzt auch die
Abgeord- [268] neten der deutschen
Linken durch ihre Streichungs"erfolge" am Heeresetat am höchsten Gut
ihres Volkes, nämlich am Leben der deutschen Soldaten, die dann im Jahre
1914 infolge der unzureichenden Heeresstärke auch in erster Linie
verbluten mußten. Dabei erbrachte die Armee gerade während
großer innerpolitischer Spannungen den Beweis, wie sehr die Heeresreform
und der Einsatz der in der allgemeinen Wehrpflicht zum Ausdruck gebrachten
militärischen Kraft das Ansehen
Österreich-Ungarns wieder nach außen hin stärkte. Einmal
warf die neue Armee schon 1869 einen blutigen Aufstand in Süddalmatien
nieder. Im Jahre 1878 aber besetzte Feldzeugmeister Freiherr von Philippovich in
einem äußerst schwierigen und dabei doch glänzend
geführten Feldzug Bosnien und die Herzegowina und verankerte damit die
Macht Österreich-Ungarns im Sinne des Berliner Kongresses auf dem
Balkan. Als dann 1882 in Bosnien nochmals ein Aufstand ausbrach, wurde auch
dieser tatkräftig niedergeschlagen. Die beiden Reichslande erholten sich
rasch unter einer geschickt arbeitenden Militärverwaltung und erbrachten in
den sich rasch bewährenden bosnischen Soldaten wiederum den Beweis,
daß es dem Heer sehr bald gelang, was die politischen Parteien niemals
zustande brachten: den Ausgleich der nationalen Strömungen in der harten
Zucht des Soldatenstandes.

[264]
Besetzung Bosniens und der Herzegowina 1878. Gefecht bei
Jajce.
Nach einem Gemälde im Wiener Heeresmuseum.
(Österreichische Lichtbildstelle, Wien)
|
Der Kampf der Staatsführung und der verantwortlichen
Wehrmachtsministers mit den Vertretungen der Nationen, zu denen sich mit den
Jahren auch die parteipolitisch gebundenen Interessenten hinzugesellten, belastete
die erweiterte Durchführung der Heeresergänzung der Armee jedoch
derart, daß er "Erfolge" zeitigte, die erst immer einen
verhängnisvollen Stillstand aufzeigten, später sogar
"Rückschritten" gleichkamen. "In
Österreich-Ungarn aber war es 1888 nach Ablauf der 20jährigen
Gültigkeit des Wehrgesetzes nicht möglich, der Volksvertretung trotz
der erheblich gestiegenen Bevölkerungszahl ein höheres
Retrutenkontingent als 1868 abzuringen. Die einzige Verbesserung bestand darin,
daß man aus dem beibehaltenen Kriegsstande von 800 000 das
Rekrutenkontingent nach anderen Methoden errechnete und auf 103 100
Mann kam - gegen 1868 ein Plus von nur 8100 Mann. Ein kleiner
Lichtblick war das Wachsen der Landwehr, deren Rekrutenkontingent 1908 in
Cisleithanien, das erst so zögernd vorgegangen war, auf 19 240
Mann kam, in Transleithanien bei 12 500 Mann blieb." (G. Nitsche.)
Die Wehrvorlage des Jahres 1903 forderte eine Zahl von 125 000 Rekruten
von den Volksvertretungen bei den Reichshälften. Das
österreichische Parlament bewilligte sie dieses Mal, dafür
gebärdete sich die magyarische Opposition als Stoßtruppe ihrer
Regierung derartig über diese neue Belastung, daß das Verhalten des
ungarischen [269] Parlaments offenem
Landesverrat gleichkam. Zweimal versagte der Ungarische Reichstag die Stellung
von Rekruten für das gemeinsame Heer. Die Antwort Franz Josephs war
erstens ein denkwürdiger Armeebefehl, in welchem er in klaren und
scharfen Worten den Versuch, die Einheitlichkeit des Heeres anzutasten,
brandmarkte, und als zweites ließ er die ungarische Volksvertretung durch
ein rumänisches Bataillon der "ungarischen" Landwehr
auseinandersprengen. Das weitere Verharren in der Opposition gegen die
Rekrutenvorlage, das die ungarische Volksvertretung nach dem
Wiederzusammentritt des Parlaments an den Tag legte, zeichnete nur die eigene
Blindheit der Magyaren. In einer Zeit, da sie sich durch ihre
Entnationalisierungs- und Wirtschaftspolitik alle Völker im Umkreise zum
Feinde machten, wanden sie dem einzigen Kameraden, der stets auch ihre Sache
zu vertreten gewillt war, die Waffe aus der Hand.

|
Inzwischen hatte die Armee durch einen neuen Generalstabschef, Franz Freiherrn
Conrad von Hötzendorf, nicht minder aber in dem seit dem Tode Kronprinz
Rudolfs zur Thronfolge bestimmten Generalinspekteur der gesamten bewaffneten
Macht, Erzherzog Franz Ferdinand, zwei Männer an ihre Spitze gestellt
erhalten, die sowohl im Hinblick auf ihre Führereigenschaften als auch
durch ihre außerordentliche Tatkraft die einzigen Persönlichkeiten
waren, die die Härte besaßen, die Sache des Heeres gegebenenfalls
auch ohne Sanktion durch die Volksvertretungen zum notwendigen Erfolge zu
führen. Als im Jahre 1907 die Forderung Conrads nach
212 000 - für die Durchführung neuer Reformen,
besonders bei der Artillerie und den technischen
Truppen - notwendiger Rekruten mit der Genehmigung von nur
191 000 Mann beantwortet wurde, ließ sich der Generalstabschef
nicht abschrecken, sondern arbeitete unbeirrt nochmals, und nun nicht mehr mit
der bescheidenen Fassung der Wehrvorlage von 1907, ein völlig neues
Wehrgesetz aus. Als er dieses 1912 einbrachte, betrug das Rekrutenkontingent
(nach dem Stande von 1910) bei 50 Millionen Einwohnern 126 000
Köpfe. Im Jahre 1870, also 40 Jahre vorher, hatte es bei 36 Millionen
Einwohnern 100 000 Mann betragen. Demnach war, dank der in erster
Linie von den Magyaren geführten parlamentarischen Obstruktion, der
Hundertsatz der Wehrerfassung von 0,28 auf 0,25 vier Jahre vor dem Ausbruch
des Weltkrieges gefallen. Da gelang es Conrad tatsächlich, das neue
Wehrgesetz durchzudrücken. Obgleich sich im ungarischen Parlament
Szenen abspielten, die den greisen Kaiser Franz Joseph veranlaßten, mit
seinem sofortigen Rücktritt zu
drohen - was den Magyaren übrigens die äußerst
unsympathische großkroatische Gegenkonstellation unter der Herrschaft
Franz Ferdinands eingebracht hätte -, vermochte [270] der königstreue
Stephan Tisza auch in Budapest das neue Wehrgesetz durchzubringen. Damit
erhöhte sich das Rekrutenkontingent endlich auf rund 220 000 Mann,
und zwar 159 000 Mann für das Heer einschließlich der Flotte,
28 000 Mann für die österreichische, 25 000 Mann
für die ungarische Landwehr und 7500 Mann für Bosnien und die
Herzegowina. Durch eine weitere Wehrgesetznovelle vom Jahre 1914 sollte das
jährliche Rekrutenkontingent bis zum Jahre 1918 mit einer Aushebung von
rund 253 000 Mann eine neuerliche Erhöhung erfahren. Doch da rief
der Mord von Sarajevo die Völker
Österreich-Ungarns in ihrer breiten Masse zum ersten Male zur blutigen
Bewährung unter die Fahnen. Wenngleich auch
Österreich-Ungarns genialer Generalstabschef alles nur erdenklich
mögliche darangesetzt hatte, um die Wehrmacht auf einen Stand zu
bringen, die den Anforderungen eines modernen Krieges sowohl nach ihrer
Stärke als auch nach ihrer Ausbildung, Bewaffnung und technischen
Ausrüstung entsprach, so hatte jener schon zur tragischen
Überlieferung in der österreichischen Wehrgeschichte gewordene
Mangel an Mitteln eine dem Gegner ebenbürtige allgemeine Bewaffnung
unmöglich gemacht und vor allem die Aufstellung einer genügenden
Anzahl von Reserveverbänden ausgeschlossen. So bestanden die
Infanteriekompanien, als die Mobilmachung angeordnet wurde, nur zu einem
Viertel aus aktiv dienenden Mannschaften. Diese Kompanien mußten
deshalb nicht allein durch Reservisten und Landstürmer
kriegsmäßig aufgefüllt werden, sondern sie erhielten ihre
Ergänzung vor allem noch durch Mannschaften der Ersatzreserve, die nur
eine achtwöchige Ausbildung erhalten hatten. Reservekorps oder
Reservedivisionen wie im Altreiche gab es überhaupt nicht. Die
Ergänzung der im Felde stehenden Verbände wurde durch
"Marsch"-Formationen bewerkstelligt, die, aus Landstürmern,
Ersatzreservisten und neueingezogenen Mannschaften bestehend, nach einer
kurzen Ausbildung dieser Mannschaften zur Auffüllung der
Feldtruppenverbände "auf den Marsch" gebracht oder, wenn es nötig
war, auch ohne Geschütze und Maschinengewehrabteilungen als
selbständige Marschbrigaden bzw. Bataillone in die Front geworfen
wurden. "Die Zeit von zwei Jahren, von 1912 bis zum Kriegsausbruch, war eben
zu kurz, der Bedarf an Mannschaften für dringende Neuaufstellungen an
Batterien, Maschinengewehr- und technischen Abteilungen und Sonstigem zu
groß, um der Infanterie, dem Stiefkind, helfen zu können. Dem
theoretischen Grundsatz, daß die Wehrmacht nie stark genug sein, nie
genug voll ausgebildete Reserven haben könne, war also bei uns
gewiß nicht entsprochen," (C. v. Bardolff.) Nur die
Feldartillerie erhielt noch rechtzeitig moderne Kanonen. Die Haubitzen aber,
vielen Kriegsteilnehmern aus dem Altreich sicherlich noch [271] durch ihr
altertümliches Rückwärtsrollen in Erinnerung, konnten erst
während des Weltkrieges durch modernere Typen ersetzt werden.
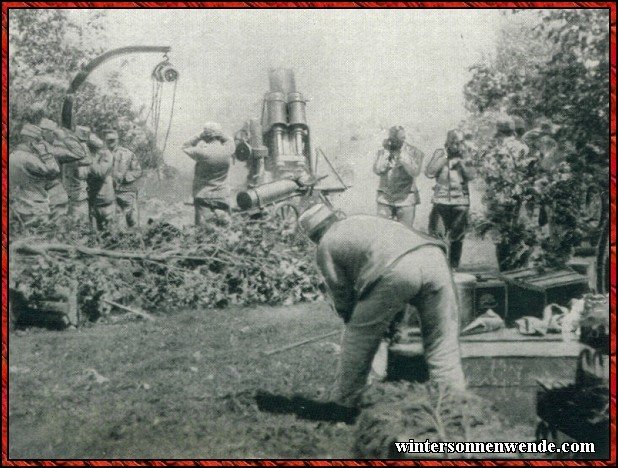
[283]
Abfeuern eines Motormörsers.
(Scherls Bilderdienst, Berlin)
|
Die berühmten österreichischen
30,5-Motor-Mörser hatte der Reichskriegsminister Auffenberg ohne
Wissen des Etatsausschusses anfertigen lassen und war darüber beinahe
gestolpert. Die 24 Geschütze dieses Kalibers, die
Österreich-Ungarn zu Kriegsbeginn besaß, hätten jedoch
niemals für die Erfordernisse der Front ausgereicht. Die Infanteriedivision
aber war mit 13 Bataillonen und 44 Geschützen jeder ihr
gegenübertretenden feindlichen Division sowohl mit der Anzahl ihrer
Bataillone als auch an Geschützen
(6 - 20 Rohre) unterlegen. Ihre Stärke beruhte allein im
vorzüglichen Geiste der in den
Juli- und Augusttagen 1914 ins Feld rückenden Mannschaften. Denn
solange die aus aktiv dienenden Soldaten, Reservisten, Landstürmern und
Ersatzreservisten bestehenden Verbände, deren Mannschaften alle noch
durch die Friedensschule der Armee gegangen waren, in der Hand des aktiven
Offizierskorps vor den Feind traten, bewiesen auch die später so
unzuverlässigen nordslawischen Verbände eine hervorragende
Haltung. Es schien fast, als zollten selbst die Staatsgegner unter den
Völkern der großen Erzieherin all dieser Nationalitäten der
Armee durch diesen tapferen Einsatz einen längst geschuldeten Dank. Dem
unabwendbaren Untergang geweiht, sollte sie wenigstens im stolzen
Bewußtsein einer erfüllten Aufgabe und als Vorbild einer
unvergeßlichen Überlieferung die Flagge streichen.
Als gemeinsames Heer mit den Landwehren von 12 Millionen Deutschen, 10
Millionen Magyaren, 8,4 Millionen Tschechen und Slowaken, 5 Millionen
Polen, nicht ganz 4 Millionen Ruthenen, 5,5 Millionen Serben und Kroaten, 1,3
Millionen Slowenen, 3,2 Millionen Rumänen und 0,8 Millionen Italienern
und Ladinern hat diese Armee im Geschützdonner der ersten Schlachttage
des Jahres 1914 ein Erbe in den Kampf getragen, das zerbrach, wo es Symbol
einer für Habsburg zum Einsatz gebrachten Macht war, das aber nicht
unterging, wo sein deutscher Kern wieder zu jenen Aufgaben zurückfand,
die Prinz Eugen dem Heere der Ostmark gestellt hatte.
|