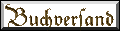|
 Campo Formio und Lunéville [Scriptorium merkt an: 1797 bzw. 1801] Der Reichsdeputationshauptschluß Der französisch-preußische Zusatzvertrag vom 5. August 1796 war ein wichtiger Markstein zur Erfüllung der französischen Absichten, aber auch nur das. Denn erstens standen die Österreicher und meisten Reichsdeutschen noch im Felde. Zweitens wollten die Franzosen mit den Preußen nicht nur Frieden, sondern auch ihre Hilfe haben. Um die habsburgische Macht dauernd lahmzulegen, waren sie bereit, den Norden gegen den Süden auszuspielen, die preußische Vorherrschaft in Norddeutschland zu stärken und durch Nährung des preußisch-österreichischen Gegensatzes ganz Norddeutschland dem Kaiserhause zu entfremden. Soweit ließ sich aber der Berliner Hof nicht locken. Zeitweise dachte er sogar an Rückkehr ins franzosenfeindliche Lager. Die Pariser Parteikämpfe ließen ihm noch leise Hoffnungen auf seinen alten linksrheinischen Besitz. War doch das französische Friedensbedürfnis so groß, daß sich das Direktorium spaltete und seine gemäßigten Mitglieder nachgeben wollten! Selbst die oberitalienischen Siege Bonapartes raubten noch nicht jede Aussicht. Er war bis Leoben vorgerückt, wußte aber nicht, ob er sich mit seinem kleinen Heere so tief im Feindeslande halten könnte. Da wollte er vermeiden, daß aus dem Siegestaumel in Paris Friedensansprüche erwuchsen, die Österreich aufs Äußerste reizten und alle Gewinne gefährdeten. Dann wäre er in Paris nicht mehr als der Friedensbringer und der lorbeergeschmückte General erschienen. So bewilligte er dem Gegner den verhältnismäßig billigen Präliminarfrieden von Leoben (18. April 1797). Das Hauptgewicht legte er auf Italien. Er wollte nicht die Österreicher von dort ganz vertreiben, hätte sie gern durch wertvolle Zugeständnisse in Venetien mit den zugemuteten Opfern ausgesöhnt. Auch weiter westlich in der venetianischen Lombardei [54] behaupteten die Österreicher eine ansehnliche Stellung. Nur sollte Bonapartes militärische und politische Lage, welche seine blutigen Siege begründet hatten, unangreifbar werden. Frankreich mußte Piemont und den größten Teil der Lombardei unbedingt beherrschen, mit seinen dortigen Truppen in gesicherter Verbindung bleiben, jederzeit neue Soldaten dorthin werfen können; die Alpen durften ihm nicht mehr Grenze sein, sondern ganz gehören. Außerdem brauchte Bonaparte die Apenninenpässe, um Mittelitalien in der Hand zu halten. Durch den Gewinn von Reggio und Modena schnitt er Österreich von den direkten Straßen aus Verona nach Florenz und Pisa ab. Gegenüber den italienischen Sorgen kümmerten ihn die deutschen Dinge wenig. Er verlangte nur Belgien, dieses allerdings restlos. Die Verhandlungen des vereinbarten Reichsfriedenskongresses hätten von Napoleon aus "auf der Grundlage der Unversehrtheit des deutschen Reichs" stattfinden können. Indessen hatten die Unterhändler von Leoben weder von Wien noch von Paris aus genügende Vollmachten besessen. Die Stützen des Friedens waren zwar die starke Kampfesmüdigkeit der Truppen und das Ruheverlangen weiter Volkskreise, namentlich der französischen. Doch als Bonaparte sein Heer aus den drohenden Schwierigkeiten befreit und sich persönlich in Paris zur Geltung gebracht hatte, interessierte er sich nur noch wenig für sein eigenes Friedenswerk. Dem Direktorium schrieb er, daß es die Bedingungen beliebig ändern, das linke Rheinufer und die päpstlichen Legationen immer noch fordern könne. Auch er selbst führte die einzelnen Bestimmungen ganz willkürlich aus. In Wien herrschte sowieso starkes Mißvergnügen über das Abkommen. Sobald Bonapartes Überschreitungen bekannt wurden und dieser gar sich weigerte, den Frieden endgültig zu besiegeln, sondern statt dessen sachlich neue Vorschläge machte, kam das Faß zum Überlaufen. Der österreichische Minister Thugut wollte den Kampf nicht planmäßig wieder aufnehmen, sondern erwartete vom Siege der Gemäßigten bei den französischen Wahlen günstigere Bedingungen. Doch verharrte Bonaparte jetzt zähe auf der Etsch in Italien, dem Rheine in Deutschland als Grenze. [55] Jede österreichische Erfolgsaussicht schwand, seit in Frankreich die gemäßigten Direktoren durch eine einheitliche, kampfbereite Regierung abgelöst wurden. Der neue Friede von Campo Formio (18. Oktober 1797) unterschied sich wesentlich von seinem Vorgänger. Nicht mehr der Oglio, sondern die Etsch bildete die österreichische Grenze, abgesehen von einem kleinen rechtsuferigen Vorfeld bei Verona. Das zisalpinische Staatswesen, tatsächlich eine französische Tochtergründung, wurde von Österreich anerkannt und sehr erweitert. In Geheimartikeln wurden auch die deutschen Fragen geregelt. Von der Schweiz bis zur Nette bei Andernach einschließlich des Brückenkopfs Mannheim und der Festung Mainz lief künftig die Grenze am Rheine; nur unterhalb Andernach ließ Frankreich den Deutschen einen schmalen Streifen auf dem linken Ufer. Österreich bekam zum Ersatz das Erzbistum Salzburg und das bayrische Innviertel, entschädigte sich also gerade wie vorher Preußen auf deutsche Kosten. Die Franzosen hatten in Campo Formio fast alles erreicht, was seine Schriftsteller im 18. Jahrhundert immer wieder gefordert hatten. Aber seit Richelieu und Mazarin war es den Franzosen niemals um abgeschlossene Eroberungen zu tun gewesen. Frankreich brauchte zur sicheren Vorherrschaft im Abendlande den maßgebenden Einfluß auf die Deutschen und auf einen großen Teil ihrer materiellen Kräfte. Mazarin hatte deshalb den Elsaß gefordert, nicht obgleich, sondern weil er ein wichtiges deutsches Kulturgebiet war. Ludwig XIV. hatte nicht bloß eine bessere Abrundung seines Staates angestrebt, sondern ins Herz des Reiches eindringen, womöglich gar die Kaiserkrone gewinnen oder von sich abhängig machen wollen. Unter seinem Nachfolger hatte sich dieses Ziel um so deutlicher offenbart, je weniger er unmittelbare Eroberungen dauernd ins Auge fassen konnte. Ganz im Sinne des alten Frankreich betrachtete die junge Republik den Rhein nicht als endlich erreichte Scheidewand der Völker, sondern als Brücke zur stärkeren französischen Geltung auf dem rechten Ufer. Die neuen Vorteile bildeten ein Mittel, um die deutschen Angelegenheiten besser nach französischen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. [56] Seit den Römerzeiten hatte der Rhein die Uferbewohner nicht getrennt, sondern verbunden. Von Basel bis zur holländischen Grenze besaßen die meisten Stromstaaten Bezirke und Rechte auf beiden Seiten. Kaum ein größeres westdeutsches Fürstentum blieb durch den französischen Erwerb unberührt; er wirkte durch die Ausdehnung Preußens, durch die Verbindung von Pfalz und Bayern, von Kurköln und Westfalen, durch den Verlust des habsburgischen Besitzes in Belgien bis tief ins innere Deutschland. Sollten die geschmälerten Reichsstände entschädigt werden, so wollten sich die Franzosen nicht mit einer stummen Zuschauerrolle begnügen, sondern alle Schritte vorher genehmigt haben, sich also in eine deutsche Sache einmischen. Es ließ sich nicht erwarten, daß sie ihres Amtes als unbefangene, uneigennützige Schiedsrichter walten würden. Sie wünschten nach ihrem Interesse die einzelnen Fürsten zu begünstigen oder zu benachteiligen und beim Wettbewerb Ansprüche zu stellen. Einen Vorgeschmack enthielt der Friede von Campo Formio selbst. Den Ausdehnungsgelüsten des Wiener Hofes war zuzutrauen, daß er für die jetzigen Verluste anderweit, vielleicht im Orient Ersatz suchte. Deshalb machte Bonaparte aus, daß das französisch-österreichische Kräfteverhältnis nicht verschoben werden dürfte, daß also Eroberungen des einen Staates den anderen zu neuen Forderungen ermächtigten. Dabei war der Vertrag von Campo Formio nicht einmal ein rücksichtsloser Gewaltfrieden. Schon wegen der Fortdauer des englisch-französischen Krieges hatte Bonaparte Sonderwünsche Österreichs erfüllen helfen, ihm nur sowieso verlorene Bezirke endgültig abgenommen und den Gegner noch großmütig entschädigt. Aber der Vertrag barg ungeschriebene Zukunftsaussichten. Viele Bedingungen waren mehr angedeutet als ausgeführt und ließen keine lange Friedensdauer erwarten. Hiervon waren im Grunde Bonaparte wie Österreich überzeugt. Jener hatte deshalb seinen politischen und strategischen Aufmarsch zum nächsten Kriege vorzubereiten gesucht. Darauf waren die italienischen, aber auch die deutschen Bestimmungen zugeschnitten. Denn falls die linksrheinischen Reichsstände entschädigt werden sollten, wurde der Kaiser durch die Säkularisationen seiner treuesten Gefolgschaft beraubt, sah sich nicht [57] mehr einer zuverlässigen Mehrheit der mittleren und kleineren Landesobrigkeiten, sondern einer geringeren Zahl selbstbewußter mächtigerer Fürsten gegenüber und setzte auf dem Regensburger Reichstag nicht mehr so bequem seinen Willen durch. Die französische Regierung faßte denn auch den Rastatter Kongreß, welcher nach der Verabredung von Campo Formio den Reichsfrieden und die Entschädigung der am linken Rheinufer begüterten Fürsten bringen sollte, als Kriegsvorbereitung auf. Zunächst nahm sie schon im voraus das gesamte linke Rheinufer, auch nördlich der Nette, ein und richtete es für Angriffs- und Verteidigungsbedürfnisse her. Dann spielte sie Österreich und Preußen gegeneinander aus. Beide durften nicht zu mächtig werden, sich namentlich nicht nach Süddeutschland ausdehnen. Der Kaiser schielte ja noch immer auf Bayern; Hardenberg wollte den preußisch gewordenen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth die wertvollen fränkischen Bistümer und Nürnberg angliedern. Diese Pläne ließen sich gleichzeitig durchkreuzen und zur Vermehrung des Mißtrauens zwischen den deutschen Großmächten ausnützen. Das übrige Deutschland wurde teils eingeschüchtert, teils aufgehetzt. Offen und schroff beharrte die französische Regierung auf dem linken Rheinufer und erstickte dadurch jede Widerstandslust im ersten Keime. Daneben wurde versucht, Süddeutschland zu revolutionieren und hier einen von Paris abhängigen Tochterstaat zu gründen, ähnlich wie die zisalpinische Republik in Oberitalien oder die batavische in Holland. Die österreichischen Staatsmänner durchschauten die französischen Absichten. Sie wollten auf alle deutschen Eroberungspläne verzichten, wenn dies auch Preußen tun würde; freilich hofften sie wohl auf italienischen Machtzuwachs. Wie um preußische, bemühte sich der Wiener Hof auch um russische Hilfe. In Italien brach 1799 der Krieg wieder aus, nachdem er schon das ganze vorige Jahr gedroht hatte, sprengte bald den Rastatter Kongreß und führte auch nördlich der Alpen zu neuen Feindseligkeiten. Zwar hielt sich Preußen fern; doch der Regensburger Reichstag hatte seit 1792 formell überhaupt noch nicht wieder mit Frankreich Frieden geschlossen und bewilligte auf Österreichs Verlangen sofort Gelder und Truppen für den bevorstehenden Kampf. [58] Anfangs lächelte das Glück den Österreichern und Russen. Doch wiederum verdarb innere Uneinigkeit die Sache der Franzosenfeinde, während Bonaparte nach seiner Rückkehr aus Ägypten rasch die ganzen Kräfte der Nation zusammenraffte. Er schlug in Oberitalien, Moreau in Deutschland die Österreicher vernichtend. Ihre Kronländer standen der französischen Willkür offen. Der Friede von Lunéville (9. Februar 1801) erneuerte den österreichischen Verzicht auf Belgien, setzte abermals die Etsch als Grenze, überließ Venedig, Istrien und Dalmatien großmütig den Besiegten. Aber in Einzelheiten traten die französischen Absichten offener und entschiedener zutage. Napoleon schloß den Frieden nicht mehr bloß mit dem Herrn der österreichischen Hausstaaten, sondern mit dem Reichsoberhaupt. Dazu war Kaiser Franz vom Regensburger Reichstag nicht ermächtigt. Wenn er, von Napoleon gezwungen, seine gesetzlichen Pflichten verletzen mußte, bewies er, daß künftig auch in inneren deutschen Fragen Napoleon maßgebender war. Zudem wurde die französische Rheingrenze und die Entschädigung der betroffenen Reichsfürsten nicht mehr in Geheimartikeln, sondern in den offiziellen Hauptbestimmungen festgesetzt. Damit wurde es offenkundig, daß Kaiser Franz die Rechte und Gebiete des Reiches nicht mehr schützen konnte, sondern über den Kopf der Beteiligten hinweg dem Siegerwillen wich. Sein politisches Ansehen im Reiche und die darauf beruhende Gefolgschaft vieler Landesherren wurden hierdurch erschüttert. An einen neuen Kongreß, bei welchem die Beteiligten gehört worden wären und mit entschieden hätten, wurde nicht mehr gedacht. Die Rastatter Entschädigungsgrundsätze sollten zwar erhalten bleiben; aber tatsächlich bestimmte Frankreich wenn nicht allein doch in wesentlichen Stücken die neue deutsche Staatenkarte. Österreichs Stellung in Süddeutschland wurde noch schwacher. Der Wiener Hof überließ den bisher unmittelbar beherrschten Breisgau dem Herzog von Modena. Die rechtsrheinischen Brückenköpfe Düsseldorf, Ehrenbreitstein, Kastell, Kehl und Breisach versprach Napoleon zwar zu räumen; aber sie durften nicht neu befestigt werden, d. h. sie standen den Franzosen als Einfalltore jederzeit offen. So sicherte der Friede ihnen nicht nur das linke Rheinufer, sondern auch den beherrschenden Einfluß in Süd- und Westdeutschland. [59] Die Folgen der höheren französischen Machtstellung zeigten sich bald. Bayern einigte sich mit Frankreich über den Verlust der linksrheinischen Pfalz, über eine gute Abfindung und über die Bürgschaft für seinen anderen, von den Habsburgern so oft begehrten Besitz. Weitere Verhandlungen zwischen München und Paris sollten den neuen bayrischen Erwerb genau regeln. Ähnlich gab Württemberg seine elsässischen Bezirke her und bedang sich Frankreichs "gute Dienste" zum genügenden Schadenersatz aus. Im Namen Badens sicherte Reitzenstein seinem Herrn die rechtsrheinische Pfalz, zu deren Ausgleich Bayern außer seinen sonstigen Gewinnen noch das Hochstift Augsburg und die Abtei Kempten erhielt. So entstanden an Stelle eines Gewirres größerer, mittlerer und kleinerer Landesobrigkeiten, die aufs Reich angewiesen gewesen und diesem meist Treue bewahrt hatten, die süddeutschen Mittelstaaten, zu stark, um sich in den alten Reichsbau und willig unter Österreichs und Preußens Botmäßigkeit zu fügen, zu schwach, um sich Napoleons Übermacht zu widersetzen. Rasch drängten sich auch andere nach ihrem Beuteanteil. Wie auf einer Börse wurden in Paris die deutschen Gebiete verhandelt. Daß die Franzosen die umstrittenen Bezirke vielfach schlecht kannten und, von unehrlichen Interessenten beraten, den verschiedenen Anwärtern zuwiderlaufende Versprechungen machten, kam der Republik nur zugute. Denn so hielt sie sich die Parteien länger warm, behauptete sich im Glanze als umworbener Schiedsrichter und erpreßte desto erfolgreicher Gegenzugeständnisse. Vor allem nutzte aber die französische Diplomatie den preußischen Länderhunger aus. So lange sie noch mit England im Kriege lag, lockte sie den Berliner Hof durch Hannover. Damit hätte sie König Georg III. dessen Stammland entrissen, Preußen mit England verfeindet und jenes an sich gefesselt. Friedrich Wilhelm III. wollte jedoch Hannover nur im Einvernehmen mit England annehmen, und nachdem Napoleon mit Großbritannien den Frieden von Amiens (1802) abgeschlossen, fiel der ganze Plan. Aber wenn die Franzosen jetzt auch Preußen in Thüringen, Hessen und Westfalen ein Mehrfaches von dem verschafften, was es an Quadratmeilen und Menschen linksrheinisch dahingegeben hatte, zwangen sie ihm [60] schwere moralische Einbußen auf. Was Friedrich der Große im bayrischen Erbfolgekriege klug vermieden hatte, durch offenkundigen Eigennutz die Deutschen abzustoßen, tat der Berliner Hof unter schlimmeren Verhältnissen. Statt bei Napoleons zunehmender Macht Norddeutschland sicherer unter seine Obhut zu bringen, verletzte er diejenigen, welche sich nach einem Führer zur Befriedigung gesamtdeutscher Interessen sehnten. Der Reichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803, welcher die deutschen Gebietsfragen regelte, bestätigte im wesentlichen nur gesetzlich, was in Lunéville und dann in Paris schon entschieden worden war. Die Haupthüter der Reichsverfassung, die geistlichen Fürsten, die kleineren weltlichen Herren, die Reichsstädte, waren fast alle beseitigt. Die übrig gebliebenen deutschen Staaten wurden noch nicht notwendig französische Vasallen, verdankten aber ihr Dasein und ihre Größe meistenteils Napoleon und neigten eher dazu, die Schranken der Reichsverfassung und das Übergewicht der österreichischen Präsidialmacht durch Anlehnung an Napoleon auszugleichen. So lag ihm zwar Deutschland nicht so willig zu Füßen wie Italien, Holland und die Schweiz; aber mitten im Frieden hatte er die französische Machtstellung in Deutschland gewaltiger erweitert als Ludwig XIV. in seinen besten Tagen.
|