
Wien 1683
Wien! - Name und Begriff einer Stadt, deren Geschichte nichts von
Gemütlichkeit, nichts von weinseliger Heurigenstimmung, nur wenig von
der Liebenswürdigkeit einer heute versunkenen Kaiserstadt, aber viel von
Kampf und harter Notzeit berichtet.
Denn was eine in ihrem Kern morsche und auf trügerische
Äußerlichkeiten gestellte Zeit gerade in den Epochen des deutschen
Erwachens nach den Freiheitskriegen dem äußeren Bilde dieser Stadt
andichtete, hat trotz der ihre Schönheit und die angebliche Leichtlebigkeit
ihrer Bewohner besingenden Lieder niemals das wahre Gesicht dieser Stadt
gezeichnet. Das Wien der Walzer, das Wien des glänzenden, die Augen
auswischenden Parketts ist nicht das Wien der deutschen Geschichte der Wiener
und auch nicht das Wien, dem bitterste Notzeiten im härtesten Gegensatz
zum angeblichen Frohsinn seiner Bewohner so oft tiefe und
unauslöschliche Runen eingeprägt haben.
Wer Wien nur als die Stadt der Lieder, als den Ort die Sinne betörender und
berauschender Feste und herrlicher Bauten besingt, der vergißt, daß es
das gleiche Wien ist, dessen Boden zur Zeit, als ein Strauß und Lanner die
Welt mit ihren unsterblichen Klängen bezwangen, das Blut seiner
deutschen Söhne trank, die fremde Soldaten [24] des österreichischen Staates vor ihre
Gewehrläufe brachten. Und wer, nicht bloß gefangen von den Zeugen
einer gewiß stolzen und für den Ablauf der deutschen Geschichte bis
zur Erfüllung der deutschen Sehnsucht durch Adolf Hitler vom Lauf der
Zeit bedingten Kaiserzeit, das Gesicht jenes Wien betrachtet, das sich in den
Arbeitsstätten und im Bilde des Alltagsdaseins abzeichnet, der erkennt, wie
groß die Kluft ist, die das deutsche Volk Wiens von jenen
Verkündern eines sich nicht auf den Kern seines deutschen Wesens
besinnenden Wienertums trennt, die ein Teil einer auf Ablenkung hinwirkenden
sogenannten führenden Schicht dieser Stadt vor und nach dem Weltkrieg
beschert hat.
Wiens Wesen und sein Volk waren und sind nie anders als deutsch. Und als
deutsche Stadt hat Wien seine Berufung als Hauptstadt der Ostmark empfangen.
In Erfüllung dieser Aufgabe hat Wien viel öfters gekämpft und
gelitten, als Lieder gesungen und zu Walzerklängen getanzt. Hell leuchtet
seine Bewährung als Bollwerk deutscher Widerstandskraft aus der
Geschichte ostmarkdeutscher Wehrhaftigkeit bis in unsere Zeit. Schon 1529 hatte
es einmal dem Osmanensturm hartnäckig widerstanden und als sich nun die
in der deutschen Vergangenheit gefährlichste Bedrohung der
abendländischen Kultur im Südosten zusammenballte, tritt nicht
allein das soldatische Wien auf die Wälle der Stadt, sondern das Volk
sammelt sich abwehrbereit auf den Schanzen, und als der Türke dann mit
Tausenden gegen dieses äußerste Bollwerk unseres deutschen
Vaterlandes anrennt, sind es die jungen und alten Männer aller Berufe und
Stände, die neben den Soldaten mit ihren Leibern die Pforte Deutschlands
vor dem Einbruch des Asiatentums retten.
Aber nicht nur der Abwehr des asiatischen Einbruchs gilt dieser Kampf der
deutschen Stadt. Unselig, stets im Bunde mit den Mächten, die die
Vernichtung des abendländischen Kulturlebens planen, wiegelt Frankreich,
vom Machthunger nach deutschen Ländern geplagt, alle dem Deutschtum
feindlichen Mächte gegen die Reichsgewalt auf. Auch Frankreichs
gordischer Knoten, der die Schlinge um den Hals des verhaßten deutschen
Wesens vollends zuziehen soll, wird Anno 1683 durch den Heldenmut der Wiener
zerschlagen. Und aus dieser Bewährung als Bollwerk gegen die Feinde im
Osten und Westen heraus lebt das Wien des Jahres 1683 unsterblich in der
deutschen Soldatengeschichte fort.
Zehn Tage nach der Schlacht von St. Gotthard wurde zu Eisenburg ein
übereilter, das geflossene deutsche Soldatenblut in keiner Weise
sühnender Friede geschlossen. Der Grund hierzu war in der Weigerung des
Befehlshabers des französischen Hilfskorps zu suchen, der die von [25] Montecuccoli geforderte Verfolgung des Feindes
bis zu dessen Vernichtung abgelehnt hatte.
So stand die türkische Übermacht trotz des erhaltenen Schlages noch
immer drohend und die deutsche Ostmark gefährdend im Donauraum da.
Wohl war es das erstemal gelungen, die Türken in offener Feldschlacht zu
schlagen, aber die immer wieder auftretende Uneinigkeit unter den Generalen
ließ die Befürchtung offen, daß dieser Zustand eines Tages die
Ursache für einen nicht allzu teuer erkauften Sieg des Großwesirs
werden konnte. Der Friede, der nun zustande kam, glich eher einer Niederlage als
einem Siege des Kaisers. Die Festungen Neuhäusel und Großwardein
blieben verloren, der Kaiser mußte wieder ein "Ehrengeschenk" von
200 000 Gulden bezahlen, und auch in der siebenbürgischen Frage
blieben den Türken Vorrechte und Lehensansprüche erhalten.
Dafür wurde dem Kaiser gestattet, auf dem Donaustrom eine freie
Handelsschiffahrt zu errichten und - was ebenfalls mangels der Mittel und
der dazugehörigen Waffen nur dem Werte eines Zugeständnisses auf
bloßem Pergament gleichkam - der Kaiser erhielt auch das Recht
einer Schutzmacht der Christenheit im Orient zuerkannt, was bisher lediglich das
Vorrecht Frankreichs gewesen war.
Dieses Frankreich und sein allerchristlichster König waren auch die
Ursache, daß es von kaiserlicher Seite so rasch zur Zustimmung zu dem in
diesem Frieden von Eisenburg gleichzeitig vereinbarten zwanzigjährigen
Waffenstillstand kam. So hob sich im Westen des Reiches doch bereits die
Bedrohung der deutschen Grenze durch den Raubkönig ab. Vorerst galten
die Vorbereitungen Ludwigs allerdings nur dem Angriff auf das spanische
Belgien, die dann in der Folge eine Vereinbarung zwischen dem Kaiser und dem
Franzosenkönig zur spanischen Erbfolge mit sich brachten. Da trat aber die
Gegnerschaft Frankreichs gegen das Reich auch in der Unterstützung aller
derjenigen offen zutage, die eine Stärkung des deutschen Einflusses im
Südostraume mit scheelen Augen sahen. Frankreich schürte in
Ungarn. Dort hatten die Bestimmungen des Friedens von Eisenburg ebenfalls eine
starke Unzufriedenheit mit sich gebracht. Der kroatische Banus Zrinyi und sein
Bruder waren über die Hintansetzung ihrer Verdienste und die sich daraus
ergebende Nichterfüllung ihrer persönlichen Wünsche
aufgebracht, und da sie nun unter den übrigen ungarischen Magnaten auch
Gleichgesinnte fanden, die sogar offen nach der Herrschaft im Lande strebten,
kam es zu einer Verschwörung eines Teiles des Adels, der sich unter
Einbeziehung des Siebenbürgers Franz Rakoczy an den
französischen König wandte und diesem ein Angebot zur Annahme
der Stephanskrone machte. Als die Verschworenen aber auch noch an den [26] Großherrn in Stambul ein Ansuchen um
Unterstützung richteten, wurde dem Kaiser von dem alternden
Köprülü im geheimen von diesen Vorgängen Mitteilung
gemacht, der dadurch auch erfuhr, daß vor allem der französische
Gesandte in Wien bei all diesen Treibereien seine Hände im Spiel gehabt
hatte. Ein furchtbares Strafgericht war die Folge. Die Führer der
Verschwörung wurden verhaftet und ihnen der Prozeß gemacht.
Wie sich jetzt aber auch die Kirche in die Niederschlagung der
Verschwörung mischte und ihr Einfluß in dem Versuch der
Regierung, nun auch Ungarn, so wie einst Böhmen unter
Ferdinand II., zu einer vorrechtslosen Provinz zu machen, deutlich zutage
trat, brach in ganz Ungarn ein erbitterter Aufstand los. Unter der Losung,
für die bedrohte protestantische Lehre kämpfen zu müssen,
stand bald das gesamte kaiserliche Ungarn in Flammen. Vergeblich versuchten die
Generale Leopolds I. den Aufstand niederzuschlagen. Ein
mächtigerer Gegner ließ der habsburgischen Regierung nicht freie
Hand. Denn es war Frankreich, das jetzt wiederum offen gegen das Reich auftrat.
Ludwig XIV. hatte kaum seinen Devolutionskrieg von 1667/68 gegen das
spanische Belgien beendet und darüber wichtige Plätze in Flandern
in seine Hände gebracht, da fiel er schon wieder die Niederlande mit einem
zweiten Raubkriege an. Während in Ungarn noch der Kuruzzenaufstand
tobte, brandete bereits vom Westen her der Franzosensturm gegen die
äußersten Vorwerke des Reiches heran. Nicht nur um die
spanisch-habsburgischen Besitzungen zu halten, sondern weil eine Wegnahme der
Niederlande eine schwere Gefahr für Deutschland bedeutete,
entschloß sich der Kaiser jetzt auch zum Kampfe gegen Frankreich.
Montecuccoli wurde Condé und Turenne entgegengeschickt und nun
standen wieder Kaiserliche und Brandenburger mit Reichstruppen gegen die
Franzosen zusammen. Mit wechselvollem Glück wurde auf beiden Seiten
gekämpft. Montecuccoli schlug auch dieses Mal, zeitweise durch eine
lästige Uneinigkeit der verbündeten Heerführer gehemmt, mit
dem getreuen nun bald achtzigjährigen Spork und dem Herzog Carl von
Lothringen seine Schlachten. Bis es ihm in der Ortenau, nahe dem Rhein endlich
gelang, Turenne zu besiegen. Doch bald darauf legte er den Oberbefehl
endgültig nieder, und während der Herzog von Lothringen nun den
Krieg weiterführte, gewann im Osten wieder eine neue Gefahr drohende
Gewalt. Der Wahlkönig Sobieski von Polen hatte den jungen
Siebenbürgischen Fürsten Tököly nicht nur als
König von Ungarn, sondern auch als kriegführende Macht anerkannt.
Desgleichen wurde Tököly auch von Frankreich als
souveräner Herrscher bestätigt. Aber auch vom Bosporus drohte die
Gefahr. Dort lenkte die Geschichte des Staates seit Köprülüs
Tode ein neuer Mann, der Großwesir [27] Kara Mustapha. Ehrgeizig, gewillt, nach dem
Vorbild des Großen Soliman die Grenzen des türkischen Reiches
wieder bis an die Mauern Wiens vorzutragen, rüstete er alle Kräfte
des Staates zu einem neuen Zug gegen das Abendland. Dieser neuerlichen
Bedrohung suchte der Kaiser nun durch seinen Beitritt zum Frieden von
Nymwegen zu begegnen. Um die reichsgewichtige Festung Philippsburg zu retten,
trat er die Feste Freiburg im Breisgau an Frankreich ab. Darüber erbittert,
verständigte sich jetzt aber der
Große Kurfürst, der
während dieses Krieges die große Schlacht bei Fehrbellin (1675)
gegen die mit den Franzosen verbündeten Schweden geschlagen hatte, mit
Ludwig XIV. und schloß den Frieden von St. Germain, der ihn
in der Folge durch viele Jahre an Frankreich band.
Nun begann ein beispielloses Ringen der Kräfte. Um freie Hand gegen die
sich immer unersättlicher zeigende französische Raublust zu
gewinnen, die in der Einsetzung der berüchtigten Reunionskammern ihren
beredten Ausdruck fand, wurde mit den Ungarn und Siebenbürgen auf dem
Ödenburger Reichstag Frieden gemacht. Ja, auch mit den Türken
selbst versuchte der Kaiser zu einer Erneuerung des zwanzigjährigen
Waffenstillstandes zu gelangen. Aber die Einkreisung Deutschlands war bereits
zwischen Paris und Stambul abgemacht. Bald nachdem die Abgesandten des
Kaiser unverrichteterdinge vom Goldenen Horn zurückkamen, brach
Ludwig XIV. im Elsaß ein und raubte am 30. September 1681
Straßburg. Diese unglückliche Stadt hatte noch kurz zuvor das
kaiserliche Angebot, eine Besatzung von sechstausend Mann in ihre Mauern
aufzunehmen, ausgeschlagen. Nun fiel sie als Beute einer durch keinen
Widerstand aufgehaltenen Macht, während dem Reichsoberhaupt durch das
immer bedrohlichere Auftreten der Türken die Hände gebunden
waren. Schon rief der Pascha von Ofen den wortbrüchigen und bereits
wieder durch französisches Geld bestochenen Tököly
neuerdings zum König von Ungarn aus, schon ließ der Rebell
Geldmünzen, die sein und des Franzosenkönigs Bildnis trugen,
prägen, da entschloß sich der Kaiser endlich nach vielem und
beharrlichen Drängen seiner Ratgeber zum Kampf gegen die
türkische Großmacht.
Leopold war, ganz gegen seine sonstige Art, die sich gerne Entscheidungen, die
von den Waffen ausgetragen werden sollte, entzog, im Widerstand gegen
Frankreich zu einem beharrlichen Sachverwalter des Reichsgedankens geworden.
Er, der seine Jugend im trüben Licht
jesuitisch-spanischer Erziehungsmethoden verbrachte und dem jeder Sinn
für die soldatischen Tugenden mangelte, wurde durch den Machthunger
Frankreichs zwangsläufig zum ersten jener drei habsburgischen Kaiser,
[28] dessen Regierungszeit vom Waffenlärm
eines reichsgeeinten Abwehrwillens gegen die europäischen
Friedensstörer widerhallte. Auch Kaiser Leopold hatte nach dem
Überfall auf Straßburg durchaus erkannt, daß nur ein
einheitlicher, von allen Teilen des Reiches getragener Wille die unausgesetzte
Bedrohung durch Frankreich zu bannen vermochte. Und in diesem Sinne bahnte
auch die Wiener Politik ein großes europäisches Bündnis aller
von Frankreich bedrohten Staaten außerhalb der Reichsgrenzen an. Leopold
wollte sich nicht von dem Gedanken lösen, der eine bewaffnete
Abrechnung mit Frankreich voraussah. Da zwang ihn der Friedensbruch
Tökölys und die ungeschminkte Herausforderung der Türken,
seinen Ratgebern und dem Drängen des Papstes, der einen Kreuzzug gegen
den Halbmond predigte, nachzugeben. Was nun begann, war ein atemberaubendes
Gegenspiel diplomatischer Kräfte. Polen, das ein Spielball in den
Händen über bedeutende Bestechungsgelder verfügender
Gesandten war, wurde in letzter Minute mit einem kleinen Vorsprung vor
Frankreich in der Darreichung von "Handsalben" in der Höhe von
60 000 Gulden für die Idee des abendländischen Feldzuges
gegen die Osmanengefahr gewonnen. Diesen für die kaiserlichen Kassen
ungewöhnlichen Aufwand an Mitteln hatte Wien bedeutenden Subsidien
des Papstes und auch Spaniens, ja selbst Venedigs, Genuas, Florenzs und
Savoyens zu danken. Nun wurde mit der Interessierung der Reichsfürsten
für die Durchführung des Feldzuges begonnen. Bayern, Sachsen, der
schwäbische und fränkische Kreis wurden gewonnen und die
kaiserliche Streitmacht durch die Neuaufstellung von
14 Infanterieregimentern, 8 Kürassier- und
5 Dragonerregimenter, 2 Kroatenregimenter und eines kleinen
Ingenieurkorps auf einen erhöhten Stand gebracht.
Bald zeigte sich auch, wie notwendig die getroffenen Maßnahmen waren.
Kara Mustapha, der durch eine geheime Mitteilung Ludwigs XIV. davon in
Kenntnis gesetzt worden war, daß er von Frankreich keinerlei
Feindseligkeiten zu befürchten habe, vorausgesetzt, daß sein Angriff
nicht auch Venedig und Polen gelten würde, ließ am 2. Januar 1683
die Roßschweife als Zeichen der Kriegserklärung der Pforte an
Österreich auf den Adrianopler Serail ausstecken. Während sich nun
ein gewaltiges Türkenheer durch Serbien nach Ungarn
heranzuwälzen begann, zog sich auch aus dem Reich bereits ein
großer Teil der aufgerufenen Hilfsvölker zur Unterstützung des
Kaisers zusammen. Am 6. Mai 1683 wurde zu Kitsee eine Revue Kaiser Leopolds
abgehalten, wobei der Nachfolger des 1681 verstorbenen Montecuccoli, Herzog
Carl von Lothringen, als "absoluter Comandant der Armee" ungefähr
33 000 Mann dem Kaiser vorführte. Bei der Heerschau
be- [29] fehligte außerdem
noch der Markgraf Ludwig von Baden, dann der Herzog von Lauenburg, die
Generale Graf Leslie, Fürst Croy, Aenaes Caprara, Rabatta und vor allem
auch der baldige Verteidiger Wien, Graf Ernst
Rüdiger von Starhemberg,
als Kommandant von 72 Geschützen.
Außer den deutschen Völkern nahmen aber auch noch
7 - 8000 Ungarn und Husaren an dieser Heerschau teil, die mit ihren
überaus kostbaren Waffen, Kleidungen, Edelsteinen, den gestickten
Pferderüstungen und den über die Schultern gehängten
Tiger- und Bärenfellen allgemeines Staunen hervorriefen. Dieses
Kontingent stellte das vom Ödenburger Reichstag ausgeschriebene und von
dem Teil der königstreuen Ungarn gestellte Korps der magyarischen
"Insurrektion" dar, das dem Ruf des Kaisers gefolgt war.
Inzwischen begann auch der polnische Johann Sobieski ein Heer von rund
26 000 Mann in der Krakauer Gegend zusammenzuziehen. Aber weil mit
dem Eintreffen dieses Verbündeten vor Mitte des Sommers nicht zu
rechnen war, ergab sich für Lothringen die schwierige Aufgabe, mit seinen
bisher versammelten Truppen dem Vormarsch der türkischen
Übermacht zu begegnen. Ein in Kitsee abgehaltener Kriegsrat
beschloß, nicht erst das Eintreffen der noch zu erwartenden übrigen
Hilfstruppen aus dem Reich und der Polen abzuwarten, sondern Lothringen die
Aufgabe zu übertragen, durch einen Angriff auf die Festungen Gran und
Neuhäusel den Gegner nach Möglichkeit noch auf ungarischem
Boden aufzuhalten. Doch Kara Mustapha, der am Tage der Kitseer Heerschau
schon bereits über Belgrad hinausgezogen war, hatte durch die
Verrätereien des vor dem Sultan in Esseg zum König von Ungarn
erhobenen Tököly und durch die Berichte des heimlich in Wien
gewesenen türkischen Oberingenieurs Achmed Bey genaue Kunde von dem
unzureichenden Zustand der Wiener Befestigungsanlagen erhalten. Vom Sultan,
der in Serbien "zur Jagd" zurückgeblieben war, zum "Seraskier" ernannt,
ließ der Großwesir sich bei der Anlage des Feldzugsplanes von
durchaus richtigen strategischen Gesichtspunkten leiten. Ihm lag daran, sich nicht
durch langwierige Belagerungen kaiserlicher fester Plätze wie Komorn,
Raab und Leopoldstadt aufhalten zu lassen, sondern, noch ehe die
Verstärkungen des kaiserlichen Heeres aus Deutschland und Polen
herangerückt waren, seine ganze ungeheure Macht gegen das Herz des
Feindes, Wien, zu entfalten. Mit rund zweihunderttausend Kämpfern,
denen noch tausende als Troß beigegeben waren, wälzte er sich,
durch seine tartarischen Reiter Verheerung und Vernichtung vor sich hertragend,
unbeirrt gegen Wien heran. So mußte Lothringen notgedrungen die
anbefohlenen und bereits begonnenen Belagerungen von Gran und
Neuhäusel aufgeben. Eilig zog [30] er sich zum Schutze der
niederösterreichischen Grenze zurück und hatte schließlich
Mühe, sich einer Umzingelung zu entwinden, die durch ein von Kara
Mustapha zur Täuschung ausgeführtes Manöver einer
Belagerung von Raab für Lothringen beinahe zum Verhängnis
geworden war. Doch glücklicherweise ließ sich der Großwesir
tatsächlich länger, als er wohl selber beabsichtigt hatte, bei Raab
binden. Durch den Aufenthalt, den die Berennung der kleinen Feste erforderte,
gingen ihm zwei wertvolle Wochen verloren. Diese Zeit genügte, um den
als Verteidiger Wiens bestimmten General Graf Rüdiger von Starhemberg
die Befestigungsanlagen der Stadt in möglichster Eile in einen
verteidigungsmäßigen Zustand bringen zu lassen. Denn hier war
vieles seit langem vernachlässigt.
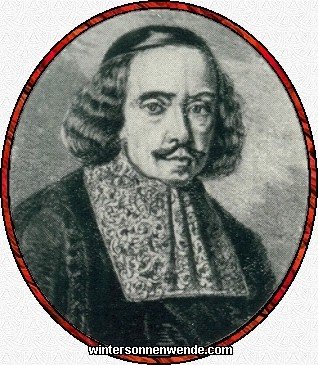
[36]
Koloman von Liebenberg,
Bürgermeister von Wien.
Die bedeutendsten Führer in den Türkenkriegen
Zeitgenössischer Stich.
(Historischer Bilderdienst, Berlin)
|
So ausreichend die Anlagen auf den ersten Blick hin erscheinen mochten, so war
doch seit Jahren nichts für ihre Instandhaltung und ihre Verbesserung
geschehen. Mit Hilfe des berühmten sächsischen Ingenieurs
Johannes Rimpler und des Schlesiers Elias Kühn, unterstützt von
dem deutschesten der Wiener Bürgermeister, Liebenberg, ging nun
Starhemberg daran, in höchster Eile das Notwendigste ausbauen zu lassen.
So wurden von geflüchteten Bauern 30 000 Palisaden errichtet,
verfallene Häuser niedergerissen und aus ihren Steinen neue Steinwerke
aufgeführt. Bauern, Bürger, Handwerker, Liebenberg an der Spitze,
führten frische Erdwälle auf, Geschützstände wurden
angelegt, und als mit Hilfe der beschlagnahmten Pferde endlich über
dreihundert Geschütze auf den Wällen aufgefahren waren, konnte
Starhemberg wirklich auf ein Werk blicken, das dank seiner eigenen Tatkraft, vor
allem aber durch den bewiesenen Opfermut des Volkes die Möglichkeit
bot, einer längeren Belagerung standzuhalten.
Die Gefahr dieser Belagerung zeichnete sich bereits mit all ihren Schrecken aus
der Nähe der in Flammen aufgehenden niederösterreichischen
Landschaft ab. Am 7. Juli war es bei Petronell zu einem unglücklichen
Gefecht der Kavallerie Lothringens mit den Vortruppen Kara Mustaphas
gekommen. Bei diesem Kampf war auch der ältere Bruder Prinz Eugens
von Savoyen, der selbst erst mit dem späteren Entsatzheer nach
Österreich kam, der Obrist Ludwig von Savoyen auf dem Felde der Ehre
geblieben. Dieser Sieg, den Kara Mustapha weit über die Bedeutung des
Reitertreffens aufzubauschen verstand, gab ihm den willkommenen Vorwand,
nunmehr endgültig die Belagerung von Raab aufzuheben und zur
Verfolgung des geschlagenen Feindes gegen Wien aufzubrechen. Raubend und
plündernd zog er unter Zurücklassung eines nur kleinen
Belagerungskorps von Raab gegen die Donaustadt ab. Auch der Kaiser hatte
bereits am 7. Juli Wien mit [31] seiner Familie in Richtung Linz und Passau
verlassen. Da warf Lothringen noch in letzter Minute 10 000 Mann,
größtenteils Kürassiere und Dragoner, in die bedrohte Stadt.
Und nun vermochte das Eintreffen der kaiserlichen Regimenter auch die
gedrückte Stimmung der Bevölkerung zu heben. Hatten doch
Gerüchte bereits von einer völligen Vernichtung des kaiserlichen
Heeres bei Petronell berichtet. Als man nun Lothringens selber gewahr wurde, der
seine Truppen persönlich durch Wien führte, ging es beim Anblick
der wohlerhaltenen Regimenter wie ein Aufatmen durch die geängstigte
Menge. Lothringen setzte dann selber noch über die Donauinsel auf das
jenseitige Ufer des Flusses, brach die Donaubrücke hinter sich ab und blieb
auch weiterhin beinahe während der ganzen Belagerung Wiens zur
Beunruhigung des Feindes auf dem Marchfelde stehen.
Jetzt kam die große Zeit deutscher Bewährung und
unvergänglichen Heldenmutes heran. Die gesamte männliche
Bevölkerung wurde von Starhemberg zu den Waffen gerufen. Acht
Kompanien, ein Fähnlein "ledige Bursche" und die von den Bäckern,
Fleischhauern und Wirten gestellten Freikompanien wurden bewaffnet. Der
Rector magnificus führte als Obrist drei Kompanien studentischer
Jugend und neben den 16 000 Mann kaiserlicher Besatzung, von denen die
Regimenter Starhemberg, Beck, Scharffenberg, Kaiserstein und
Württemberg die berühmtesten waren, wurde die Verteidigung der
Stadt noch drei Kompanien Stadt-Guardia übertragen. An Führern
seien nur Rüdiger Starhemberg, sein Neffe Guido, die Obristen Dupigny,
Ferdinand Karl von Württemberg, Sereni, Börner, Heister und vor
allem der Bürgermeister Liebenberg und auch der streitbare Bischof von
Wiener Neustadt, Kolonitsch, genannt. Den Vorsitz über die
Zivilverwaltung hatte der zweiundsiebzigjährige Feldzeugmeister Graf
Kaspar Capliers übernommen, während sich das Ingenieurwesen
unter der Leitung Rimplers und Kühns sowie des sich während der
späteren Belagerung besonders bewährenden Venetianers Camucci
und den durch die Verteidigung des Burgravelins berühmt gewordenen
kaiserlichen Hauptmann Hafner in besten Händen befand.
Deutsche Männer aus allen Gauen des Reiches erwarteten so den Ansturm
auf die Mauern der ehrwürdigen Stadt. Aber auch Ausländer,
vielfach die besten militärischen Köpfe ihrer Zeit, hatten sich zur
Abwehr der Osmanengefahr in kaiserliche Dienste und somit in die Dienste des
Reiches begeben. Von Stunde zu Stunde wuchs die Gefahr. Sorgenerfüllt,
aber dennoch entschlossen, bis zum letzten zu kämpfen, starrten Tausende
von Augenpaaren täglich, stündlich nach dem Südosten, wo
allnächtlich heller Feuerschein über der nahen Ebene stand. [32] Wien und sein deutsches Volk waren dazu
bereit, für Deutschland in die Bresche zu springen. Ihren blutigsten
Opfergang seit ihrer Gründung erwartete die Hauptstadt der Ostmark.
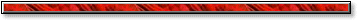
Am 13. Juli 1683 verdunkelten ungeheure Rauchmassen über einem
lodernden Flammenmeer jede Sicht von den Wällen der Stadt. Starhemberg
hat, um dem Feind die Möglichkeit einer gedeckten Annäherung
gegen die Wälle zu nehmen, die Vorstädte im weiten Bogen von
einem Ufer des Donaukanals bis zum anderen in Brand stecken lassen.
Bestürzung, Paniken und Gerüchte durcheilen die mit
Flüchtlingen, Militär und Zurückgebliebenen zum Bersten
vollgestopften Straßen. Schon wollen einige die ersten Heerhaufen auf den
Höhen des Wiener Berges gesehen haben, andere wieder berichten von
grauenhaften Plünderungen vorgepreschter türkischer Reiter in der
St.-Ulrich-Vorstadt, die der noch als letzter auf dem Durchmarsch durch Wien
befindliche Markgraf von Baden mit Savoyendragonern zurückgejagt hat;
kurzum das Stadtkommando hat alle Hände voll zu tun, um zu befehlen, zu
beschwichtigen und, wo es nottut, mit unerbittlicher Schärfe Ordnung zu
machen, damit die Abwicklung des Dienstes an den militärischen Objekten
keine Verzögerung erleidet.
Da meldet der Beobachtungsposten auf dem Stephansturm tatsächlich das
Auftauchen dichter Heeresmassen auf den Höhen des Wiener Berges. Nun
besteht kein Zweifel mehr, Kara Mustaphas Heer ist heran, und während
noch draußen die Vorstädte brennen und ganze
Straßenzüge, Kirchen, Paläste und Klöster in Rauch und
Trümmer versinken, wälzt sich ein endloser Heerwurm von den
Höhen des Wiener Berges herab. Unbekümmert um das
Flammenmeer beginnen die Türken sofort mit der Errichtung eines
ungeheuren Lagers. Tausende arbeiten, während die anderen noch
weitermarschieren, an der Errichtung der Zelte, kleinere Abteilungen wagen sich
trotz des Brandes schon dicht an die Wälle heran und wie nun die ersten
Musketenschüsse von den Basteien erdröhnen, gellt vom
Stephansturm aus das erste Alarmläuten der "Angstern" über die
Gassen der Stadt. Der Türke ist da, nun wehr' dich auf Leben und Tod,
deutsche Wienerstadt!

[18]
Zeitgenössischer Plan der Belagerung
Wiens.
Nach einem Stich von C.
Decker in Amsterdam. (Historischer Bilderdienst, Berlin)
|
Schon am Morgen des 15. Juli donnern zum erstenmal die Geschütze. Mit
unheimlicher Eile hat der Großwesir die ersten Batterien auffahren lassen.
Während der große Sultan 1529 seine hauptsächlichsten
Angriffe gegen den unteren Wienfluß gerichtet hat, läßt die
Ansammlung zahlreicher türkischer Sturmtruppen vor dem Burgravelin
[33] und Schottenbastei auf
eine Konzentrierung seiner Angriffe gegen diese Befestigungen schließen.
Auch Laufgräben legen die Türken unter der sachkundigen Anleitung
eines entsprungenen Kapuzinermönches, ihres berühmtesten
Ingenieurs Achmed Bey und französischer Fachleute an, da gerät aus
unerklärlicher Ursache noch vor dem Beginn des türkischen
Sturmangriffs das große Schottenstift dicht an der Bastei und neben dem
kaiserlichen Waffenarsenal, in dem 18 000 Pulverfässer lagern, in
Brand. Nur das entschlossene Eingreifen des Neffen des Stadtkommandanten, des
Hauptmanns Guido Starhemberg, rettet Wien schon am ersten Tage der
Belagerung vor einer fürchterlichen Gefahr.
Doch nun beginnt der Kampf aufzuleben. Unter der persönlichen Leitung
des Großwesirs rennen der Janitscharenaga und der Pascha von Damaskus
gegen den Burgravelin und die Löbelbastei
an. - Und in den darauffolgenden Tagen werden auch die
Biber- und Gonzagabastei von ihnen berannt. Unaufhörlich führen
hinter den stürmenden Janitscharen die Artilleriemannschaften inzwischen
neue Batteriestände auf. Laufgräben, ein wahres Labyrinth von
Kreuz- und Quergängen werden geschaffen und obwohl der
Großwesir in absichtlichen Täuschungsmanövern versucht,
auch bei Nußdorf und bei Erdberg durch Batterien und Pfahlbrücken
die Aufmerksamkeit der Verteidiger vom Burgravelin anzulenken, gelingt es ihm
nicht, Starhembergs Kräfte zu verzetteln. Der wagt bereits am 19. Juli einen
Ausfall und wirft die in den Laufgräben nahe herangekommenen
Türken blutig in ihre Ausgangsstellungen vor dem Burgravelin
zurück.
Über diese ersten Mißerfolge ergrimmt, überläßt
der Großwesir Wien seinen Batterien. Ein furchtbarer Feuerorkan brandet
über die Bastionen der in sommerlicher Gluthitze daliegenden Stadt.
Geschosse heulen über Bastionen und Wälle, erfüllten die
dahinterliegenden Gassen und Häuser mit Schrecken und mehr und mehr
werden die Verteidiger gezwungen, die am meisten bedrohten Gebäude
räumen zu lassen. Doch Starhemberg weiß überall Rat. Dort,
wo ein türkisches Geschoß ein Haus zum Einsturz gebracht hat,
ordnet er sofort die Fortschaffung des Baumaterials zur Vermauerung
aufgerissener Breschen in den Stadtbefestigungen an. Auch die auf den
Wällen postierte eigene Artillerie läßt er durchaus nicht
erfolglos aufspielen. Im Gegenteil, bald werden die Verteidiger gewahr, daß
die Österreicher, in guter Vorbedeutung späterer Taten, die besseren
Artilleristen haben. Sehr bald muß der Großwesir erkennen, daß
er mit seinen auch hier wieder von französischen Ingenieuren geleiteten
Batterien gegen den Stückobristen Christian von Börner und den
Obristleutnant Gschwind von Pöckstein nicht aufkommen kann. Darum
läßt er um so eifriger Minenstollen und [34] Laufgräben

[36]
Graf Rüdiger von Starhemberg,
Stadtkommandant von Wien.
Die bedeutendsten Führer in den Türkenkriegen
Zeitgenössischer Stich.
(Historischer Bilderdienst, Berlin)
|
graben. Wohl wehren die Verteidiger diese unterirdischen
Wühlmäuse mit Musketenfeuer und Handgranaten ab, aber sie
können es doch nicht verhindern, daß sich bald vor und vielleicht
schon unterhalb der äußersten Befestigungslinien ein unheimliches
Gewirr von Stollen und Gräben hinzieht. Dennoch vermag auch dieses
Heranwühlen der Türken nicht ihre Zuversicht vermindern. Als Kara
Mustapha am 20. Juli nach vorhergegangenen mörderischen Feuer einen
Waffenstillstand zur Beerdigung der Toten verlangt, läßt ihm
Starhemberg kaltschnäuzig sagen: "Man habe lauter gesunde Leute in der
Stadt und daher keine Toten zu begraben, sollte nur redlich fechten, seiner Seite
wolle man sich bis auf den letzten Blutstropfen defendieren!"
Doch Kara Mustapha wartet nicht mit der Rache. Am Abend des 23. Juli
erschüttert eine fürchterliche Detonation den Westteil der Stadt. Die
Janitscharen haben an der Kontereskarpe der
Löbel- und Burgbastei zwei Minen auffliegen lassen und nun stürzen
Gemäuer, Erde, Palisadenpfähle und Eisen auf die Besatzung herab.
Mit Musketen, Piken, ja mit Sensen werfen sich die halbverschütteten
Verteidiger den sofort anstürmenden Janitscharen entgegen und
während jetzt in den Trümmern, zwischen hochziehenden
Rauchschwaden und brennendem Schanzwerk die Verletzten schreien und
wimmern, spielt sich im knietiefen Schutt und über aufgebrochenen
Mauerbreschen ein fürchterliches Würgen von Mann zu Mann ab.
Mit brennenden Pechkränzen, Piken, Säbeln und Dolchen kommen
die Janitscharen durch die vom Pulverrauch überzogenen Breschen
gesprungen, heiseres Allahgeschrei erfüllt die Luft, schon scheint es, als
würde sich die hereinflutende Welle über die Kontereskarpe
ergießen, da stemmen sich die vom Regiment Starhemberg mit ihren
Leibern zwischen die Breschen und halten, wo die Waffe nicht ausreicht, mit
Palisadenstücken, Steinen und Fäusten durch Stunden hindurch drei
nacheinander vorbrechende türkische Anstürme auf.

[35]
Ein Sturmangriff von Janitscharen und türkischen
Hilfstruppen auf die Burgbastei wird von Studenten und Handwerkern abgeschlagen.
Sturm der Janitscharen auf die Burgbastei.
(Historia-Photo, Berlin)
|
Als der Morgen graut ist die Kraft des feindlichen Angriffs gebrochen, aber
für die Verteidiger gibt es kein Ausruhen; sofort beginnen sie, die
entstandenen Breschen im schärfsten feindlichen Feuer neuerdings
zuzumauern.
Diese erste Minensprengung bringt aber für die Besatzung eine neue
Aufgabe mit sich. Um der Gefahr neuen Stollenvortreibens entgegenwirken zu
können, muß Starhemberg
darangehen, selber ein Minenkorps auf die
Beine zu bringen. In Wien anwesende Lothringer und Niederländer bieten
sich für diese Aufgabe an. Doch Starhemberg erkennt bald, daß hier
der schon erwähnte Venetianer Camucci der richtige Mann am Platze ist.
Zusammen mit dem Hauptmann Hafner der Stadtguardia legt er verschiedentlich
Gegenminen an. Um das dafür
erfor- [35-36=Illustrationen] [37] derliche
Material zu erhalten und die Verwendung des
kostbaren Schießpulvers zu ersparen, wird eine eigene Pulverstampfe
angelegt, und so gelingt es Hafner auch wirklich, am 2. August durch eine
großangelegte Sprengung die Stollenarbeiten des Gegners an der Burgbastei
erheblich zu stören. Wie rund zweihundertfünfunddreißig
Jahre später ihre Nachkommen am Col di Lana, Cimone und Monte
Pasubio lernen die kaiserlichen Soldaten jetzt Tag um Tag und Nacht um Nacht
all das nervenzerrüttende Abhorchen, Ablauern und Abriegeln des
Unterhöhltwerdens kennen. Tag für Tag donnern an den Bastionen
die Minen, schauerlich erhellen die Brände die kampfdurchtosten Stunden
der Nacht. Fieberhaft wird in den Gewölben, in Kellern und in alten
unterirdischen Gängen unter den Bastionen gearbeitet. Gegenstollen
entstehen, und wenn einmal die Gegner in einem der aufeinanderstoßenden
Minengänge plötzlich aufeinanderprallen, entspinnt sich in der Tiefe
der Erde ein fürchterlicher, grausamer Kampf. Dabei rennt der Türke
oben vor den Bastionen immer wieder hartnäckig an. Schon hat er sich in
seinen Laufgräben, die mit Bohlen, Sandsäcken und
hochgeschichteter Erde gegen das Feuer von den Wällen geschützt
sind, so nahe herangearbeitet, daß sich die Janitscharen auch während
der Kampfpausen dicht an den bedrohten Werken aufhalten können. Dabei
läßt auch das "erschröckliche und grausame Schießen"
seiner Batterien keinen Augenblick nach. Längst bestehen die Bastionen
des Burgravelins und der Löbelbastei nur mehr aus rauchenden,
zerborstenen Trümmern. Da setzt der Großwesir am 3. August zu
einem wütenden Generalsturm an. Stundenlang brüllt die ganze
Feuerfront seiner Batterien, viermal holen sich die Janitscharen vor der
Löbelbastei und dem Burgravelin blutige Köpfe, doch endlich, erst
nachdem Starhemberg sein bedrohtes Geschütz vom Cavalier der
Löbelbastei zurückziehen muß, gelingt es dem Gegner, in
einen vorspringenden Winkel des Grabens am Burgravelin einzudringen. Und auch
hier ist es wieder das Regiment Starhemberg, das sich mit einem Heldenmut
ohnegleichen wehrt. Aber die Besatzung ist an dieser Stelle schon sehr zu einem
kleinen Häuflein zusammengeschmolzen. Dennoch weicht sie nicht von
dem übrigen Teil des Burgravelins. Acht Tage hält sie dort noch mit
unerschütterlicher Standhaftigkeit aus. Und wie der Gegner am 12. August
durch eine neue gewaltige Mine den Burgravelin fast völlig zerstört,
bleiben die Letzten trotzdem noch auf einem Rest von Trümmern und
Schutthaufen stehen und beginnen nun durch die Errichtung von Palisaden und
Wehren das noch in ihrem Besitz verbleibende Stück des Ravelins gegen
den türkischen Gegner abzuriegeln. Erst nach neunundzwanzig Tagen
läßt Starhemberg die völlig vernichteten Außenwerke,
Glacis [38] und Kontereskarpe am
Burgravelin räumen, aber der in Schutt geschossene "Zauberhaufen", wie
die Janitscharen den Ravelin nennen, bleibt zu mehr als zwei Dritteln nach wie
vor in der Gewalt der Verteidiger.
Dafür meldet sich jetzt im Innern der belagerten Stadt ein neuer, um so
gefährlicherer Gegner. Während sich draußen vor den
Wällen die Leichen der gefallenen Türken zu Tausenden
häufen und ein durch die Sommerwärme ekelerregender
Leichengeruch für die Janitscharen in den Laufgräben eine
schreckliche Belastung bedeutet, beginnen auch im Innern der Stadt Krankheiten,
Not und Teuerung umzugehen. Außerdem fängt die Ruhr verheerend
unter der Besatzung und Bürgerschaft zu wüten an. Auch
Starhemberg wirft sie aufs Krankenlager, und nun kann dieser Mann nur mit
Aufbietung aller Kräfte seinen Pflichten als Stadtkommandant
genügen. Mit eiserner Energie bannt er das furchtbare Fieber, und weil er
sich nicht auf den Füßen halten kann, läßt er sich an die
bedrohten Punkte tragen. Unermüdlich ist er mit Anweisungen, Befehlen
und Ratschlägen tätig. Aber wenn es not tut, versteht er es auch mit
beinahe grausamer Härte zu strafen. Selber schon einmal verwundet, ist er
trotz seiner Krankheit allen ein leuchtendes Vorbild. Kein Tag vergeht, ohne
daß er nicht die Inspizierung auf allen Wällen vornimmt, und so ist es
in erster Linie sein persönliches Beispiel, das manchen, der da und dort
schon langsam zu verzagen beginnt, wieder zum Mutfassen zwingt.
Da überbringt der geheime Bote von Starhembergs bedeutendstem
Kampfgefährten, dem klugen und umsichtigen Kaplirs, der Kaufmann
Franz Georg Kolschitzky, am 17. August die Nachricht, der Herzog von
Lothringen habe Tököly bei Preßburg geschlagen, und in der
Gegend von Krems würde sich ein gewaltiges Entsatzheer sammeln.
Diese Kunde vermag den Widerstandswillen aller mit neuer Kraft zu entfachen.
Unermüdlich wird in den Stunden, da der Türkensturm aussetzt, an
der Ausbesserung der Werke gearbeitet. So läßt Starhemberg neue
Flankenbatterien errichten; Öl, Pech und die neuen Kielmannseggschen
Handgranaten werden an die gefährdeten Punkte gebracht, auch
Ausfälle werden wieder gewagt, und wie der Türke nun, um die
Aufmerksamkeit der Verteidiger von dem Burgravelin und der Löbelbastei
abzuwenden, einen unerwarteten Sturm auf das Neutor vollführt, werfen
ihn die dort postierten Studenten im erbitterten Handgemenge zurück.
Um so wütender beginnen die Türken jetzt wieder gegen das letzte
Stück des noch besetzten Burgravelins vorzudringen. Am 16. August
gelingt es ihnen, auf der eroberten Kontereskarpe eine Breschbatterie [39] aufzuführen. Nun
schlägt Kartätsche um Kartätsche in die verzweifelt
ausharrende Besatzung, die die letzten Meter des Zauberhaufens verteidigt. Schon
längst haben dort andere Regimenter an Stelle der "Starhemberger" die
Verteidigung übernommen. Wieder läßt Mine um Mine diesen
letzten Rest der Trümmer zerbersten, und wie dann die Janitscharen am 23.
August nochmals mit erdrückender Übermacht stürmen,
brechen sie endlich in das letzte Verteidigungsnest der Besatzung ein.
Da versucht Starhemberg am 1. September durch einen großangelegten
Ausfall den Druck auf die Besatzung des Burgravelins zu mindern. Aber obgleich
es gelingt, dem Gegner bedeutende Verluste beizubringen, zeitigt der Ausfall
für die kleine Schar auf dem Ravelin doch keinen Erfolg. Fünfzig
Mann unter dem Hauptmann Heisterberg stehen noch dort. Wie nun die
Türken wider das noch von den Tapferen gehaltene Eck
vorzustürmen beginnen, spielt sich dort im Schutt ein Heldenkampf ab, der
sich für alle Zeiten als leuchtendes Beispiel deutscher Soldatentugend
erhebt. Mann gegen Mann beginnen diese letzten fünfzig mit den
Janitscharen zu ringen. Noch Stunden vorher war es dem Kommandanten von
Starhemberg freigestellt worden, diesen letzten Trümmerhaufen zu
räumen. Doch Heisterberg hat das kopfschüttelnd abgelehnt, und nun
hält er mit beispiellosem Opfermut stand, bis Mann um Mann seiner
kleinen Besatzung dem Würgen und Niederringen erliegt. Doch noch
immer nicht vermag der Türke den Roßschweif über die
Leichenberge zu pflanzen. Im letzten Augenblick kommt der Hauptmann
Müller mit einer neuen Schar herangestürmt, und erst als auch dieser
Offizier mit gespaltenem Schädel zu Boden sinkt, gelingt es den
Türken, die noch zuletzt herbeigeeilte Verstärkung zu bezwingen.
Aber auch jetzt wollen die wenigen Überlebenden, die buchstäblich
nur mehr an den Steinblöcken kleben, den Burgravelin nicht preisgeben. Da
ruft sie ein Befehl Starhembergs, der auf seiner Tragbahre sitzend dem Kampfe
von der Burgbastei zusieht, schließlich zurück. Und während
diese Tapferen sich Schritt für Schritt aus den qualmenden Schuttresten
lösen, steigt der Roßschweif siegreich über dem Feld der Toten
auf. Nach dreiundzwanzig Stürmen hat Kara Mustapha den Besitz des
Burgravelins mit Strömen von Blut erkauft.
Dieser Fall des Burgravelins scheint der Anfang eines unabwendbaren Endes. Mit
neuentfachter, immer hartnäckiger und verbissener wirkender Gewalt
fährt der Türke fort, die Bastionen der Stadt zu berennen. Die
Hissung des Feldzeichens hat plötzlich wieder den schon gesunkenen Mut
der Janitscharen gehoben. Denn bei den Türken war es verschiedentlich
schon zu schweren Meutereien gekommen. Nach den
Satzung- [40] gen des Korans und
altem Kriegsbrauch war es den Janitscharen verboten, länger als vierzig
Tage vor ein und derselben Festung zu liegen. Doch nun hat der endlich
erfochtene Vorteil die Kampflust im gesamten Türkenlager gehoben. Der
endliche Sieg und die Aussicht auf eine unermeßliche Beute treibt die
Stürmer zu neuen, wilden Angriffen an. Schon am 4. September rennen
viertausend Mann neuerdings gegen die Burgbastei an, und plötzlich
erschüttert eine gewaltige Detonation beinahe die ganze Stadt. Eine Mine
hat eine zehn Meter breite Bresche in die Bastionen geschlagen. Wenige Minuten
später stürmen, klettern und springen die Janitscharen unter einem
tausendstimmigen Triumphgeschrei mit geschwungenem Säbel und
über den Rücken gehängtem Sandsäcken über die
Trümmer hinauf. Schon vermögen sie hier und dort einen
Roßschweif auf die Wehren zu pflanzen, da ist Starhemberg wieder und
diesmal mit allen seinen Generalen heran. Zum hundertstenmal entrollt sich auf
den Bastionen das gleiche blutige Bild. Wieder beginnt der gleiche
zermürbende Kampf von Mann gegen Mann, wieder steht eine Handvoll
Verteidiger gegen die Übermacht auf. Und auch dieses Mal ist bei den
Verteidigern endlich nach stundenlangem Nahkampf der Sieg. Fünfhundert
Türken sinken tot in die Trümmer zurück, und als sich endlich
die Nacht über den blutigen Kampfplatz senkt, können die
Verteidiger mit dem Vermauern der aufgerissenen Bresche beginnen.
Doch wie am 6. September die bisher gewaltigste Mine zwölf Meter breit
die Löbelbastei und Escarpe-Mauer gesprengt und nach stundenlangem
Ringen, währenddessen wieder zwei Halbmondfahnen auf den Basteien
wehen, 1500 Gefallene den zäh verteidigten Kampfraum bedecken, da
steigt auch in Wien die Not am höchsten. Unablässig zischen in der
darauffolgenden Nacht die Raketen von der Spitze des Stephansturmes auf.
Hunderte von Augen starren sorgend nach den dunklen Hohenzügen des
Kahlenberges hinüber. Seit Anfang September ist Kolschitzkys treuer
Diener Michaelowicz auf seinem letzten Kundschaftergange verschollen und
niemand weiß, ob und wann das Ersatzheer nun wirklich heranzieht. Die
Nachricht, die Kolschitzky selbst seinerzeit brachte, hat sich als trügerisch
erwiesen und niemand weiß, ob nicht vielleicht neu aufgetretene
Schwierigkeiten die dringend nötige Hilfe hinausziehen. Dabei brennen im
weiten Umkreis tausende und abermals tausende von türkischen
Lagerfeuern. Auch in dieser Nacht ist, wie in jeder dieser vorhergegangenen
fünfundfünfzig kämpfe- und schreckendurchtosten
Nächte, vor den Bastionen das Wühlen, Brechen und Schaufeln der
türkischen Mineure zu hören, langgezogen und schaurig dringt der
Gesang der Mullahs, der mohammedanischen Priester von den
Lager- [41] feuern herüber
und fängt sich im unheilverkündeten Echo in den zerschossenen
Bastionen der Stadt. Und die Männer, die auf diesen Bastionen wachen,
Posten stehen und nach dem Graben und Schaufeln zu ihren Füßen
hinablauschen, sind selbst bald am Ende ihrer Kraft. Es ist nicht der Hunger, auch
sind es nicht die Seuchen oder der Mangel an Kriegsmaterial, der ihren Mut von
Tag zu Tag mehr auf die härtesten Proben stellt. Die Reihen beginnen sich
von Stunde zu Stunde in erschreckendem Maße zu lichten.
Fünftausend Soldaten und sechzehnhundertfünfzig Männer
aus der Bürgerschaft haben der Kampf und die Krankheiten bisher gekostet.
Schon steht beinahe kein Kanonier mehr an den Geschützen. Statt der
geübten Artilleristen müssen die Büchsenmacher der
Zünfte die Geschütze bedienen und sichten. Um die
allergrößten Verluste auszugleichen, hat Starhemberg jetzt auch
Männer, die niemals Waffen getragen haben, ja selbst Mönche auf
die Wälle beordert, und was sie alle am schwersten ertragen, die Seele, der
gute Geist des Widerstandes der Bürgerschaft, Liebenberg liegt auf den Tod
erkrankt.
Da steigt plötzlich eine Rakete, knatternd, einen weithin sichtbaren
Lichtschweif hinter sich hertragend, über den Kahlenberghöhen
empor. Und gleich darauf jagt eine zweite ebenso leuchtend mit fernem Gezische
durch das Dunkel der Nacht. Noch eine dritte und vierte wird sprühend in
die Höhe getragen, und wie dann noch eine fünfte auffährt und
langsam in einem glühenden Feuerkranze zerplatzt, da beginnt auf einmal
die große Angstern vom Stephansdom anzuschlagen. Erst hallen ihre
Schläge zögernd und langsam, doch allmählich erklingen sie
schneller und gewinnen an Kraft, und wie in das Schwingen der Glocke schon das
Rufen, Schreien und Fragen der zusammenlaufenden Menge aus den Gassen zum
Turme hinauftönt, löst sich auch von der
Burg- bis zur Schottenbastei eine dröhnende Salve; jubelnd hallt der
Glockenton mit dem Donnern der Geschütze zusammen, und nun
durchbraust ein tausendstimmiger Aufschrei die dunkle Septembernacht:
Das Entsatzheer ist da - Wien wird befreit!
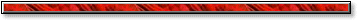
"O ihr Ungläubigen, wenn ihr nicht selbst kommen wollt, so laßt uns
wenigstens eine Mütze sehen; dann hat die Belagerung ein Ende, und wir
laufen alle davon!" So und ähnlich sollen die Janitscharen gerufen haben,
als sich die Kunde vom Nahen des deutschen und polnischen Entsatzheeres in
ihren Reihen verbreitete. Und dieser Ausruf schien wirklich treffend, die
üble Stimmung im türkischen Lager
wieder- [42] zugeben. Denn, wie
bereits angedeutet, stand bei dem Heere Kara Mustaphas schon lange nicht alles
zum besten. Das fortwährende, hartnäckige und furchtbare
Blutverluste fordernde Anrennen gegen die Stadt hatte Kara Mustapha schon bis
Mitte August 11 000 Mann allein an Toten gekostet. Dazu waren noch rund
10 000 Mann an Verwundeten und Kranken gekommen. Was aber vor
allem die Mißstimmung unter den Stürmenden wachhielt und von
Tag zu Tag steigerte, war die sich verschiedentlich wiederholende Weigerung Starhembergs,
den Türken Waffenruhe zur Beerdigung ihrer gefallenen
Krieger zu geben. Der Zwang, zwischen den die Laufgräben verpestenden
Leichen Tag und Nacht auszuharren und immer wieder über sie
hinwegstürmen zu müssen, hatte die Moral des türkischen
Fußvolks immer heftiger erschüttert. Freilich wurde darüber
auch die Wut gegenüber den Verteidigern um vieles gesteigert. Aber als
jeder Stein, jeder Meter der zäh verteidigten Bastionen mit neuen schweren
Opfern erkauft werden mußte, war es zeitweilig zu ernsthaften Meutereien
gekommen. Und als die türkischen Truppen gewahr wurden, daß,
statt des nun endlich in sichtbare Nähe gerückten Erfolges, ein neuer
schwerer Kampf mit einem mit frischen Kräften anrückenden Gegner
bevorstand, mußten die Befehlshaber des Padischah alle
Überredungskunst und auch verschiedentlich grausame Strenge aufbieten,
um ihre Truppen für die bevorstehende Schlacht kampfwillig zu
stimmen.
Dennoch zeigte sich dann während der Schlacht, daß die
Türken auch dieses Mal wieder mit der alten Tapferkeit zu fechten
verstanden. Auch hatte ein trotz des Herannahens der
deutsch-polnischen Streitmacht mit neuer Verbissenheit vorgetragener Angriff auf
die Stadt, der am 9. September den unteren Teil der Löbelbastei in die
Gewalt der Osmanen gebracht hatte, die Haltung der Truppen gehoben.
Unerklärlich bleibt trotzdem, weshalb Kara Mustapha nicht die
Höhen des Wiener Waldes gegen das herannahende Heer der
Verbündeten sichern ließ. Mußte er doch bei aller
Überlegenheit an zahlenmäßigen Streitkräften mit einem
Gegner rechnen, der ihm aus den während der Belagerungszeit mit den
übrigen Teilen des türkischen Heeres gelieferten Treffen den Beweis
erbracht hatte, daß er mit meisterlicher Geschicklichkeit zu
manövrieren verstand. Nicht umsonst war der Herzog von Lothringen viele
Jahre durch Montecuccolis Schule gegangen. Ausgezeichnet mit allen
Vorzügen eines edlen, ritterlichen, durch und durch deutsch empfindenden
Charakters, der durch die Weigerung, sein Stammland in irgendeiner
Abhängigkeit von Ludwig XIV. zu regieren, für so manchen
anderen deutschen Reichsfürsten ein Vorbild gewesen wäre,
vereinigte Carl von Lothringen auch alle Vorzüge eines klug
abwägenden, [43] dann aber auch
rücksichtslos zuschlagenden Generals. Unaufhörlich hatte er
während der bald zweimonatlichen Belagerung Wiens die übrigen
Streitkräfte des Großwesirs in Unruhe und Spannung gehalten.
Nachdem er erst jenseits der Donau am Bisamberge ein festes Lager bezogen hatte
und noch zweitausendfünfhundert Mann polnischer und kaiserlicher
Regimenter zu ihm gestoßen waren, brach er plötzlich gegen
Tököly vor, der mit 14 000 Ungarn und 6000 Türken
Preßburg belagerte. Am 29. Juli kam es auf den die Stadt umgebenden
Höhen zu einer kurzen erbitterten Schlacht. Der verräterische
Fürst wurde vernichtend geschlagen und konnte sich späterhin nur
mit Hilfe der ihm von Kara Mustapha zur Verstärkung geschickten
zehntausend Mann längs der
niederösterreichisch-ungarischen Grenze halten.
Neueintreffende Nachrichten hatten die Kunde gebracht, daß ein
türkisches Korps versuche, den Übergang über die Donau bei
Tulln zu erzwingen. Schnell war Lothringen heran. Auch hier entspann sich
wieder ein kurzer, erbitterter Kampf, und als die Sonne am Abend des 24. August
über dem majestätischen Strom niedersank, bescheinen ihre letzten
Strahlen eine vernichtende osmanische Niederlage.
Endlich war der Zeitpunkt der letzten Vorbereitung für die große
Entscheidungsschlacht herangekommen. 11 000 Bayern unter Max
Emanuel und dem Generalleutnant Degenfeld waren in Krems eingetroffen. Mit
ihnen zogen 1000 Mann Salzburger, die der Bischof Maximilian Graf Kuntnig
gestellt hatte. 8000 Mann hatte der Reichsfeldmarschall Georg Fürst zu
Waldeck aus Franken und Württemberg gebracht, und mit dem
Kurfürsten Georg III. waren 12 000 Soldaten unter der
Führung des Feldmarschalls Goltz gekommen. Auch die Polen kamen
heran, 27 000 Mann trafen in den ersten Septembertagen mit ihrem
König Johann Sobieski, dem Großfeldherrn der polnischen Krone,
Fürst Jablonowski, dem Unterhetmann der Krone, Sienawski, und dem
Großlagermeister Chalmocki ein. Zusammen mit den kaiserlichen
Regimentern vereinigten sich so 87 000 Mann mit 180 Geschützen
im verbündeten Lager. Doch jetzt zeigte sich, daß man nicht mit der
Eitelkeit des Polenkönigs gerechnet hatte. Statt Lothringen, der als
Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen seine Fähigkeiten in den
schweren Jahren des ungleichen Kampfes gegen den überlegenen Gegner so
oft unter Beweis gestellt hatte, mit der Führung der gesamten
Streitkräfte zu betrauen, wurde diese dem Polenkönig
übertragen. Etiketterücksichten und diplomatische
Erwägungen hatten Kaiser Leopold zu dieser Maßnahme
veranlaßt. Auch hier bewies Lothringen wieder den vornehmen, sich selbst
bescheidenden Charakter. Ohne Widerrede nahm er die Stellung des
untergeordneten Heerführers an, obwohl er sich völlig darüber
im [44] klaren war, daß er
allein während des zu erwartenden großen Kampfes die eigentliche
Verantwortung zu tragen hatte. Er war es dann auch, der den
ursprünglichen Plan des Hofkriegsrates und der anderen, erst nach
Preßburg zu marschieren und dort durch eine Umgehung der
türkischen Belagerungsarmee in den Rücken zu fallen, zu
entkräften verstand und kühn den ungleich schwierigeren Angriff
über das zerklüftete, waldüberzogene Gelände des
Cetischen Gebirges zur Durchführung brachte.
In einem unerhört schwierigen Marsch durch das bedeckte, von
Bachläufen und tief eingeschnittenen Waldschluchten durchschnittene
bergische Gelände führte Lothringen seine und den
überwiegenden Teil der sächsischen Truppen am 11. September von
Tulln aus, wo sich das Heer der Verbündeten zum Aufmarsch gruppiert
hatte, über St. Andrä nach Klosterneuburg heran. Aber mit
noch viel größeren Schwierigkeiten hatten die als Corps de
bataille durch das Waldgebirge anmarschierenden Regimenter des
Kurfürsten von Bayern und Waldecks, denen dreiundzwanzig Schwadronen
der besten kaiserlichen Regimenter unter dem Herzog von
Sachsen-Lauenburg mit den Generalen Dünewald, Rabetta, Palffy, Gondola
und Buttler sowie der übrige Teil der Sachsen beigegeben waren, zu
kämpfen. Nur unter Anspannung aller Kräfte vermochten die
Mannschaften ihre Pferde und Waffen, vor allem aber das schwere
Geschütz, teils über St. Andrä, teils über
Königstetten und das Tal des Tulbinger Baches auf die Höhen des
Gebirges zu bringen. Am schwersten mit den Unbilden des Geländes hatte
jedoch der polnische rechte Flügel zu kämpfen. Denn Sobieski
mußte mit seinen Polen und den ihm zugeteilten vier kaiserlichen
Infanteriebrigaden und 6000 österreichischen Dragonern erst weit nach
Südosten ausbiegen und kam erst, auf der alten Römerstraße
St. Andrä - Gugging - Kierling marschierend,
nur sehr langsam an das ihm gesetzte Marschziel, den Dreimarkstein und die
Sophienalpe, heran.
So vollzog sich während des 11. September 1683 jener denkwürdige
Aufmarsch des großen abendländischen Heeres, der in seiner ganzen
Anlage und Ausführung ein beredtes Zeugnis von der Genialität des
Lothringers gab. Schon am Vormittag dieses Tages war er selbst auf dem
Kahlenberg eingetroffen, und als nach und nach auch die übrigen
Heerführer dort zu einer letzten Besprechung zusammenkamen, zeigte
ihnen Herzog Carl die zu ihren Füßen liegende kämpfende
Stadt.
Als König Johann Sobieski nun dieses Bild tief unten erblickte und man
erst jetzt Truppenverschiebungen bei den Türken beobachten konnte, die
darauf hinwiesen, daß Kara Mustapha doch noch sein Heer in
Schlachtordnung aufzustellen begann, da konnte er es und [45] die ihn umgebenden
Generale einfach nicht fassen, daß der Großwesir nicht daran gedacht
hatte, den Aufmarsch des Entsatzheeres in den Anmarschlinien zu stören.
Mit den Worten "cet homme est mal campé, s'est un ignorant, nous le
batterons!" wandte er sich von dem Bilde ab, und nun begann noch einmal
eine Beratung, die trotz der Vorstellungen des Herzogs von Lothringen den
Beginn des Kampfes erst für den 13. September vorsah. Der Antransport
des schweren Geschützes hatte die Durchführung der gesamten
Aufstellung für den 12. September unmöglich gemacht. Aber da
zwang der sich aus den Höhenstellungen gegen das Wiener Becken
entwickelte Aufmarsch der verbündeten Heere doch schon am 12.
September zur Schlacht.
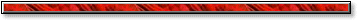
Noch liegt die erste Dämmerung des heraufkommenden Tages über
dem Kahlenberg und den nahen und ferneren Höhen des Wiener Waldes,
als sich schon die Fürsten und Generale des verbündeten Heeres, die
zum Gottesdienst des Asketenmönches Marco d'Aviano in der Kapelle des
Leopoldsberges zusammengekommen waren, in möglichster Eile trennen.
Hat doch noch während des Gottesdienstes plötzlicher
Kampflärm und verschiedentlich auch das Aufdröhnen des
Geschützes von den jenseitigen Hängen des Kahlenberges die Herren
gemahnt, daß die in ihrem Aufstellungsraum einrückenden Truppen
eher, als man erwartet hatte, auf einen Gegner gestoßen sind. Der Gegner
führt seine Heeresmassen bereits in Schlachtordnung heran und versucht
nun scheinbar, die verbündeten Streitkräfte vor Beendigung ihres
Aufmarsches in rasch ernster werdende Kampfhandlungen zu verwickeln,
während an die 30 000 Mann inzwischen mit Nachdruck die
Bastionen der hart bedrängten Stadt weiter bestürmen. Darum
verlangen die Herren jetzt auch voller Unruhe nach ihren Pferden. Und
während König Sobieski und die übrigen
Fürstlichkeiten und Generale mit ihrem Gefolge über die
Hänge des Leopoldberges hinab und auf der anderen Seite zu den
Höhen des Kahlenberges hinaufsprengen, reitet im Gefolge des Markgrafen
Ludwig von Baden auch ein kleiner, schmächtiger Obrist mit, dem Kaiser
Leopold erst vor wenigen Tagen das Dragonerregiment Kuefstein verliehen hat, Prinz
Eugen von Savoyen.
Sich dicht neben dem Markgrafen haltend, gewinnt der jugendliche Obrist jetzt als
einer der ersten den Kamm des Kahlenbergwaldes. Da hält der Markgraf
noch einmal sein Pferd an. Auch der Obrist von Savoyen zügelt seinen
Rappen. Gebannt läßt er den Blick über die sich vor seinen
Augen entwickelnden Streitkräfte schweifen.
[46] "Seine Durchlaucht, der
Generalleutnant von Lothringen, kann sich zu der Ehre
beglückwünschen, daß sein Flügel am heutigen Tage als
erster mit dem Feind aneinander gerät", wendet er sich im höflichen
Französisch an seinen Vetter, den ebenfalls noch jugendlichen, selbst noch
nicht dreißigjährigen Markgrafen. "Doch deucht' es mich, als ob das
stürmische Vordringen der Bataillone des Herzogs von Croy zur Stunde
noch nicht in den Absichten des Generalleutnants läge!"
"Sehr wahr, Prinz! Croy und Caprara greifen viel zu voreilig an und lassen sich
engagieren, ehe die Bayern aus den Wäldern heraus sind", entgegnet der
Markgraf. "Doch kommt, Vetter, ich sehe dort drüben den Generalleutnant
schon selber eiligst zum Herzog von Croy hinabjagen, aber vorher noch eins:
Versprechen wir uns, daß dieser Tag unsere Reiter als erste vor den Toren
der Stadt sieht!"
Da streckt der Obrist von Savoyen seinem nur um wenige Jahre älteren
Vetter schweigend die Hand hin. Gleich darauf zügelt der Obrist von
Savoyen seinen Rappen vor dem Dragonerregiment Kuefstein. Der Markgraf
Ludwig und der General der Kavallerie Graf Caprara aber erhalten schon wenige
Augenblicke später vom Herzog von Lothringen den Befehl, die drei
hintereinanderstehenden Treffen der Dragoner und Kürassiere als
Flankendeckung des linken Flügels längs der Donau nach vorne zu
führen. Und nun trabt auch der Obrist Eugen von Savoyen zum ersten Male
in seiner soldatischen Laufbahn vor der eigenen Truppe als Befehlshaber an.
Jetzt entbrennt auf der gesamten Front die Schlacht. General Prinz Croy hat seine
Regimenter etwas zu früh gegen die über Nacht errichteten Verhaue
des Feindes in den Weinbergen am Schreiberbach vorgehen lassen. So entwickelt
sich hier schon ein erbitterter Kampf, ehe das Zentrum mit den Bayern und einem
Teile der Sachsen eine Rechtsschwenkung durchgeführt hat, die geplant
war, und diese nun über den Hermannskogel und oberhalb Döblings
herabkommen. Auch die Polen am rechten Flügel sind noch lange nicht
über Dornbach und Hütteldorf heran. So versucht nun Lothringen
persönlich, den Fehler Croys durch eine um so kräftigere Bindung
des gegnerischen Flügels wettzumachen und Kara Mustapha durch eine
unausgesetzte Bedrohung des kürzesten Anmarschweges auf Wien vor der
Ausnützung der beiden entstandenen Lücken abzuhalten. Doch es hat
schon jetzt, während des Beginns der Schlacht, den Anschein, als sollte der
Polenkönig mit seinem Urteil über den Großwesir Recht
behalten. Statt die gefährdete Lage des Heeres der Verbündeten zu
erkennen, läßt Kara Mustapha seine Streitkräfte, die er im
Zentrum selber befehligt, in den während der Nacht errichteten
Verteidigungslinien auf halber Höhe der Berghänge halten und weist
[47] auch jetzt noch die
Vorstellungen des Befehlshabers am linken türkischen Flügel,
Ibrahim, überheblich zurück, der in ihn dringt, den vorpreschenden
linken kaiserlichen Flügel in der Flanke zu fassen.
Am heftigsten entbrennt nun der Kampf bei den dreizehn kaiserlichen Bataillonen
des Feldmarschalls Hermann von Baden. Der schließt jetzt mit Croy, Leslie
und Salm als Zentrum des linken Flügels an die längs der Donau
vorreitenden Reitergeschwader an. Den rechten Flügel der Truppen des
Lothringers bildet der größere Teil der Sachsen, die unter dem
Kurfürsten Georg III. und dem Feldmarschall von der Goltz gegen
die türkischen Verhacke in den Hohlwegen oberhalb der zerstörten
Häuser von Heiligenstadt vorrücken. Bald ist dort Freund und Feind
in ein erbittertes Ringen verwickelt. Musketensalven, das Getöse des
Nahkampfes und das anfeuernde Rufen der Befehlshaber hallt aus dem
übersichtlichen Gelände bis zu den Geschützstellungen Leslies
auf den Höhen des Kahlenberges hinauf. Im allzu stürmischen
Vorgehen haben Croys Bataillone die ersten Verhaue des Gegners oberhalb
Nußdorfs genommen. Doch in den Ruinen von Nußdorf hält
der türkische Befehlshaber Kara Muhamed von Diabekir mit asiatischen
Truppen hartnäckig stand. Schritt um Schritt müssen die
Kaiserlichen sich die Ortschaft erkämpfen. Fast um jedes einzelne Haus, ja
um Stuben und Keller wird erbittert gefochten, und weil der Yatagan in den
Händen der behenden Asiaten eine verheerende Waffe ist, kommt das
schwerfällige Fußvolk der Kaiserlichen mit seinen langen Piken nur
wenig gegen die Gegner an. Da läßt der Herzog von Lothringen
Leslie seine leichten Geschütze von Kahlenberg herab bis in die Reihen des
Fußvolkes vorschicken. Und nun jagt Kartätsche um
Kartätsche endlich den Gegner aus der Ortschaft zurück. Doch am
Dorfausgang stellt sich Kara Muhamed wieder, und erst als Croy seine Obristen
und Hauptleute die Kompanien gliederweise mit vollen Fronten formieren
läßt und das von den Türken gefürchtete "Schlagt an!"
des Feuerbefehls für die hinter den Pikenieren vorrückenden
Musketiere erklingt, säubert Salve um Salve schließlich den tapfer
verteidigten Ortsrand.
So kann der Feldmarschall Hermann von Baden dem Lothringer um acht Uhr
morgens die Erstürmung von Nußdorf melden. Auch der
weißhaarige Feldmarschall von der Goltz ist mit seinen Sachsen im
zähen Vorwärtsstürmen bis und durch Heiligenstadt gelangt.
Auch hier haben die bei den Sachsen ebenfalls vorgezogenen kaiserlichen
Geschütze ganze Arbeit getan.
Nun jedoch verzögert eine neue und mit viel Geschick aufgeführte
gewaltige Schanze dicht hinter Nußdorf neuerdings den Vormarsch Croys
und Hermanns von Baden. Voll besetzt mit Verteidigern, die sich
un- [48] aufhörlich noch
weiter durch Zurückflutende und "Zurückbringer" auffüllt,
gebietet sie sowohl den Kaiserlichen als auch den Sachsen in breiter Front
Halt.
Ehrgeizig läßt Croy daraufhin sein österreichisches
Fußvolk vorstürmen. Aber das empfängt, sobald es bis hart an
den Erdwall heran ist, ein solcher Regen von Pfeilen, Kugelgeschossen,
siedendem Pech und geschleuderten Feuerbränden, daß nur wenige
Tollkühne die Schanze erklimmen und der Sturm auch diesmal wieder
erfolglos im Gegenstoß der über den Wall herabstürmenden
Asiaten zerschellt.
Da jagt plötzlich der Herzog von Lothringen zu dem Markgrafen von
Baden hinüber und gibt ihm den Befehl, das Dragonerregiment
Heißler sofort absitzen zu lassen, um den Feldmarschalleutnant von Croy
beim Sturm auf die Schanze zu unterstützen. Markgraf Ludwig von Baden
sprengt zu dem genannten Dragonerregiment herüber. Doch wie er am
Regiment Kuefstein vorbeikommt, verhält er vor dem Obristen von
Savoyen für wenige Sekunden sein Pferd und ruft diesem laut aus dem
Sattel hinüber:
"Wollt hier bis auf weitere Order mit Eurem Regiment dem Grafen Caprara
folgen, mein Prinz. Sollte mich Seine Durchlaucht für die Dauer der
Schlacht anderenorts beordern, bleibt die Parole, die wir versprachen: Unsere
Reiter als erste vor Wien!"
Da reckt der Obrist von Savoyen seine kleine Gestalt hoch in den Bügeln.
Laut und scharf hallt sein Kommando, das dem Regiment den Befehl erteilt,
Capraras Reitergeschwadern zu folgen, noch hinter dem Markgrafen her. Der ist
inzwischen schon an den Obristen Heißler herangesprengt, und gleich
darauf erdröhnt der Boden vom vielhundertfachen Galopp der
Dragoner.
In schärfster Gangart führt der Markgraf Ludwig und der hagere
Oberst Heißler die Reiter nach Nußdorf heran. Wenige Minuten
später ist das Regiment durch die Ortschaft gerast, und sofort
läßt Heißler zwischen den Treffen des Fußvolkes die
Dragoner ein Exerzitium vorführen, das in seiner Exaktheit selbst den
Führern und Mannschaften des zur Seite schwenkenden Fußvolks
Bewunderung abringt. Im Nu sind die Dragoner abgesessen. Die Pferde werden in
drei Gliedern "geküpelt", und dann formiert Eskadron hinter Eskadron die
Mannschaften in drei Gliedern "gestellt zu chargieren"! Die Dragonermusketen
hochgereckt in den Fäusten, marschieren die abgesessenen Reiter im
Sturmmarsch gegen die türkische Schanze heran. Schmetternd geben die
Reiterhörner den Dragonern das Feuersignal. Während die Glieder
abwechselnd ihre rollenden Salven in die Reihen der Schanzenverteidiger jagen,
sprengt auch der Herzog von Lothringen wieder daher, reitet bis dicht an die
Glieder, und als jetzt auch die vordersten Treffen ihre [49] Musketen entladen, gibt
er persönlich den Sturmbefehl. Im nächsten Augenblick berennen die
abgesessenen Reiter die Schanze. Ein neues erbittertes Schlagen beginnt. Endlich
beginnen die ersten Türken zu weichen. Da wogt neben den Dragonern
auch das wieder vorgehende Fußvolk jubelnd über die
Schanzenbrüstung. Nun gibt es bei dem Gegner kein Halten. Siegreich
flattert die Standarte des Dragonerregiments Heißler über den
niedergerissenen Verhauen. Als der Herzog von Lothringen über die
Wallbrüstung sprengt, grüßt ihn nicht enden wollendes
Siegesgeschrei; das gefährlichste Bollwerk des Feindes vor Wien ist
gewonnen.
Erst jetzt befiehlt Lothringen seinem Flügel, zu halten. Eben, gerade als er
selbst über den Wall heraufsprengte, hat ihm ein Offizier des
Feldmarschalls von der Goltz das Erscheinen der ersten sächsischen
Truppen des Zentrums auf den Hängen des Kobenzl gemeldet. Beruhigt
kann er das Vorgehen des Zentrums abwarten. Brüllt doch jetzt mit
einemmal längs der anderthalbstündigen Frontlänge des
verbündeten Heeres auch im Zentrum die Schlacht auf. Im Sturmschritt
rennen Bayern und Reichstruppen, die schweren Strapazen eines stundenlangen
hinter ihnen liegenden Anmarsches durch unwegsames Gelände nicht
achtend, vom Hermannskogel auf Döbling herab. Im zähen Kampf
wird Grinzing von den Sachsen des linken Zentrums genommen, und auch bei den
Bayern und Reichstruppen Waldecks zwingen die Deutschen Kara Mustaphas
Zentrum trotz der Weinberge, Hecken und dicht hintereinander gestaffelten
Verhacke Schritt um Schritt in die Talebene herab.
Doch wo bleiben die Polen? Schon ist es Mittag geworden und Lothringen hat
Mühe, seinen Flügel weiter angesichts der im Pulverdampf liegenden
Stadt und des greifbar nahen türkischen Lagers zu halten. Ordonnanz um
Ordonnanz schickt man zu dem äußersten Flügel des Zentrums
hinüber. Da flattern endlich gegen die erste Mittagsstunde die
Fähnchen der polnischen Lanzenreiter bei Dornbach auf. Auch das
Erscheinen kaiserlicher Bataillone und Reiter auf dem Galitzinberge ist zu
erkennen, aber für die Ausführung des Gedankens, den Lothringen
dem Schlachtplan zugrunde legte, nämlich durch das weite Ausholen des
Flügels die türkische Schlachtordnung zu umfassen, ist es zu
spät. Der rechte Flügel unter dem Oberbefehl Sobieskis hat zu lange
zu seiner Entwicklung in die Schlachtordnung gebraucht. Wohl brechen jetzt die
polnischen Husaren der Prinzen Alexander und Felix Potocki mit den
Panzerreitern Stanislaus Potockis ungestüm gegen die Türken herab.
Aber ihr Ungestüm bringt plötzlich den ganzen rechten Flügel
in schwerste Gefahr. Ibrahim, der Pascha von Ofen, der Sobieski gegenüber
befehligt, läßt die polnischen Reiter kaltblütig seine
Schlachtfront durch- [50] brechen, und wie sie
mitten zwischen den Flügeln seiner Heerhaufen sind, wirft er sich mit
solchem Ungestüm in ihre Flanken, daß die Türken den Keil
der polnischen Reiter beinahe gänzlich vernichten. Nur mit Aufbietung
aller Kraft vermag das österreichische Fußvolk, das Sobieski
beigegeben ist, durch zähe Abwehr des nun einsetzenden türkischen
Ansturmes, zu dem auch ein Teil des Zentrums unter Kara Mustapha
einschwenkt, auf dem Galitzinberg die Aufstellung der polnischen Hauptmacht zu
decken. Jetzt erst gelingt es Sobieski, mit der ganzen Gewalt seiner
Streitkräfte auf Ibrahim Pascha zu drücken. 7000 Reiter, Husaren
und Gepanzerte schickt er gegen den kriegserfahrenen Pascha von Ofen vor,
während kaiserliche und bayrische Schwadronen unter Rabetta und dem
Markgrafen von Bayreuth mit sechstausend polnischen Dragonern unter Matigny
seine Flanken gegen die leichte Reiterei Ibrahims decken. Aber der alte
türkische Haudegen gibt sich auch vor dem Ansturm der gewaltigen
Reitermassen noch lange nicht geschlagen. Nur schwer können die
polnischen Reiter die auch hier überall die Wege versperrenden Weinberge
und Hecken überwinden. Erst als es Sobieskis Gepanzerten gelingt, durch
eine Schwenkung einen Teil entgegensprengender türkischer Reiter
abzudrängen und die sich nun, von zwei Seiten gefaßt, gegen die
vorgehende polnische Infanterie oberhalb Weinhaus und Ottakring wenden, wird
die türkische Schlachtordnung an dieser Stelle zerrissen und bald darauf die
Verbindung zwischen dem polnischen Flügel und den Bayern durch
polnische Lanzenreiter hergestellt.
Entschlossen, nicht nur den Sieg, sondern durch diesen Sieg auch die
Entscheidung und völlige Vernichtung des Feindes zu erzwingen, reitet
Lothringen zu den Generalen der an seinem rechten Flügel haltenden
Sachsen heran und ruft mit laut schallender Stimme, daß es die Bataillone
der Sachsen und Kaiserlichen deutlich und unwiderruflich hören:
"Marchons donc messieurs! - Vorwärts, ihr Herren, marschieren wir
nach Wien!"
Als wenn das Zwingende dieser Parole den Soldaten, die unter dem Befehl des
Lothringers stehen, gesteigerte Kräfte verliehen hätte, so werfen sich
Kaiserliche und Sachsen auf die letzte Stellung der Türken. Im
stürmischen Handgemenge wird der Gegner auf seinen Verhauen am
Krottenbach geworfen; die mit sechs Geschützen armierte
Türkenschanze bei Döbling fällt in die Hände der
Sachsen, und während dadurch auch Sievring und Gersthof in ihren Besitz
gelangt, tragen die Bayern und Reichstruppen im Zentrum ihren Angriff
über Währing und Hernals hinaus. Noch wird erbittert bei den Polen
gefochten. Ibrahim Pascha wehrt sich wie ein Löwe, und solange der
Kampf im Zentrum für die Türken zwar unglücklich, aber
doch noch mit der Aus- [51] sicht auf die
Möglichkeit eines geordneten Rückzuges dauert, zieht er sich nur
langsam und fortwährend fechtend auf die hinter ihm stehenden Treffen
zurück.

[36]
Herzog Carl von Lothringen,
der Befreier Wiens.
Die bedeutendsten Führer in den Türkenkriegen
Zeitgenössischer Stich.
(Historischer Bilderdienst, Berlin)
|
Da befiehlt der Lothringer seinem Flügel, angesichts des türkischen
Lagers rechts einzuschwenken. Jetzt vollzieht sich etwas, was bis dahin nach den
Gepflogenheiten des noch vielfach in den Überlieferungen des
Dreißigjährigen Krieges steckenden Heeres unerhört scheint.
Herzog Carl von Lothringen wirft das sich ihm entgegenstellende irreguläre
Fußvolk der Osmanen in ihr Lager zurück und marschiert, ohne
daß auch nur ein einziger der Soldaten aus dem Gliede tritt, mitten durch
das von Beutestücken strotzende türkische Lager. Diese musterhafte
Ordnung der Kaiserlichen und Sachsen sichert dem Verbündeten den Sieg
und wird die Ursache von Kara Mustaphas endgültiger Vernichtung.
Plötzlich am eigenen rechten Flügel in der Flanke gefaßt,
aufgerollt und nun in der Rechten des Zentrums gefaßt, beginnt der Kern
des türkischen Heeres, die im letzten Treffen aufmarschierende
Janitscharengarde, unter ihrem Aga zu wanken. Es nützt nichts, daß
Kara Mustapha, der in diesem Augenblick endlich die hereinbrechende
Katastrophe erkennt, in wilder Verzweiflung die grüne Fahne des
Propheten entfaltet. Auch daß er in letzter Sekunde seinem Widersacher,
dem tüchtigen Ibrahim Pascha, den Oberbefehl über die noch nicht
aufgeriebenen Heerhaufen überträgt, kann das Schicksal der
osmanischen Waffen nicht wenden. Sosehr sich Kara Mustapha selber mit
gezogenem Säbel, mit Drohungen, Verwünschungen und sogar mit
Bitten den gegen seine Garde Zurückflutenden entgegenstemmt, so bleibt
doch die Bresche in seine Besten geschlagen. Noch einmal sammelt Osman Aga
im linken Flügel des Zentrums und gegenüber den Polen Tausende
der besten türkischen Reiter. Aber der Gegenangriff der polnischen
Lanzenreiter Johann Sobieskis trifft die anreitenden Spahis mit einer solchen
gewaltigen Wucht, daß die Schwärme der Araber einfach zerflattern.
Nun jagen auch die Bayern das letzte Treffen der Janitscharen im frontalen
Ansturm über die Schmelz und St. Ulrich zurück. Kaum,
daß es dem tapferen Tatarenaga
Hadschi-Giray gelingt, die Fahne des Propheten aus einem wütenden
Handgemenge zu retten, denn schon brechen aus dem eingeschwenkten linken
Flügel des Lothringers Dragonerregimenter im Galopp gegen die
weichenden Janitscharengarde vor; haltlos versuchen nun auch die letzten, die
Widerstand geleistet haben, in der Flucht ihre Rettung. Während Kara
Mustapha selber auf einem Renner gegen Petronell davonsprengt, jagt ein kleiner
Obrist mit seinen Dragonern ungestüm zwischen den Fliehenden bis zu den
Laufgräben vor dem Schottentor der Kaiserstadt vor, gewinnt mit den

[36]
Markgraf Ludwig von Baden,
der "Türkenlouis".
Die bedeutendsten Führer in den Türkenkriegen
Zeitgenössischer Stich.
(Historischer Bilderdienst, Berlin)
|
Kuefsteindragonern [52] im tollen Ritt die Spitze
vor dem Markgrafen Ludwig, und hält mit schäumendem Rappen
genau um die fünfte Nachmittagsstunde vor Wien. Unter schmetterndem
Trompetenschall verkündet er und der Markgraf Ludwig von Baden den
Wienern auf den Bastionen den Sieg. Wenige Minuten später öffnen
sich die Tore, und als die Verteidiger der Stadt durch die leer gewordenen
Laufgräben den Rettern entgegenstürmen, weist der kleine Obrist mit
dem Pallach nur stumm gegen Schönbrunn und den Wiener Berg
hinüber, über deren Anhöhen soeben die letzten
flüchtenden Türken unter der Führung Ibrahim Paschas
verschwinden. 4000 Gefallene der Verbündeten decken die Walstatt des
Sieges. Den Türken aber hat die Schlacht mehr als 10 000 Tote
gekostet. Schier unermeßlich scheint die Beute, welche die Sieger im Lager
Kara Mustaphas finden. Aber wie sehr auch 117 erbeutete Geschütze, oder
20 000 Metallhandgranaten, ebenso viele Büffel, Ochsen, Kamele
und Pferde und eine für jene Zeit schier unfaßbare Menge an
sonstigem Kriegsmaterial den Verbündeten das Ausmaß ihres
Erfolges verkünden, so vermag diese gewaltige Beute nicht die Opfer
auszugleichen, die Wien als Bollwerk der Ostmark gebracht hat. Von über
1000 Schüssen getroffen, blickt der Stephansdom auf ein
Trümmerwerk herab, das König Sobieski in einem Schreiben an
seine Gemahlin "einen Anblick herabgestürzter Felsenmassen" nennt.
Über 100 000 Bomben und Kanonenkugeln hat der Türke in
die unglückliche Stadt geworfen, mit 41 Minenladungen hat er ihre
Bastionen zersprengt, 50 Stürmen hat sie heldenhaft widerstanden, und als
sich nun der Abend des 12. September unter dem feierlichen Glockengeläut
der Erlösung über die Stadt niedersenkt, hat sich Wien als ewiges
Zeugnis deutschen Opfermutes in das Buch der Geschichte eingetragen. Eine
unvergeßliche Verpflichtung, zu der sich diese Stadt auch heute wieder
bekennt!
|